Heft 41 / 2014
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
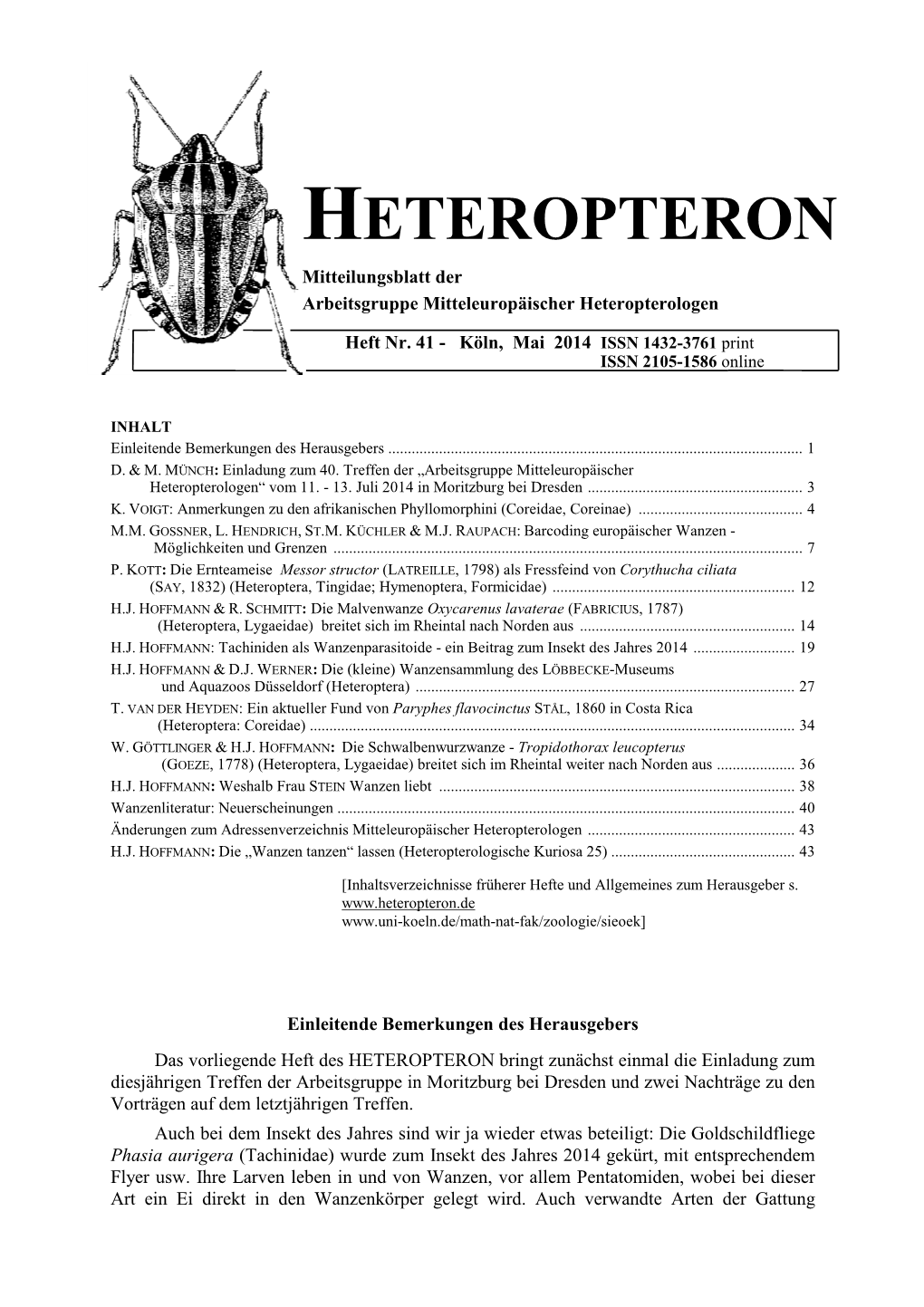
Load more
Recommended publications
-

Entomology 101 Jason J
Entomology 101 Jason J. Dombroskie Manager, Cornell U. Insect Collection Coordinator, Insect Diagnostic Lab This material [email protected] can only be used for CCE MGV audiences. Outline • What is an insect? • Anatomy • Life cycles • Diversity • Major orders • Herbivory Corydalus cornutus Cornell U. Insect Collection • > 7 million specimens • ~200 000 species • worldwide coverage • http://cuic.entomology.cornell.edu/ • on facebook Insect Diagnostic Lab • ~700 IDs per year • 10-20 000 IDs for NYS Dept. Ag. & Markets • occasionally IDs can be made from a photo • mostly local, but some submissions worldwide • $25 fee • http://entomology.cornell.edu/IDL Arthropods Regier, et al. 2005 What is an insect? • 3 main body parts • 6 jointed legs • 1 pair of antennae • compound eyes • usually some sort of metamorphosis Booneacris glacialis Head • antennae • mouthparts • compound eyes • ocelli Monochamus scutellatus Popillia japonica Tetanocera sp. Antheraea polyphemus wikimedia commons labrum maxilla mandible labium Corydalus cornutus Polygonia progne Aedes sp. Hybomitra zonalis Monochamus notatus Aeshna canadensis Isoptera Darapsa myron Thorax • six legs • four wings or less • muscular Amateur Entomologists’ Society Entomologists’ Amateur Limenitis archippus Lethocerus americanus Zeugomantispa minuta Machimus sp. with Herpetogramma pertextalis wikimedia commons Tipula apicalis Cybister fimbriolatus Elasmucha lateralis Automeris io Abdomen • internal organs • genitalia • ovipositor Ophiogomphus rupinsulensis Lauxania shewelli Merope tuber Adoxophyes -

Tachinid (Diptera: Tachinidae) Parasitoid Diversity and Temporal Abundance at a Single Site in the Northeastern United States Author(S): Diego J
Tachinid (Diptera: Tachinidae) Parasitoid Diversity and Temporal Abundance at a Single Site in the Northeastern United States Author(s): Diego J. Inclan and John O. Stireman, III Source: Annals of the Entomological Society of America, 104(2):287-296. Published By: Entomological Society of America https://doi.org/10.1603/AN10047 URL: http://www.bioone.org/doi/full/10.1603/AN10047 BioOne (www.bioone.org) is a nonprofit, online aggregation of core research in the biological, ecological, and environmental sciences. BioOne provides a sustainable online platform for over 170 journals and books published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses. Your use of this PDF, the BioOne Web site, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne’s Terms of Use, available at www.bioone.org/page/terms_of_use. Usage of BioOne content is strictly limited to personal, educational, and non-commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder. BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research. CONSERVATION BIOLOGY AND BIODIVERSITY Tachinid (Diptera: Tachinidae) Parasitoid Diversity and Temporal Abundance at a Single Site in the Northeastern United States 1 DIEGO J. INCLAN AND JOHN O. STIREMAN, III Department of Biological Sciences, 3640 Colonel Glenn Highway, 235A, BH, Wright State University, Dayton, OH 45435 Ann. Entomol. Soc. Am. 104(2): 287Ð296 (2011); DOI: 10.1603/AN10047 ABSTRACT Although tachinids are one of the most diverse families of Diptera and represent the largest group of nonhymenopteran parasitoids, their local diversity and distribution patterns of most species in the family are poorly known. -

The Metathoracic Scent Gland of the Leaf-Footed Bug, Leptoglossus Zonatus
Journal of Insect Science: Vol. 13 | Article 149 Gonzaga-Segura et al. The metathoracic scent gland of the leaf-footed bug, Leptoglossus zonatus J. Gonzaga-Segura1a, J. Valdez-Carrasco2b, V. R. Castrejón-Gómez1c* 1Becario COFAA. Laboratorio de Ecología Química de Insectos. Departamento de Interacciones Planta-Insecto. Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional. Carretera Yautepec, Jojutla, Km. 6 Calle CEPROBI No. 8, Col. San Isidro, Yautepec, Morelos, Mexico, C.P. 62731 2Laboratorio de Morfología de Insectos. Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas Campus Montecillo. Car- retera México-Texcoco km 36.5, Montecillo, Texcoco, Estado de México, C.P. 56230 Abstract The metathoracic scent gland of 25-day-old adults of both sexes of the leaf-footed bug, Leptoglossus zonatus (Dallas) (Heteroptera: Coreidae), are described based on optical microscopy analysis. No sexual dimorphism was observed in the glandular composition of this species. The gland is located in the anteroventral corner of the metathoracic pleura between the middle and posterior coxal pits. The opening to the outside of the gland is very wide and permanently open as it lacks a protective membrane. In the internal part, there is a pair of metathoracic glands that consist of piles of intertwined and occasionally bifurcated cellular tubes or columns. These glands discharge their pheromonal contents into the reservoir through a narrow cuticular tube. The reservoir connects with the vestibule via two opposite and assembled cuticular folds that can separate muscularly in order to allow the flow of liquid away from the insect. The external part consists of an ostiole from which the pheromone is emitted. -

The Impact of Specialist and Generalist Pre-Dispersal Seed Predators on the Reproductive Output of a Common and a Rare Euphorbia Species
Acta Oecologica 36 (2010) 227e233 Contents lists available at ScienceDirect Acta Oecologica journal homepage: www.elsevier.com/locate/actoec Original article The impact of specialist and generalist pre-dispersal seed predators on the reproductive output of a common and a rare Euphorbia species Mário Boieiro a,*, Carla Rego b, Artur R.M. Serrano a, Xavier Espadaler c a Centro de Biologia Ambiental/Departamento de Biologia Animal, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 1749-016 Lisboa, Portugal b Grup de Biologia Evolutiva (GBE), Departament de Genètica i de Microbiologia, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain c CREAF and Unitat d'Ecología, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain article info abstract Article history: Pre-dispersal seed predators can have a severe impact on the reproductive output of their hosts, which Received 31 August 2009 can translate into negative effects on population dynamics. Here we compared the losses due to specialist Accepted 8 January 2010 and generalist insect seed predators in two Euphorbia species, a rare (Euphorbia welwitschii) and Published online 4 February 2010 a common one (Euphorbia characias). Pre-dispersal losses to specialist seed-wasps (Eurytoma jaltica) and generalist hemipterans (Cydnus aterrimus and Dicranocephalus agilis) were on average higher for the rare Keywords: E. welwitschii than for its widespread congener. In both Euphorbia species, the variation in losses to Seed predation specialist and generalist seed predators was not related with traits indicative of plant size, fecundity, or Seed-feeding insects Congeneric species isolation. Nevertheless, the temporal variation in losses to seed-wasps seemed to be intimately associ- Plant rarity ated with the magnitude of yearly variation in fruit production. -

Insecta, Diptera): Proposed Conservation of Usage by Designation of Musca Plebeja Linnaeus, 1758 As the Type Species of Thereva
198 Bulletin of Zoological Nomenclature 60(3) September 2003 Case 3251 Thereva Latreille, 1797 and Phasia Latreille, 1804 (Insecta, Diptera): proposed conservation of usage by designation of Musca plebeja Linnaeus, 1758 as the type species of Thereva Kevin C. Holston Department of Entomology, University of Illinois, Urbana, IL 61801, U.S.A. (e-mail: [email protected]) Michael E. Irwin Department of Natural Resources and Environmental Sciences, University of Illinois, Urbana, IL 61801, U.S.A. (e-mail: [email protected]) F. Christian Thompson Systematic Entomology Laboratory, PSI, BARC, ARS, USDA, do Smithsonian Institution, Washington, D.C. 20560, U.S.A. (e-mail: [email protected]) Abstract. The purpose of this application, in relation to Article 67.2 of the Code, is to conserve the usage of the name Thereva Latreille, 1797 for a cosmopolitan genus of stiletto flies (family THEREVIDAE) that currently includes 201 species, and also the usage of Phasia Latreille, 1804 and PHASIINAE for a group of tachinid flies (family TACHINIDAE), some of which are economically important as parasites of plant bugs (Heteroptera). It is proposed that Musca plebeja Linnaeus, 1758 should be designated as the type species of the therevid genus Thereva. M. plebeja was not one of the nominal species that were first associated with the name Thereva by Fabricius (1798). Fabricius used Thereva for a group of tachinid flies that are now referred to by the name Phasia Latreille, 1804. Keywords. Nomenclature; taxonomy; Diptera; THEREVIDAE; TACHINIDAE; Thereva; Phasia; Thereva plebeja; stiletto flies; tachinids. 1. Latreille (1797, p. 168) described a genus of stiletto fries (now in the family THEREVIDAE) and named it Thereva. -

Die Raupenfliegen (Diptera: Tachinidae) Mitteleuropas: Bestimmungstabellen Und Angaben Zur Verbreitung Und Ökologie Der Einzelnen Arten
5 download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/ Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Serie A (Biologie) Herausgeber: 4fr für Naturkunde, RosensteinV 70 19 l; , Staatliches Museum 1, D- r Stuttgart Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. A Nr. 506 170 S ,4. 9. 19.94 Professor Dr. Bernhard Ziegler zum 65. Geburtstag Die Raupenfliegen (Diptera: Tachinidae) Mitteleuropas: Bestimmungstabellen und Angaben zur Verbreitung und Ökologie der einzelnen Arten The Tachinids (Diptera: Tachinidae) of Central Europe: Identification Keys for the Species and Data on Distribution and Ecology Von Hans-Peter Tschorsnig und Benno Herting, Stuttgart Mit 291 Abbildungen Summary Keys are given for all central and northern European species of Tachinidae (Diptera). The most important data on distribution and ecology (mainly habitat, phenology, and host-range) are listed for the central European species. Zuammenfassung Es werden Bestimmungsschlüssel für alle in Mittel- und Nordeuropa vorkommenden Arten der Tachinidae (Diptera) gegeben. Für jede mitteleuropäische Art werden die wichtigsten Kenndaten zur Verbreitung und Ökologie (vor allem Habitat, Flugzeit und Wirtskreis) aufge- listet. Inhalt 1. Einleitung 2 2. Beg'iff.c erklärungen 4 2.1. Allgemeines 4 2.2. Kopf 5 2.3. Thorax 7 2.4. Flügel 8 2.5. Beine 9 2.6. Abdomen 10 2.7. Bereifung 11 2.8. Färbung . 11 download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/ 2 STUTTGARTER BEITRÄGE ZUR NATURKUNDE Ser. A, Nr. 506 2.9. Körpergröße 11 2.10. Abkürzungen 11 3. Schlüssel für die Gattungen 12 4. Schlüssel für die Arten . 42 4.1. Subfamilie Exoristinae 42 4.2. Subfamilie Tachininae 63 4.3. Subfamilie Dexiinae 79 4.4. -

Diptera: Tachinidae, Phasiinae; Anthomyiidae) Уссурийского Заповедника И Сопредельной Территории
УдК 591.9:595.773.4 Маркова Т.О.1, Репш Н.В.1, Маслов М.В.2 1дальневосточный федеральный университет. школа педагогики, e-mail: [email protected]; [email protected] 2Государственный природный заповедник «Уссурийский» им. В.л. Комарова дВО РАН, e-mail: [email protected] Зоогеографический АНАЛИЗ ФАУНы ДВУКРыЛыХ (DIptera: tacHINIDae, pHaSIINae; aNtHomyIIDae) УССУРИйСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И СОПРЕДЕЛьНОй территории Тахины подсем. Phasiinae (Diptera) являются специализированными паразитами насекомых (Hemiptera). Большинство представителей Anthomyiidae – виды-фитофаги, среди которых немало вредителей сельского и лесного хозяйства. Во время исследований (1996–2012 гг.) на территории Уссурийского заповедника и сопредельной обнаружено 37 видов Phasiinae (tachinidae), относя- щихся к 17 родам. Фауна Anthomyiidae составляет 36 видов, относящихся к 19 родам (74 % и 64 % фауны Приморского края соответственно). целью настоящего исследования являлось проведение ареалогического анализа фауны двукрылых (Diptera) семейства Tachinidae (phasiinae) и семейства Anthomyiidae Уссурийского за- поведника и сопредельной территории Южного Приморья, который представлен в нашей работе впервые. В основу классификации ареалов положена схема зоогеографического деления земного шара А.П. Семенова-Тян-Шанского с дополнениями по О.Л. Крыжановскому. При проведении ареалогического анализа использованы работы, в которых даются сведения о распространении видов двукрылых в Палеарктике, учтены данные о неарктических и ориентальных двукрылых. В подсемействе Phasiinae (tachinidae) выделено -

Download the Survey Results
WILDLIFE IN COMMON SURVEY Wildlife in Common Survey Site Name: Pit Common (also known as Drove Hill Common) Parish: Southrepps Grid reference: TG 262353 Area: 0.36 hectares District: North Norfolk Survey date: 17 September 2018 Registered Common Number – CL 390 Pond on Pit Common 1 WILDLIFE IN COMMON SURVEY Annotated habitat map (showing target note numbers): 2 WILDLIFE IN COMMON SURVEY Habitat map 3 WILDLIFE IN COMMON SURVEY Habitat description: Situated in Lower Street Southrepps, Pit Common (registered as Drove Hill Common) is a small area of pond, grassland, scrub and planted trees, which rises up away from the road. Number Target Note (see map) 1 G1 (pond), F2.1 (Marginal vegetation) & A2 (Willow scrub) Pond. At the time of the survey the pond was dry. Invaded with New Zealand pygmy weed (Crassula helmsii) to the south and greater reed mace (Typha latifolia) to the North with a stand of common reed (Phragmites australis) to the East there was little open water. Small patches of reed canary grass (Phalaris arundinacea) to the east and west banks. Coppiced willow (Salix sp.) to the Northern end. Previous management of the pond has resulted in the presence of water lilies (Nyphaea alba). Also present are water plantain (Alisma plantago-aquatica), celery-leaved buttercup (Ranunculus scleratus), soft rush (Juncus effusus), hard rush (Juncus inflexus), and galingale (Cyperus longus). In 2009 the pond was completely dredged and a large area of open water formed. This has slowly silted up again and become overrun with the bulrush (Typha latifolia) and the Crassula that appeared this year (2018). -

76 ©Kreis Nürnberger Entomologen; Download Unter
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. Jahr/Year: 1997 Band/Volume: 13 Autor(en)/Author(s): Dunk Klaus von der Artikel/Article: Ecological studies on Pipunculidae (Diptera) 61-76 ©Kreis Nürnberger Entomologen; download unter www.biologiezentrum.at galathea 13/2 Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen1997 • S. 61 -76 Ecological studies on Pipunculidae (Diptera) K laus von der D unk Zusammenfassung: Es wird über Freilandbeobachtungen an Augenfliegen berich tet. Räumlich begrenzte Vorkommen erwiesen sich als erstaunlich artenreich. Sie werden im einzelnen vorgestellt, sowie eine bemerkenswerte Begleitfauna genannt. Betrachtungen von Verhaltensweisen runden das Bild ab, zeigen aber gleichzeitig die Notwendigkeit für weitere Studien. Abstract: Studies on Pipunculid flies in their natural environment are presented. Certain places are described, which proved to be astonishingly rieh in species. Some remarkable associating insect species are listed. As far as investigated comments on the behaviour of the adult flies are added. Key words: Diptera, Pipunculidae, behaviour, ecology Introduction Pipunculid flies are rather small mostly black insects, developing as parasitoids inside leafhoppers, with the ability of hovering (relationship to Syrphidae) and with enormous compound eyes, useful for males in search for females, and for females in search for a potential victim, a cicad larva. Most specimen of Pipunculidae studied so far were collected by Malaise traps. This material allows to describe the existing species, to secure their systematical stand, and to mark their distribution. Many questions in this chapter are still open. On the other hand the development as parasitoids in leafhoppers show fascinating aspects of adaptations to this life and even has an ecological/economical content regarding pest control. -

Ad Hoc Referees Committee for This Issue Thomas Dirnböck
COMITATO DI REVISIONE PER QUESTO NUMERO – Ad hoc referees committee for this issue Thomas Dirnböck Umweltbundesamt GmbH Studien & Beratung II, Spittelauer Lände 5, 1090 Wien, Austria Marco Kovac Slovenian Forestry Institute, Vecna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija Susanna Nocentini Università degli Studi di Firenze, DISTAF, Via S. Bonaventura 13, 50145 Firenze Ralf Ohlemueller Department of Biology, University of York, PO Box 373, York YO10 5YW, UK Sandro Pignatti Orto Botanico di Roma, Dipartimento di Biologia Vegetale, L.go Cristina di Svezia, 24, 00165 Roma Stergios Pirintsos Department of Biology, University of Crete, P.O.Box 2208, 71409 Heraklion, Greece Matthias Plattner Hintermann & Weber AG, Oeko-Logische Beratung Planung Forschung, Hauptstrasse 52, CH-4153 Reinach Basel Arne Pommerening School of Agricultural & Forest Sciences, University of Wales, Bangor, Gwynedd LL57 2UW, DU/ UK Roberto Scotti Università degli Studi di Sassari, DESA, Nuoro branch, Via C. Colombo 1, 08100 Nuoro Franz Starlinger Forstliche Bundesversuchsanstalt Wien, A 1131 Vienna, Austria Silvia Stofer Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft – WSL, Zürcherstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf, Switzerland Norman Woodley Systematic Entomology Lab-USDA , c/o Smithsonian Institution NHB-168 , O Box 37012 Washington, DC 20013-7012 CURATORI DI QUESTO NUMERO – Editors Marco Ferretti, Bruno Petriccione, Gianfranco Fabbio, Filippo Bussotti EDITORE – Publisher C.R.A. - Istituto Sperimentale per la Selvicoltura Viale Santa Margherita, 80 – 52100 Arezzo Tel.. ++39 0575 353021; Fax. ++39 0575 353490; E-mail:[email protected] Volume 30, Supplemento 2 - 2006 LIST OF CONTRIBUTORS C.R.A.A - ISTITUTO N SPERIMENTALE N A PER LA LSELVICOLTURA I (in alphabetic order) Allegrini, M. C. -

Information on Tachinid Fauna (Diptera, Tachinidae) of the Phasiinae Subfamily in the Far East of Russia
International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-9 Issue-2, December, 2019 Information on Tachinid Fauna (Diptera, Tachinidae) Of the Phasiinae Subfamily in the Far East of Russia Markova T.O., Repsh N.V., Belov A.N., Koltun G.G., Terebova S.V. Abstract: For the first time, a comparative analysis of the For example, for the Hemyda hertingi Ziegler et Shima tachinid fauna of the Phasiinae subfamily of the Russian Far species described in the Primorsky Krai in 1996 for the first East with the fauna of neighboring regions has been presented. time the data on findings in Western, Southern Siberia and The Phasiinae fauna of the Primorsky Krai (Far East of Russia) is characterized as peculiar but closest to the fauna of the Khabarovsk Krai were given. For the first time, southern part of Khabarovsk Krai, Amur Oblast and Eastern Redtenbacheria insignis Egg. for Eastern Siberia and the Siberia. The following groups of regions have been identified: Kuril Islands, Phasia barbifrons (Girschn.) for Western Southern, Western and Eastern Siberia; Amur Oblast and Siberia, and Elomya lateralis (Mg.) and Phasia hemiptera Primorsky Krai, which share many common Holarctic and (F.) were indicated.At the same time, the following species Transpalaearctic species.Special mention should be made of the have been found in the Primorsky Krai, previously known in fauna of the Khabarovsk Krai, Sakhalin Oblast, which are characterized by poor species composition and Japan (having a Russia only in the south of Khabarovsk Krai and in the subtropical appearance). Amur Oblast (Markova, 1999): Phasia aurigera (Egg.), Key words: Diptera, Tachinidae, Phasiinae, tachinid, Phasia zimini (D.-M.), Leucostoma meridianum (Rond.), Russian Far East, fauna. -

Diptera: Oestroidea) Magdi S
El-Hawagry Egyptian Journal of Biological Pest Control (2018) 28:46 Egyptian Journal of https://doi.org/10.1186/s41938-018-0042-3 Biological Pest Control RESEARCH Open Access Catalogue of the Tachinidae of Egypt (Diptera: Oestroidea) Magdi S. El-Hawagry Abstract Tachinid flies are an important group of parasitoids in their larval stage, and all their hosts are of the Arthropoda, almost exclusively other insects, including important insect pests in agriculture and forestry. All known Egyptian taxa of the family Tachinidae are systematically catalogued. Synonymies, type localities, type depositories, world distributions by biogeographic realm(s) and country, Egyptian localities, and dates of collection are provided. A total of 72 tachinid species belonging to 42 genera, 15 tribes, and 4 subfamilies has been treated. Keywords: Tachinid flies, Egyptian taxa, World distribution, Egyptian localities, Dates of collection Background agriculture and forestry. They typically parasitize phytopha- Tachinidae are a large and cosmopolitan family of flies gous larvae of Lepidoptera and Coleoptera or nymphs of within the superfamily Oestroidea. It is the second largest Hemiptera and Orthoptera. Consequently, tachinid flies family in the order Diptera (Irwin et al. 2003), with some have been successfully applied in programs of biological 1500 recognized genera (O’Hara 2016) and more than control against different insect pests (Stireman et al. 2006; 8500 described species (O’Hara 2013) worldwide. How- O’Hara 2008 and Cerretti and Tschorsnig 2010). ever, the estimated true diversity of the family is probably No comprehensive taxonomic studies on the family double the number of the currently known species, mak- Tachinidae have been carried out in Egypt before.