Romane: Das Reife Werk
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
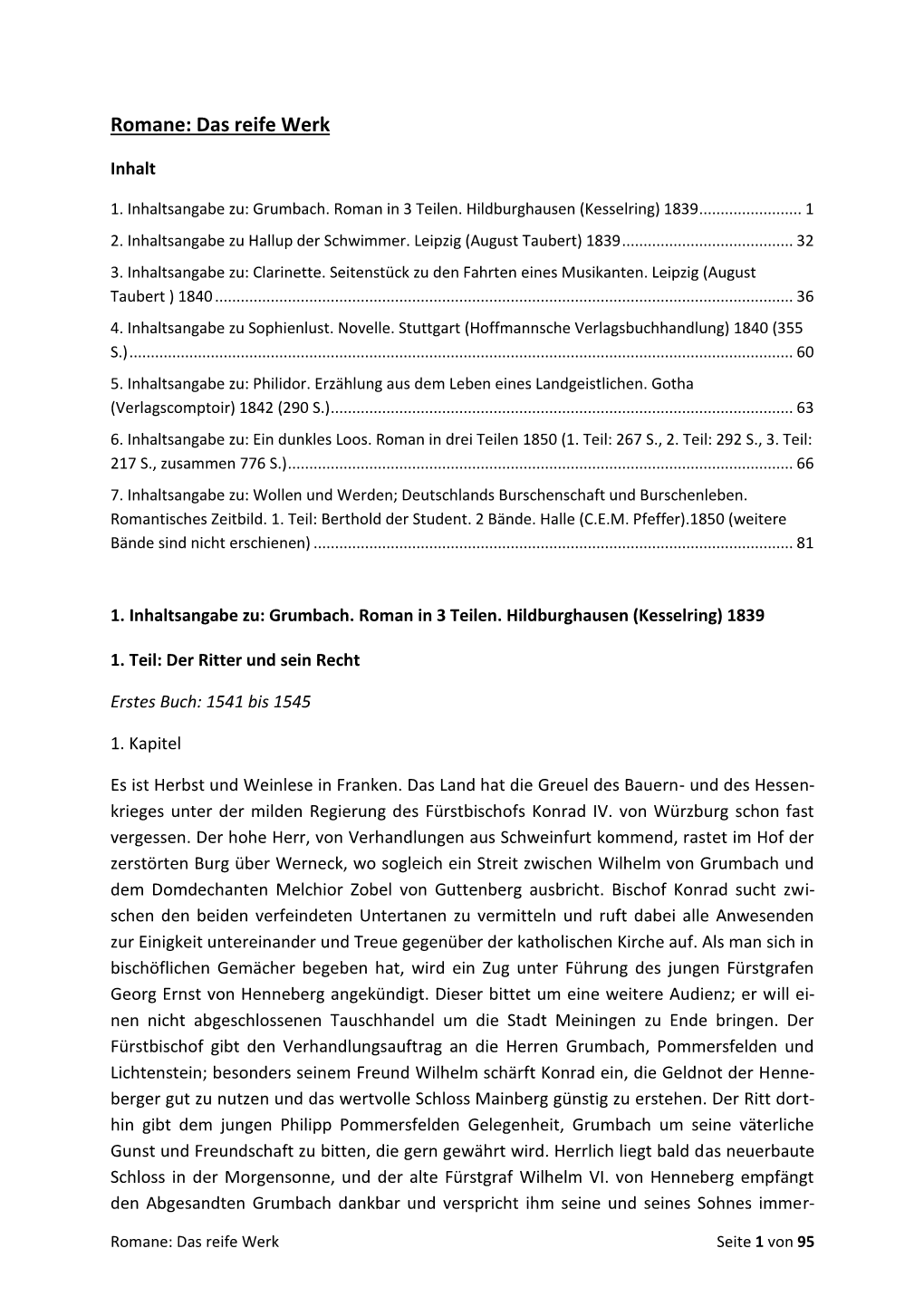
Load more
Recommended publications
-

Germany (1914)
THE MAKING OF THE NATIONS GERMANY VOLUMES ALREADY PUBLISHED IN THIS SERIES FRANCE By Cecil Headlam, m.a. COXTAIXING 32 FULL-PAGE ILLUSTRATIONS AND 16 MAPS AND SMALLER FIGURES IN THE TEXT " It is a sound and readable sketch, which has the signal merit of keeping^ what is salient to the front." British Weekly. SCOTLAND By Prof. Robert S. Rait CONTAINING 32 FULL-PAGE ILLUSTRATIONS AND 11 MAPS AND SMALLER FIGURES IN THE TEXT of "His 'Scotland' is an equally careful piece work, sound in historical fact, critical and dispassionate, and dealing, for the most part, with just those periods in which it is possible to trace a real advance in the national develop- ment."—Athenceum. SOUTH AMERICA By W. H. KoEBEL CONTAINING 32 FULL-PAGE ILLUSTRATIONS AND 10 MAPS AND SMALLER FIGURES IN THE TEXT " Mr. Koebel has done his work well, and by laying stress on the trend of Governments and peoples rather than on lists of Governors or Presidents, and by knowing generally what to omit, he has contrived to produce a book which meets an obvious need. ' —Morning Post. A. AND C. BLACK, 4 SOHO SQUARE, LONDON, W. AGENTS AMERICA .... THE MACMILLAN COMPANY 64 & 66 FIFTH AVENUE. NEW YORK AUSTEALA8IA . OXFORD UNIVERSITY PRESS 20- FLINDERS Lane. MELBOURNE CANADA THE MACMILLAN COMPANY OF CANADA. LTD. St. Marti.n's House, 70 Bond street, TORONTO RiDLA MACMILLAN 4 COMPANY, LTD. MACMILLAN BUILDING, BOMBAY 309 Bow Bazaar STREBT, CALCUTTA ^. Rischgits QUEEN LOUISE (lT7G-lS10), WinOW OF FREDERICK -WILLIAM III. OF PRUSSIA. Her patriotism anil self-sacrifice after the disaster of Jena have given her a liigli place in the affections of the German nation. -

The Peasants War in Germany, 1525-1526
Jioctaf JSibe of f0e (geformatton in THE PEASANTS WAR IN GERMANY ^ocmf ^i&e of flje (Betman (geformafton. BY E. BELFORT BAX. I. GERMAN SOCIETY AT THE CLOSE OF THE MIDDLE AGES. II. THE PEASANTS WAR, 15251526. III. THE RISE AND FALL OF THE ANA- BAPTISTS. [In preparation. LONDON: SWAN SONNENSCHEIN & CO., LIM. NEW YORK: THE MACMILLAN CO. 1THE PEASANTS WAR IN GERMANY// 1525-1526 BY E^BELFORT ': " AUTHOR OF " THE STORY OF THE FRENCH REVOLUTION," THE RELIGION OF SOCIALISM," "THE ETHICS OF SOCIALISM," "HANDBOOK OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY," ETC., ETC. WITH A MAP OF GERMANY AT THE TIME OF THE REFORMATION <& LONDON SWAN SONNENSCHEIN & CO., LIM. NEW YORK: THE MACMILLAN CO. 1899 54 ABERDEEN UNIVERSITY PRESS PREFACE. IN presenting a general view of the incidents of the so-called Peasants War of 1525, the historian encounters more than one difficulty peculiar to the subject. He has, in the first place, a special trouble in preserving the true proportion in his narrative. Now, proportion is always the crux in historical work, but here, in describing a more or less spontaneous movement over a wide area, in which movement there are hundreds of differ-^/ ent centres with each its own story to tell, it is indeed hard to know at times what to include and what to leave out. True, the essential ^ similarity in the origin and course of events renders a recapitulation of the different local risings unnecessary and indeed embarrassing for readers whose aim is to obtain a general notion. But the author always runs the risk of being waylaid by some critic in ambush, who will accuse him of omitting details that should have been recorded. -

Johann Walter's Cant I Ones (1544) : Historical Background and Symbolic Influences
JOHANN WALTER'S CANT I ONES (1544) : HISTORICAL BACKGROUND AND SYMBOLIC INFLUENCES BY ALAN MACDONALD B.MUS. DALHOUSIE UNIVERSITY, 1990 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES School of Music We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA August 1995 © Alan Macdonald 1995 In. presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the head of my department or by his or her representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department The University of British Columbia Vancouver, Canada DE-6 (2/88) \ s, ABSTRACT Johann Walter's two songs for seven voices, from Volume V of his collected works, present what seems to be a confused assemblage: three texts sounded simultaneously in a heirarchical structure of musical parts, at the centre of which is the technical feat of an ex unica canon for four voices. Viewing these pieces as part of the larger world of sixteenth-century vocal music, it seems that the normative procedures of musical composition and textual exposition have been turned inside-out, with startling results. One of the two, the setting of the Vulgate Psalm 119 (118), was performed publicly at the inaugural service of Hartenfels Chapel on Oct. -

29741529 Lese 1.Pdf
Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte herausgegeben von Irene Dingel Band 83 Gütersloher Verlagshaus Argula von Grumbach Schriften Bearbeitet und herausgegeben von Peter Matheson Gütersloher Verlagshaus Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 1. Auflage Copyright © 2010 by Verein für Reformationsgeschichte, Heidelberg Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außer- halb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Satz: SatzWeise, Föhren Druck und Einband: Memminger MedienCentrum AG, Memmingen Printed in Germany ISBN 978-3-579-05374-5 www.gtvh.de Vorwort Die vorliegende Edition wurde vor vielen Jahren von Dr. Dorothee Kommer angeregt. An dieser Stelle möchte ich ihr und all denen danken, die mich bei der Arbeit unter- stützt und begleitet haben. Mein besonderer Dank gilt Professor Dr. Irene Dingel, ohne deren weisen Rat und Geduld diese Ausgabe nie erschienen wäre. Desgleichen danke ich ihrer Mitarbeiterin, PD Dr. Bettina Braun, die den gesamten Text durch- gesehen und erheblich verbessert hat. Dr. Andree Hahmann und Isa Becher haben meinen Gebrauch (und Missbrauch!) der deutschen Sprache eingehend geprüft und korrigiert. Ihnen allen, und auch Dr. Gillian Bepler, Dr. Stephen Buckwalter, Herrn Ulrich Kopp, Dr. Ursula Paintner, Dr. Leigh Penman, Frau Anna Seidel, Dr. Tom Scott, Herrn Herbert Spachmüller und Dr. Alejandro Zorzin sei herzlichst gedankt. Für alle stehen gebliebenen Fehler bleibe ich selbst verantwortlich. -

Herr, Erhalte Mich Bei Deinem Wort
21. AEB-Jahrestagung vom 27. bis 29. Oktober 2016 in der Landesbibliothek Coburg Herr, erhalte mich bei Deinem Wort Dynastie und Konfession auf ernestinischen Fürsteneinbänden Handreichung zur Ausstellung Einführung Die Landesbibliothek Coburg ist als ernestinische Fürstenbibliothek entstanden. Ihre Geschichte und ihre Bestände lassen sich nur vor dem Hintergrund der zahlreichen Gebietsteilungen und -verschiebungen bei den Ernestinern verstehen. Diese resultieren aus dem Fehlen eines Erstgeburtsrechts. Coburg war seit Mitte des 14. Jahrhunderts wettinisch. Die Mutter Kurfürst Friedrichs I. (des Streitbaren) von Sachsen (1370-1428) war Katharina von Henneberg (um 1334-1397). Sie brachte das Coburger Land als ihr Erbe in die Ehe mit dem Wettiner Friedrich dem Strengen (1332-1382) ein. Coburg war bis 1918 ein wettinisch-ernestinisches Herzogtum und schloss sich erst 1920 dem Freistaat Bayern an. Seit 1485 gibt es die beiden wettinischen Linien der Ernestiner und Albertiner. Gut 50 Jahre später liegen die Anfänge der heutigen Landesbibliothek Coburg. In den 1540er Jahren erbaute Herzog Johann Ernst von Sachsen (*1521 Coburg; †1553 Coburg), der jüngere Halbbruder Kurfürst Johann Friedrichs I. (des Großmütigen), (1503-1554) Schloss Ehrenburg. Wie alle Ernestiner besaß Johann Ernst Bücher. Für die Einordnung der vorgestellten Einbände sind folgende Zusammenhänge wichtig: Kurfürst Friedrich III. (der Weise), (1463-1525) von Sachsen war der Landes- und Schutzherr Martin Luthers. Sein Nachfolger war zunächst sein Bruder Johann (der Beständige) (1468-1532) und anschließend dessen Sohn Johann Friedrich I. Dieser war verheiratet mit Sibylle, geborene Herzogin von Jülich-Kleve-Berg (*1512 Düsseldorf; †1554 Weimar). Sie hatten drei überlebende Kinder Johann Friedrich II. (der Mittlere) (1529-1595), Johann Wilhelm (1530-1573) und Johann Friedrich III. -

German Historical Institute London Bulletin, Vol 35, No
German Historical Institute London BULLETIN ISSN 0269-8552 Stefan Ehrenpreis: New Perspectives on an Old Story: The Early Modern Holy Roman Empire Revisited Review Article German Historical Institute London Bulletin, Vol 35, No. 1 (May 2013), pp39-54 Copyright © 2013 German Historical Institute London. All rights reserved. REVIEW ARTICLE NEW PERSPECTIVES ON AN OLD STORY: THE EARLY MODERN HOLY ROMAN EMPIRE REVISITED STEFAN EHRENPREIS JASON PHILIP COY, BENJAMIN MARSCHKE, and DAVID WARREN SABEAN (eds.), The Holy Roman Empire, Reconsidered, Spek trum: Publications of the German Studies Association, 1 (New York: Berg hahn Books, 2010), xvii + 328 pp. ISBN 978 1 84545 759 4 (hardback) US$120.00. £70.00 PETER H. WILSON, The Holy Roman Empire, 1495–1806 (2nd edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011), xvi + 156 pp. ISBN 978 0 230 23978 4 (paperback) £16.50 JOACHIM WHALEY, Germany and the Holy Roman Empire, vol. i: Maximilian I to the Peace of Westphalia 1493–1648, Oxford History of Early Modern Europe (Oxford: Oxford University Press, 2012), xxii + 722 pp. ISBN 978 0 19 873101 6. £85.00; vol. ii The Peace of Westphalia to the Dissolution of the Reich 1648–1806, Oxford History of Early Mo - dern Europe (Oxford: Oxford University Press, 2012), xxiv + 747 pp. ISBN 978 0 19 969307 8. £85.00 Ten years after German reunification, the history of the Holy Roman Empire of the German Nation became a focus of European policy. Referring to the federal tradition of German history, French Minister of Defence Jean-Pierre Chevennement accused the German govern- ment of holding up the Holy Roman Empire’s political system as a model for European constitutional structures in order to use a weak- ening of national powers to favour German interests. -

The Nuremberg Chronica: Recording Serious Crime and Capital
The Nuremberg Chronica: Recording Serious Crime and Capital Punishment in the Sixteenth Century Undergraduate Honors Research Thesis Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for Graduation “with Honors Research Distinction in German” in the Undergraduate Colleges of the Ohio State University By Haley Grubb The Ohio State University May 2021 Project Advisor: Professor Anna Grotans, Department of Germanic Languages and Literatures ACKNOWLEDGEMENTS First and foremost, I wish to express my sincere thanks to my advisor, Professor Anna Grotans, for her dedicated assistance and involvement in every step of my research. Without her support, I would not have been able to learn to read and translate Early New High German. I would also like to thank my committee members, Professor Sara Butler and Professor Eric Johnson for their guidance and valuable input. Finally, I would like to thank Aurora Fleming and Tamara Hauser, who took the time to meet with Professor Grotans and myself almost every week over the past year to learn the complicated script of this Chronicle. Their valuable insight helped me to work through difficult letter forms and become much more comfortable with the text, and for that I am extremely grateful. Grubb 1 MS.MR.15 is a unique manuscript codex that is on deposit in the collection of The Ohio State University’s Rare Books and Manuscripts Library.1 Its full descriptive title takes up most of the title page, though on the outside it is simply labelled “Nuremberg Chronica,” and it will hereafter be referred to simply as the Chronica. Encased within its original binding, the manuscript inside is a typical early modern history chronicle, which covers events in and around the free imperial city of Nuremberg, from 42 B.C. -

Residenzgeschichte Und Hofkultur Gothas Im 17. Und 18. Jahrhundert
Andreas Klinger Residenzgeschichte und Hofkultur Gothas im 17. und 18. Jahrhundert Der Beginn einer kontinuierlichen Gothaer Residenzgeschichte lässt sich genau datieren. Im April 1640 teilten die Herzöge Wilhelm IV., Albrecht und Ernst von Sachsen-Weimar ihr Fürstentum, aus dem drei neue Territorien hervorgingen: Weimar, Eisenach und Gotha. Die Teilung war von dem jüngsten der Brüder forciert worden. Der freilich nicht mehr ganz junge Ernst – geboren 1601 – war seit einigen Jahren verheiratet, überdies ehrgeizig und unzufrieden mit der Verwaltung des Weimarer Territoriums unter dem Direktorat seines ältesten Bruders Wilhelm IV.1 Herzog Ernst strebte nach einem eigenen Herzogtum, so klein es auch sein mochte, wenn er es nur als alleiniger Landesherr nach seinen Vorstellungen regieren konnte. Die sogenannte „Gothaer Landesportion“, die Herzog Ernst erhielt, war ein zusam- mengestückeltes Territorium, keine gewachsene Einheit, obwohl das große und zentrale Amt Gotha eine gewisse Herrschaftskontinuität garantierte. Dass es Ernst, später der Fromme genannt, gelang, mit Hilfe seiner Räte und eines schnell aufgebauten Ver- waltungsapparates das ererbte Territorium planvoll in einen Fürstenstaat zu verwan- deln, gehört zu den auch im Kontext der deutschen Nationalgeschichte gern erzählten Erfolgsgeschichten des 17. Jahrhunderts – gerade vor dem Hintergrund des Dreißigjähri- gen Krieges, in dessen letzte Dekade das Gothaer Staatsgründungsexperiment fel.2 Veit Ludwig von Seckendorff schöpfte aus seinen Erfahrungen im Gothaer Fürstendienst, als er seinen 1656 publizierten Teutschen Fürsten Stat verfasste.3 Dieses Staatshandbuch wurde zum erfolgreichen Lehrbuch für Verwaltungsfachleute und begründete Gothas langlebigen Ruf, ein lutherischer Musterstaat gewesen zu sein.4 Das neue Herzogtum Gotha besaß einige wenige kleinere Schlösser, aber keine geeig- nete Residenz. Der Gothaer Schlossberg lag wüst und erinnerte damit eindrücklich an jene kurze, abrupt beendete Zeit im 16. -

Zeitschrift Für Historische Forschung
ZEITSCHRIFT FÜR HISTORISCHE FORSCHUNG Herausgegeben von Johannes Kunisch, Klaus Luig ) Peter Moraw, Heinz Schilling, Bernd Schneidmüller Barbara Stollberg-Rilinger 30. Band 2003 DUNCKER & HUMBLOT / BERLIN FEHDEN UND FEHDEBEKÄMPFUNG AM ENDE DES MITTELALTERS Überlegungen zum Auseinandertreten von "Frieden" und "Recht" in der politischen Praxis zu Beginn des 16. Jahrhunderts am Beispiel der Absberg-Fehde+! Von Christine Reinle, Bochum Böhmen im Jahre 1531. Aus den Briefbüchern des Nürnberger Rats erfährt man von einem Mann auf der Flucht, dem nur noch die selbst rand- ständigen Juden Unterschlupf gewähren; wenig später traf dann in Nürn- berg die Nachricht vom Fund seiner Leiche in einem kleinen Marktort * Der folgenden Studie liegt meine Bochumer Antrittsvorlesung vom 6. Februar 2002 zugrunde; der Vortragsstil wurde weitgehend beibehalten. 1 Eine umfangreiche Quellenedition zur Absbergfehde legte Joseph Baader im Jah- re 1873 vor, die auf den amtlichen Aufzeichnungen der sog. Kriegsstube zu Nürnberg (1520-1531) basierte, vgl. Verhandlungen über Thomas von Absberg und seine Feh- den gegen den Schwäbischen Bund 1519 bis 1530, hrsg. v.Joseph Baader (Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart, 114), Tübingen 1873. Gestützt auf seine intime Quellenkenntnis verfaßte Baader darüber hinaus zwei Abhandlungen zum Thema, die lange Zeit das Bild Absbergs bestimmten, nämlich Joseph Baader, Der Placker Hanns Thomas von Absberg, in: 34. Jahresbericht des historischen Vereins von Mittelfranken, Ansbach 1866, 103-122; Joseph Baader, Die Fehde des Hanns Thomas von Absberg wider den schwäbischen Bund, München 1880. Erst mehr als 100 Jahre nach Baader nahm sich wieder ein Forscher in einer knappen Skizze des Themas an, vgl. Gerhard Pfeiffer, Hans Thomas von Absberg (ea. 1480? - 1531), in: Fränkische Lebensbilder, Bd. -

Kleine Geschichte Von Altenstein Und Seinen Ehemaligen Herren, Der Familie Von Stein Zum Altenstein Sowie Einige Hintergründe
Eine kleine Geschichte von Altenstein und seinen ehemaligen Herren, der Familie von Stein zum Altenstein sowie einige Hintergründe Wann hat sie begonnen? Dies ist eine spannende Frage, die sich nicht mit absoluter Gewiss- heit beantworten lässt. In einer Informationsschrift des Landkreises wurde zum Tag des Denkmals 2002 auf ein Heft des Frankenbundes Bezug genommen und die Zeit 802 – 817 für eine Ersterwähnung festge- stellt. Es gibt aus dieser Zeit die Schenkungsurkunde eines Grafen Erpho an das Kloster Ful- da, in der von Altensteten geschrieben wird. Gerade auch im östlichen Franken hatte das Kloster Fulda weit gestreuten Besitz und zweifellos waren solche Schenkungen keineswegs selten, gab es doch dafür oft ganz handfeste Gründe. Denn häufig wurde vereinbart, dass der Schenkende auch weiterhin Nutzungsrechte behielt, für die Sicherheit aber vorrangig der Be- schenkte zuständig wurde. Dennoch wird es sich im Falle Altensteins um ein Missverständnis handeln, wie übereinstimmend und überzeugend der Kreisheimatpfleger Günter Lipp und auch Dr. Wolfram Berninger aus Pfarrweisach meinen. Im Übrigen stellte sich dann auch die Frage, warum und wann die Fuldaer Klosteräbte das Geschenk wieder weggegeben haben sollten. Als Lehnsherren der Familie Stein treten sie jedenfalls nicht in Erscheinung, wohl aber ihre oftmaligen Konkurrenten, die Fürstbischöfe von Würzburg. Mit denen wäre aller- dings ein Tauschgeschäft möglich gewesen, wie verschiedentlich vermutet wurde. Auch ein Verkauf wäre denkbar, eine gesicherte Bezeugung liegt aber bis jetzt für keine der verschie- denen Möglichkeiten vor. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, alle Überlegungen nachzuvollziehen; wieder über- einstimmend meinen Günter Lipp und Dr. Berninger, dass 1178 ein gesichertes Datum für eine Ersterwähnung ist. -

Schlösserwelt Frühjahr/Sommer 2020
Frühjahr/Sommer 2020 Bis 30.8.2020 geöffnet. Editorial Wild.Wächst.Blüht. Farbenpracht, die Freude macht. Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde der Schlösser und Gärten, mit einer großen Vielfalt an Themen warten wir in dieser Ausgabe der „Schlösserwelt Thüringen“ auf. Sie spiegelt die Bandbreite des- sen, was Sie beim Besuch unserer Bau- und Gartendenkmale erleben können. Von der Steinrestaurierung bis zur Pflege von Schlossgärten in Zeiten des Klimawandels reicht auch das Spektrum unserer span- nenden täglichen Arbeit, bei der wir von vielen Seiten unterstützt werden. Besonders dankbar sind wir für das bürgerschaftliche Engagement, ohne das viele kleine und größere Projekte nicht möglich wären. Das in diesem Frühjahr fertiggestellte Schallhaus auf Schloss Hei- decksburg in Rudolstadt ist so ein Beispiel. Vom eigens gegründeten Förderverein ins Rollen gebracht und über zehn Jahre mit Spenden- mitteln vorangetrieben, konnte dank einer großzügigen Förderung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz binnen Kurzem die Sanierung zum Abschluss gebracht werden – ein großartiges Zusam- menwirken von lokaler Initiative und bundesweiter Aufmerksamkeit. Haben Sie viel Vergnügen beim Lesen und beim Besuch unserer Monumente und Veranstaltungen. Und vielleicht begegnen ja auch Sie der einen oder anderen Aufgabe, bei der Sie uns unterstützen möchten. Dr. Doris Fischer Direktorin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten www.egapark-erfurt.de Spendenaufruf Inhalt In diesem Heft Editorial 1 Ein berühmter Belgier zu Gast im Schwarzatal. Henry van de Velde, das letzte Fürstenpaar und ein Die ehemalige Klosterkirche St. Peter und Paul ist ein Juwel der mittel- Im Fokus Frühstücksservice für Prinzessin Mathilde 32 alterlichen Baukunst. Die Fassadenrestaurierung hat es zum Funkeln Himmel aus Gips. -

Friedrich-Wilhelm Von Oppeln-Bronikowski Ein Sympathieträger Heinrich Heines: Alexander Von Oppeln-Bronikowski
Friedrich-Wilhelm von Oppeln-Bronikowski Ein Sympathieträger Heinrich Heines: Alexander von Oppeln-Bronikowski Studia Germanica Gedanensia 23, 307-345 2010 studia germanica gedanensia gdańsk 2010, nr. 23 Friedrich-Wilhelm von Oppeln-Bronikowski Ein Sympathieträger heinrich heines: Alexander von Oppeln-Bronikowski* 0 . Einleitung Was rechtfertigt im Jahr 2010 die Beschäftigung mit einem Schriftsteller, der vor 175 Jahren verstarb und dessen Werke seither in Deutschland nicht mehr aufgelegt worden sind? Es ist kein geringerer als he i n r i c h he i n e , der uns einen hinweis gibt: In seinen „Reisebildern“, Zweyter Teil . Die Nordsee . Dritte Abteilung schreibt er 1826 u .a .: „Von allen großen Schriftstellern ist Byron just derjenige, dessen Lektüre mich am unleidlichsten berührt; wohin- gegen Scott mir, in jedem seiner Werke, das herz erfreut, beruhigt und erkräf- tigt . Mich erfreut sogar die Nachahmung derselben, wie wir sie bey W . Al e x i s , Br o n i k o w s k i und co o P e r finden . “1 Wer war dieser „Bronikowski“? 1 . Geburt und herkunft Al e x A n d e r Au g u s t fe r d i n A n d v o n opp e l n -Br o n i k o w s k i wurde am 28 . Fe- bruar 1784 als Sohn des damaligen hauptmanns bei der Leibgrenadiergarde (Generaladjutant des sächsischen Königs wurde er erst später) Jo h A n n Pe t e r v o n opp e l n -Br o n i k o w s k i und der Generalstochter ch r i s t i n A cA r o l i n e wi l - h e l m i n e , geb.