Ethik Und Moral Im Wiener Kreis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
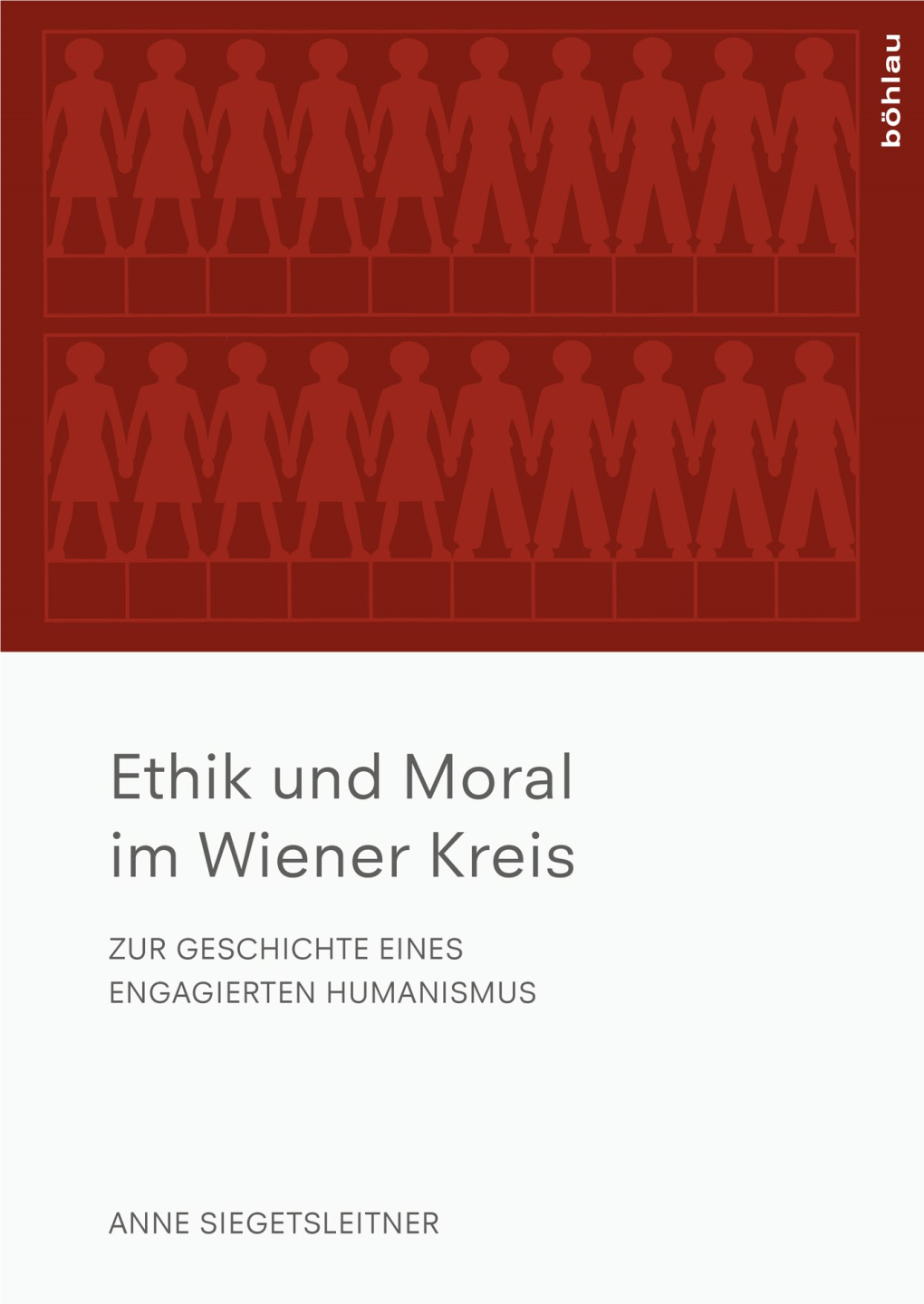
Load more
Recommended publications
-
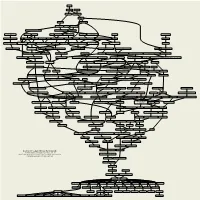
Academic Genealogy of George Em Karniadakis
Nilos Kabasilas Demetrios Kydones Elissaeus Judaeus Manuel Chrysoloras Georgios Plethon Gemistos 1380, 1393 Basilios Bessarion 1436 Mystras Guarino da Verona Johannes Argyropoulos 1408 1444 Università di Padova Vittorino da Feltre Cristoforo Landino Marsilio Ficino 1416 Università di Padova 1462 Università di Firenze Ognibene (Omnibonus Leonicenus) Bonisoli da Lonigo Theodoros Gazes Angelo Poliziano Università di Mantova 1433 Constantinople / Università di Mantova 1477 Università di Firenze Leo Outers Alessandro Sermoneta Gaetano da Thiene Moses Perez Scipione Fortiguerra Demetrios Chalcocondyles Jacob ben Jehiel Loans Rudolf Agricola Thomas à Kempis Heinrich von Langenstein 1485 Université Catholique de Louvain 1493 Università di Firenze 1452 Mystras / Accademia Romana 1478 Università degli Studi di Ferrara 1363, 1375 Université de Paris Maarten (Martinus Dorpius) van Dorp Pelope Pietro Roccabonella Nicoletto Vernia François Dubois Jean Tagault Girolamo (Hieronymus Aleander) Aleandro Janus Lascaris Matthaeus Adrianus Johann (Johannes Kapnion) Reuchlin Jan Standonck Alexander Hegius Johannes von Gmunden 1504, 1515 Université Catholique de Louvain Università di Padova Università di Padova 1516 Université de Paris 1499, 1508 Università di Padova 1472 Università di Padova 1477, 1481 Universität Basel / Université de Poitiers 1474, 1490 Collège Sainte-Barbe / Collège de Montaigu 1474 1406 Universität Wien Niccolò Leoniceno Jacobus (Jacques Masson) Latomus Desiderius Erasmus Petrus (Pieter de Corte) Curtius Pietro Pomponazzi Jacobus (Jacques -

Philosophy of Modeling in the 1870S: a Tribute to Hans Vaihinger
Baltic J. Modern Computing, Vol. 9 (2021), No. 1, pp. 67–110 https://doi.org/10.22364/bjmc.2021.9.1.05 Philosophy of Modeling in the 1870s: A Tribute to Hans Vaihinger Karlis Podnieks Faculty of Computing, University of Latvia 19 Raina Blvd., Riga, LV-1586, Latvia [email protected] Abstract. This paper contains a detailed exposition and analysis of The Philosophy of “As If“ proposed by Hans Vaihinger in his book published in 1911. However, the principal chapters of the book (Part I) reproduce Vaihinger’s Habilitationsschrift, which was written during the autumn and winter of 1876. Part I is extended by Part II based on texts written during 1877–1878, when Vaihinger began preparing the book. The project was interrupted, resuming only in the 1900s. My conclusion is based exclusively on the texts written in 1876-1878: Vaihinger was, decades ahead of the time, a philosopher of modeling in the modern sense – a brilliant achievement for the 1870s! And, in the demystification of such principal aspects of cognition as truth, understanding and causality, is he not still ahead of many of us? According to Vaihinger, what we set beyond sensations is our invention (fiction), the correspondence of which with reality cannot (and need not) be verified in the mystical, absolute sense many people expect. Keywords: fictionalism, fiction, hypothesis, dogma, sensations, reality, truth, understanding, modeling 1 Introduction “Aller Dogmatismus ist hier verschwunden,“ according to Simon et al. (2013). I suspect that by saying this regarding his book, Hans Vaihinger meant, in fact, that if people would adopt his Philosophie des Als Ob, most of traditional philosophy would become obsolete. -

Om Positivisme Og Objektivisme I Samfunds Videnskaberne1
Nikolaj Nottelmann Om positivisme og objektivisme i samfunds- videnskaberne1 »Positivisme« hører til de mest kontroversielle og mangetydige termer i moderne debatter om samfundsvidenskabelig metode. Bredt anvendte læ- rebøger er på én gang ofte uklare og voldsomt indbyrdes uenige angående positivismens metafysiske, erkendelsmæssige og ideologiske forpligtelser. Denne artikel leverer en receptionshistorisk behandling af positivismen fra dens dobbelte udspring i det 19. århundredes franske og tyske filosofi frem til i dag. Hermed kortlægges en række væsentlige historiske omforståelser og misforståelser som baggrund for nutidens begrebsforvirring. Det påvises efterfølgende, at forskellige positivistiske retningers forhold til videnskabe- lig objektivisme er en temmelig kompleks og varieret affære. Det er således ufrugtbart at behandle samfundsvidenskabelig positivisme og objektivisme under ét, sådan som det ofte gøres. Positivisme; Objektivisme; Fænomenalisme; Logisk Empirisme; Kritisk Teori DANSK SOCIOLOGI • Nr. 3/28. årg. 2017 9 Indledning Meget taler for, at samfundsvidenskaberne længe har befundet sig i en post- positivistisk epoke; en tid, hvor hverken disse discipliners dominerende me- toder eller toneangivende metodelære længere falder ind under »positivis- men« (jeg vil i denne artikel sætte »positivisme« i anførselstegn, hver gang termen bruges bredt og uforpligtende som her. En mere præcis terminologi indføres nedenfor). Der er således i dag meget langt mellem aktive sociologer, som åbent bekender sig til en form for »positivisme«.2 -

Les Origines De La Philosophie Du Comme Si the Origins of the As If Philosophy
Philosophia Scientiæ Travaux d'histoire et de philosophie des sciences 20-1 | 2016 Le kantisme hors des écoles kantiennes Les origines de la philosophie du comme si The Origins of the As If Philosophy Hans Vaihinger Traducteur : Christophe Bouriau Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/philosophiascientiae/1157 DOI : 10.4000/philosophiascientiae.1157 ISSN : 1775-4283 Éditeur Éditions Kimé Édition imprimée Date de publication : 25 février 2016 Pagination : 95-118 ISBN : 978-2-84174-750-4 ISSN : 1281-2463 Référence électronique Hans Vaihinger, « Les origines de la philosophie du comme si », Philosophia Scientiæ [En ligne], 20-1 | 2016, mis en ligne le 25 février 2019, consulté le 30 mars 2021. URL : http://journals.openedition.org/ philosophiascientiae/1157 ; DOI : https://doi.org/10.4000/philosophiascientiae.1157 Tous droits réservés Les origines de la philosophie du comme si∗ Hans Vaihinger (1852-1933) Traduction de Christophe Bouriau, Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S), Metz – Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie, Archives H.-Poincaré, Université de Lorraine, CNRS, Nancy (France) Résumé : Nous traduisons l’article de Vaihinger « Wie die Philosophie des Als Ob entstand », paru dans Die deutsche Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Raymund Schmidt (éd.), Leipzig, Felix Meiner Verlag, 1921, tome 2, pp. 1–29. Cet article autobiographique retrace le parcours in- tellectuel de Hans Vaihinger dont la « philosophie du comme si », qui prend sa source majeure dans la pensée de Kant, connaît aujourd’hui une grande vitalité sous la figure du fictionalisme. Abstract: Today Vaihinger’s philosophy of “as if” enjoys wide interest as part of the renaissance of fictionalism. -

Franz Brentano and Austrian Philosophy, Vienna Circle Institute Yearbook 24, 252 D
Denis Fisette • Guillaume Fréchette 72 Friedrich Stadler 73 Editors 74 Franz Brentano and Austrian 75 Philosophy 76 Chapter 12 1 Brentano and J. Stuart Mill 2 on Phenomenalism and Mental Monism 3 Denis Fisette 4 Abstract This study is about Brentano’s criticism of a version of phenomenalism 5 that he calls “mental monism” and which he attributes to positivist philosophers 6 such as Ernst Mach and John Stuart Mill. I am interested in Brentano’s criticism of 7 Mill’s version of mental monism based on the idea of “permanent possibilities of 8 sensation.” Brentano claims that this form of monism is characterized by the identi- 9 fication of the class of physical phenomena with that of mental phenomena, and it 10 commits itself to a form of idealism. Brentano argues instead for a form of indirect 11 or hypothetical realism based on intentional correlations. 12 Keywords Brentano · Stuart Mill · Mach · Positivism · Phenomenalism · 13 Permanent possibilities of sensation 14 This study is about Brentano’s relationship with positivism. This topic has been 15 investigated in connection with Comte’s and Mach’s versions of positivism, and it 16 has been argued that the young Brentano was significantly influenced by several 17 aspects of Comte’s positive philosophy without ever committing himself to its anti- 18 metaphysical assumptions.1 But several other aspects of Brentano’s relationship 19 with positivism have not been thoroughly investigated; namely, Brentano’s 20 1 See Münch, D. (1989), „Brentano and Comte“, in: Grazer Philosophische Studien, vol. 35, phi- losophiques de Strasbourg, vol. 35, pp. -

Mitteilungen Aus Dem Brenner-Archiv Nr. 27/2008 Gedruckt Mit Unterstützung Des Amtes Der Tiroler Landesregierung (Kulturabteilung) Und Der Stadt Innsbruck (Kulturamt)
Mitteilungen aus dem Brenner-Archiv Nr. 27/2008 Gedruckt mit Unterstützung des Amtes der Tiroler Landesregierung (Kulturabteilung) und der Stadt Innsbruck (Kulturamt) ISSN 1027-5649 Eigentümer: Brenner-Forum und Forschungsinstitut Brenner-Archiv Innsbruck 2008 Bestellungen sind zu richten an: Forschungsinstitut Brenner-Archiv Universität Innsbruck (Tel. +43512 507-4511) A-6020 Innsbruck, Josef-Hirn-Str. 5 http://brenner-archiv.uibk.ac.at/ Druck: Steigerdruck, 6094 Axams, Lindenweg 37 Herausgeber: Johann Holzner und Eberhard Sauermann Satz: Barbara Halder und Christoph Wild Layout und Design: Christoph Wild Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Herausgeber gestattet © 2008 Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung Alle Rechte vorbehalten. http://www.uibk.ac.at/iup/ Inhalt Editorial 5 Texte Alois Hotschnig: Besorgungen für den Tag 7 Joseph Zoderer: Aus dem Notizblock 1964 11 Reden Anna Rottensteiner: Laudatio anlässlich der Verleihung des Tiroler Landespreises für Kunst an Alois Hotschnig 13 Johann Holzner: Laudatio anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Universität Innsbruck an Joseph Zoderer 17 Christian Haller: Ich möcht ein solcher werden wie einmal ein andrer gewesen ist. Vom Wandel des Menschenbildes und der theatralischen Figur 19 Klaus Müller-Salget: Against Resignation Abschiedsvorlesung an der Universität Innsbruck 25 Aufsätze Eberhard Sauermann: Anthologien der NS-Zeit mit Gedichten Trakls 37 Árpád Bernáth: Fortschreibung und Kommentierungsbedarf Über die „Kölner Ausgabe“ der Werke Heinrich Bölls 51 Dossier: Christine Lavant und Russland 71 Wolfgang Wiesmüller: Facetten der österreichischen Lyrik nach 1945 Am Beispiel biblisch-christlicher Intertextualität bei Christine Lavant und Christine Busta 75 Nina Pavlova: Christine Lavant und das Gesetz ihrer Dichtung 93 Natalia Bakshi: Der Einfl uss der russischen Literatur auf Christine Lavants „Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus“ 101 Dirk Kemper: Überblendungstechnik und literarische Moderne Zu Christine Lavants „Das Kind“ 111 Ursula A. -

Reformation and Scholasticism in Philosophy
THE COLLECTED WORKS OF HERMAN DOOYEWEERD Series A, Volume 5 GENERAL EDITOR: D.F.M. Strauss Reformation and Scholasticism in Philosophy VOLUME I THE GREEK PRELUDE Herman Dooyeweerd Paideia Press 2012 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Dooyeweerd, H.(Herman), 1884-1977. Reformation and Scholasticism in Philosophy Herman Dooyeweerd. p. cm. Includes bibliographical references and index ISBN 978-0-88815-215-2 [CWHD A5] (soft) This is Series A, Volume 5 in the continuing series The Collected Works of Herman Dooyeweerd (Initially published by Mellen Press, now published by Paideia Press) ISBN 978-0-88815-215-2 The Collected Works comprise a Series A, a Series B, and a Series C (Series A contains multi-volume works by Dooyeweerd, Series B contains smaller works and collections of essays, Series C contains reflections on Dooyeweerd's philosophy designated as: Dooyeweerd’s Living Legacy, and Series D contains thematic selections from Series A and B) A CIP catalog record for this book is available from the British Library. The Dooyeweerd Centre for Christian Philosophy Redeemer University College Ancaster, Ontario CANADA L9K 1J4 All rights reserved. For information contact: ÓPAIDEIA PRESS 2012 Grand Rapids, MI 49507 Printed in the United States of America Reformation and Scholasticism in Philosophy by Herman Dooyeweerd Volume I THE GREEK PRELUDE Translated by Ray Togtmann Initial Editor the Late Robert D. Knudsen Final Editor Daniël Strauss Editing of All Greek Quotations by Al Wolters This is Volume I of a three-volume work. Volume I first appeared in 1949 under the title: Reformatie en Scholastiek in de Wijsbegeerte (T. -

130 New Books. It, When Standing As Copula, Gives No Indication Which Kind of Condition Is Intended by the Proposition
130 New Books. it, when standing as copula, gives no indication which kind of condition is intended by the proposition. And therefore I was careful to interpret the it in the 'cogito' by the word meant, having shown the ' cogito to express only what existence was, and not how it arose nor how it was inferred. Mr. Main, in recurring to the unanalysed use of it, really unsays Descartes' proposition. BHADWOETH H. HODGBOK.] XTL—NEW BOOKS. Downloaded from History of English Thought in the Eighteenth Century. By LESLIE STHPHBN. 2 vola London i Smith, Elder & Co. Pp. 466, 469. This very important work will be reviewed at length in a future number. It is first of all, as the preface tells, a history of the Deistical movement; but for this it " seemed necessary to describe the general theological tendencies of the time, and, in order to set http://mind.oxfordjournals.org/ forth intelligibly the ideas which shaped those tendencies, it seemed desirable, again, to trace their origin in the philosophy of the time and to show their application in other departments of speculation ". The author therefore begins with an account of the contemporary Philosophy, and seeks besides " to indicate the application of the principles accepted in philosophy and theology to moral and political questions, and their reflection on the imaginative literature of the time"; though in dealing with political theories he tries to keep as far as possible from the province of political or social history. at University of Michigan on July 9, 2015 A Treatise on the Moral Ideals. -

Critical Metaphysics in the Views of Otto Liebmann and Johannes Volkelt
Folia Philosophica 34 ISSN 2353-9445 (online) ISSN 1231-0913 (print) Tomasz Kubalica Critical Metaphysics in the Views of Otto Liebmann and Johannes Volkelt Abstract: The article addresses the problem of critical metaphysics in the views of Otto Liebmann and Johannes Volkelt. Their view of metaphysics results from a com- promise between science and philosophy. On the one hand, this compromise keeps metaphysics closely in touch with contemporary scientific theory, which means it can participate in the modern civilisation of science and technology, on the other though, it leads to the narrowing down of the universalist philosophical perspective to sci- ence, which means abandonment of non-scientific aspects of life. Although in principle open to metaphysical needs of humans, critical metaphysics, on this view, embodies scientific aspirations of the turn of the 19th and 20th centuries. Metaphysical criti- cism entails self-imposed limits on metaphysical aspirations, but these limitations themselves must stay within reasonable limits; otherwise, it transforms into destruc- tive scepticism. Keywords: critical metaphysics, universalist view of philosophy, contemporary scien- tific theory, philosophical criticism, scepticism The contemporary notion of philosophy understood as critical thought, though of ancient origin, was shaped above all by Neo-Kantian philos- ophy and Kant’s Critique of Pure Reason.1 In this context, the opposi- tion between metaphysics and cognition becomes especially significant, where cognition is usually interpreted in the spirit of positivism and sci- entism in the form of antagonism between dogmatic metaphysical think- ing and a critical approach, which supposedly excludes the possibility of metaphysics. In this context, we must pose the question of whether 1 Cf. -
![Les Cahiers Philosophiques De Strasbourg, 35 | 2014, « La Réception Germanique D'auguste Comte » [En Ligne], Mis En Ligne Le 22 Janvier 2019, Consulté Le 08 Mars 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/0230/les-cahiers-philosophiques-de-strasbourg-35-2014-%C2%AB-la-r%C3%A9ception-germanique-dauguste-comte-%C2%BB-en-ligne-mis-en-ligne-le-22-janvier-2019-consult%C3%A9-le-08-mars-2020-7420230.webp)
Les Cahiers Philosophiques De Strasbourg, 35 | 2014, « La Réception Germanique D'auguste Comte » [En Ligne], Mis En Ligne Le 22 Janvier 2019, Consulté Le 08 Mars 2020
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg 35 | 2014 La réception germanique d'Auguste Comte Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/cps/1007 DOI : 10.4000/cps.1007 ISSN : 2648-6334 Éditeur Presses universitaires de Strasbourg Édition imprimée Date de publication : 14 juin 2014 ISBN : 978-2-86820-574-2 ISSN : 1254-5740 Référence électronique Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 35 | 2014, « La réception germanique d'Auguste Comte » [En ligne], mis en ligne le 22 janvier 2019, consulté le 08 mars 2020. URL : http://journals.openedition.org/ cps/1007 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cps.1007 Ce document a été généré automatiquement le 8 mars 2020. Cahiers philosophiques de Strasbourg 1 SOMMAIRE De Paris à Vienne. Quelques jalons Laurent Fedi La représentation de l’élément germanique dans la philosophie d’Auguste Comte Laurent Fedi Franz Brentano et le positivisme d’Auguste Comte Denis Fisette La mathématique fait-elle exception à la loi historique des trois états ? Sur la réception brentanienne de la philosophie d’Auguste Comte Vincent Gérard La sociologie avec ou sans guillemets L’ombre portée de Comte sur les sciences sociales germanophones (1875-1908) Wolf Feuerhahn L’influence d’Auguste Comte sur les conceptions philosophiques de Wilhelm Ostwald Jan-Peter Domschke Das verrückte Integral. Auguste Comte und das biozentrische Weltbild Raoul Francés Dr. Erna Aescht Auguste Comte et la philosophie positive (Brentano) Présentation Denis Fisette et Hamid Taieb Auguste Comte et la philosophie positive Franz Brentano La méthodologie des sciences sociales selon Comte (Waenting) Présentation Wolf Feuerhahn La méthodologie des sciences sociales selon Comte Heinrich Waentig Le problème de Jésus (Raoul Francé) Présentation Laurent Fedi et Pierre Francé Le problème de Jésus Raoul Francé L’émergence du christianisme Raoul Francé Le pacifisme. -

Peter Uwe Hohendahl
Building a National Literature PETER UWE HOHENDAHL Building a National Literature The Case of Germany, I830-I870 TRANSLATED BY RENATE BARON FRANCISCONO Cornell University Press ITHACA AND LONDON Copyright © 1989 by Cornell University A slightly different version of this book was originally published in German as Peter Uwe Hohendahl, Literarische Kultur im Zeitalter des Liberalismus, 1830–1870 (Munich: C. H. Beck, 1985), copyright © Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1985. The publisher gratefully acknowledges the assistance of Inter Nationes in defraying part of the cost of translation. All rights reserved. Except for brief quotations in a review, this book, or parts thereof, must not be reproduced in any form without permission in writing from the publisher. For information, address Cornell University Press, Sage House, 512 East State Street, Ithaca, New York 14850, or visit our website at www.cornellpress.cornell.edu. First published 1989 by Cornell University Press. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Hohendahl, Peter Uwe. [Literarische Kultur im Zeitalter des Liberalismus 1830–1870. English] Building a national literature, the case of Germany 1830–1870 / Peter Uwe Hohendahl ; translated by Renate Baron Franciscono. p. cm. Translation of: Literarische Kultur im Zeitalter des Liberalismus 1830–1870. Includes index. ISBN 978-0-8014-1862-4 (cloth : alk. paper) ISBN 978-0-8014-9622-6 (pbk. : alk. paper) 1. German literature—19th century—History and criticism. 2. Literature and society—Germany—History—19th century. 3. Criticism—Germany—History—19th century. 4. Books and reading—Germany—History—19th century. 5. Liberalism— Germany—History—19th century. I. Title. PT391.H5813 1989 830'.9'007—dc19 89-899 The text of this book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Contents Preface vii I. -

302 NOTES and CORRESPONDENCE. Is Not Just Now Prepared to Deny That the Wicked Mind In'a Certain Tente Does What It Pleases
302 NOTES AND CORRESPONDENCE. is not just now prepared to deny that the wicked mind in'a certain tente does what it pleases. I am therefore, on the other hand, most heartily with Prof. Sidgwick in thinking that the choice of lives in the myth of Er gives no true indication of Plato's ideas of moral freedom, and in general I subscribe to his view that the myths should not be drawn into evidence on philosophical questions. It is also true, as he says, that even according to the myth the choice does not escape from necessity, being predetermined by previous con- duct. The contrast between the account of this choice in the myth, and the passage concerning freedom and slavei-y, Republic 577, has always seeined to me a leading instance of the gulf between the semi-sensuous imagination and the philosophic intelligence. In Plato's true ethics the Downloaded from opposite to freedom is ioiXtta not drayta]. BERNARD BOSANQOET. THE ARISTOTELIAN SOCIETY FOR THE SYSTEMATIC STUDY OP PHILO- SOPHY.—At the meeting of December 14, the President brought before the Society Professor Siebeck'e De doctrina Idearum qualis est in Platonis http://mind.oxfordjournals.org/ Phileba, bringing it into connexion with the questions which arose, at the previous meeting, out of Mr. Kitchie's paper on the Phcedo. At the first meeting in the new year, Jan. 11, the examination of Kant's Oritick of Practical Reason was resumed by Mr. H. W. Carr (V.P.), in a paper on the " Analytic," cc 1, 2. On Jan.