SWA/Namibia Vor Der Unabhängigkeit?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
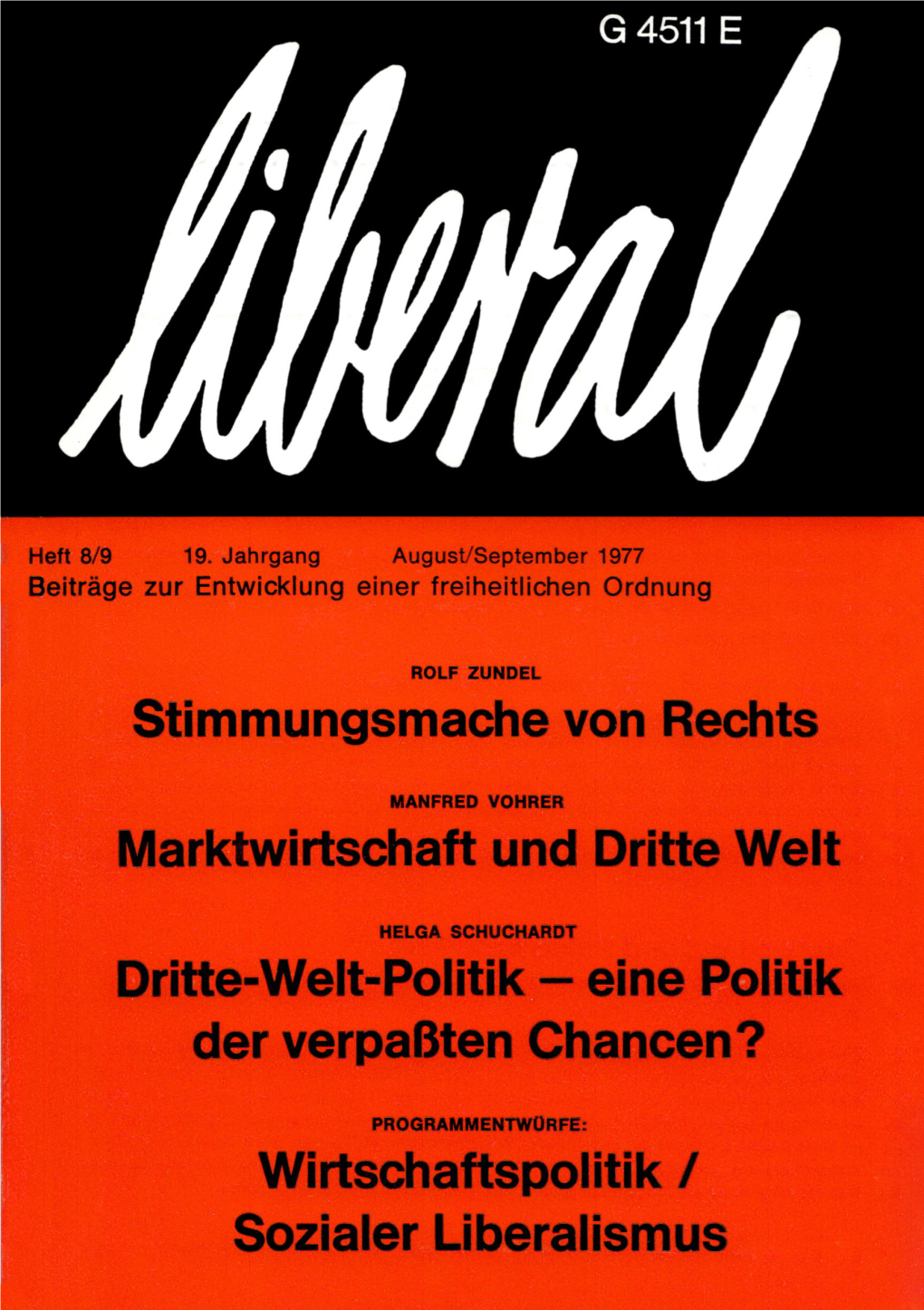
Load more
Recommended publications
-

4 October 1985
other prices on page 2 MPC plans UK foreign office BY GWEN LISTER PLANS HAVE REACHED an advanced stage to open an office with an undisclosed status in London to promote the interim government abroad. The Head of the Department of Interstate Relations, Mr Carl von Bach, and the new co· ordinator of the London venture, Mr Sean Cleary, have ar· rived in london to prepare for the new operation. The interim government's Minister of Justice and Information, Mr Fanuel Kozonguizi, has confirmed that the London office will be elevat ed to a new status, but the interim Cabinet must still take a final de cision on the modalities of the new campaign. It was not yet cl ear whether Mr Cleary will be permanently stationed in London. 'It is up to him' Mr Kozo nguizi said. He added that the 'extern~ l poli cy' o f the interim admini stration till had to be established. At this stage they would no~be.~eeking 'inter.na tional recognition', Mr Kozonguizi said. A fo rmer So uth African diplo mat, Mr Sean Cleary took over from Mr Billy Marais as Public Relations Consultant fo r the interim govern POLICE WATCH burning barricades in Athlone, Cape Town, the scene of continuing vio ment on October 1. In that position this week. he will be controlling public relations See inside today for the story of dramatic protests at the University of the Western Cape. MR SEAN CLEA RY - interim (Photograph by Dave Hartman of Afrapix). government's 'rovi ng ambassador'. Continued on page 3 Ministers may boycott Council BIG SPRING BY GWEN LISTER net, the participation of two vote in a Cabinet meeting ofSep COMPETITION groups in the Constitutional tember 11. -

South West Africa/Namibia Issues Related to Political Independence
SOUTH WEST AFRICA/NAMIBIA ISSUES RELATED TO POLITICAL INDEPENDENCE PETER CHARLES BENNETT University of Cape Town A Dissertation Submitted To The Faculty of Social Science University of Cape Town. Rondebosch, For The Degree of Master of Arts October 1983 The University of Ctlpe Town has been given the right to rcprodooe this thesis In wholo or In port. Copyright Is held by the wthor. The copyright of this thesis vests in the author. No quotation from it or information derived from it is to be published without full acknowledgement of the source. The thesis is to be used for private study or non- commercial research purposes only. Published by the University of Cape Town (UCT) in terms of the non-exclusive license granted to UCT by the author. University of Cape Town i SOUTH WEST AFRICA/NAMIBIA ISSUES RELATED TO POLITICAL INDEPENDENCE This dissertation constitutes a study of all issues rele- vant to South West Africa/Namibian independence, from 1915 to June 1983. The method employed is primarily of a descrip- tive, histcirical and analytical nature, which brings together in a concise study a variety of primary research materials, particularly with extensive use of newspaper resources. Due to the limited available material on South West Africa/ Namibia, it was necessary to rely upon these journalistic sources to a large extent. It was, therefore, necessary to assume that: • 1. newspaper references are correct and valid, and that articles by relevant authorities and political figures are a true expression of the writers' political beliefs; 2. that in terms of books, journals and other published materials in relation to South West Africa/Namibia, the facts have been accurately researched and verified, and 3. -

Hans Beukes, Long Road to Liberation. an Exiled Namibian
Journal of Namibian Studies, 23 (2018): 101 – 123 ISSN: 2197-5523 (online) Thinking and writing liberation politics – a review article of: Hans Beukes, Long Road to Liberation . An Exiled Namibian Activist’s Perspective André du Pisani* Abstract Thinking and Writing Liberation Politics is a review article of: Hans Beukes, Long Road to Liberation. An Exiled Namibian Activist’s Perspective; with an introduction by Professor Mburumba Kerina, Johannesburg, Porcupine Press, 2014. 376 pages, appendices, photographs, index of names. ISBN: 978-1-920609-71-9. The article argues that Long Road to Liberation , being a rich, diverse, uneven memoir of an exiled Namibian activist, offers a sobering and critical account of the limits of liberation politics, of the legacies of a protracted struggle to bring Namibia to independence and of the imprint the struggle left on the political terrain of the independent state. But, it remains the perspective of an individual activist, who on account of his personal experiences and long absence from the country of his birth, at times, paints a fairly superficial picture of many internal events in the country. The protracted diplomatic-, political- and liberation struggle that culminated in the independence of Namibia in March 1990, has attracted a crop of publications written from different perspectives. This has produced many competing narratives. It would be fair to say that many of the books published over the last decade or so, differ in their range, quality and usefulness to researchers and the reading public at large. This observation also holds for memoirs, a genre of writing that is most demanding, for it requires brutal honesty, the ability to truthfully recall and engage with events that can traverse several decades. -

Transitions in Namibia Which Changes for Whom?
Transitions in Namibia Which Changes for Whom? Edited by Henning Melber NORDISKA AFRIKAINSTITUTET, UPPSALA 2007 Cover: The restored steam tractor outside the coastal town of Swakop- mund was made in Germany and brought to the country in 1896. It should replace ox wagons as a means of transport in the further colonization of Namibia’s interior. The 2.8 tons heavy machine in need of lots of water never managed it through the sands of the Namib desert. The local colonizers named it after the German reformer Martin Luther, who in 1521 had declared: “Here I stand – may God help me. I can not otherwise.” Today a national monument and put behind glass, Namibia’s “Martin Luther” remains an early symbol for the failure of grand visions. Indexing terms: Social change Economic change Cultural change Political development Liberation Decentralization Gender relations International relations Economic and social development Post-independence Namibia Cover photos: Henning Melber Language checking: Peter Colenbrander © The authors and Nordiska Afrikainstitutet 2007 ISBN 978-91-7106-582-7 Printed in Sweden by Elanders Gotab AB, Stockholm 2007 Table of Contents Preface ……………………………………………………………………………………………… 5 Henning Melber Transitions in Namibia – Namibia in transition An introductory overview ………………………………………………………… 7 Christopher Saunders History and the armed struggle From anti-colonial propaganda to ‘patriotic history’? ……… 13 Phanuel Kaapama Commercial land reforms in postcolonial Namibia What happened to liberation struggle rhetoric? ………………… 29 Herbert -

REGISTRATUR AA. 3 (Enlarged and Revised Edition)
REGISTRATUR AA. 3 (Enlarged and Revised Edition) 2 REGISTRATUR AA. 3 (Enlarged and Revised Edition) GUIDE TO THE SWAPO COLLECTION IN THE BASLER AFRIKA BIBLIOGRAPHIEN Compiled by Giorgio Miescher Published by Basler Afrika Bibliographien Namibia Resource Centre & Southern Africa Library 2006 3 © 2006 Basler Afrika Bibliographien Publisher: Basler Afrika Bibliographien P.O.Box 2037 CH 4001 Basel Switzerland http://www.baslerafrika.ch All rights reserved Printed by Typoprint (Pty) Ltd, Windhoek, Republic of Namibia ISBN 3-905141-89-2 4 List of Contents I The General Archives of the Basler Afrika Bibliographien 7 II Introduction to the enlarged and revised edition 9 Changing archiving pattern since 1994 10 Collections of SWAPO material scattered around the world 12 The BAB SWAPO collection and its institutional context 14 Researching the history of SWAPO (and the liberation struggle) 16 Sources to write the history of SWAPO and the liberation struggle 20 III How to work with this Archival Guide 22 Structure of organisation 22 Classification system of the SWAPO collection 22 List of abbreviations 24 IV Inventory AA. 3 25 before 1966 from SWAPO 27 1966 about SWAPO 28 1968 from SWAPO 29 1969 from/about SWAPO 30 1970 from/about SWAPO 32 1971 from/about SWAPO 34 1972 from/about SWAPO 37 1973 from/about SWAPO 42 1974 from/about SWAPO 45 1975 from/about SWAPO 50 1976 from/about SWAPO 56 1977 from/about SWAPO 64 1978 from/about SWAPO 72 1979 from/about SWAPO 82 1980 from/about SWAPO 88 1981 from/about SWAPO 100 1982 from/about SWAPO 113 1983 from/about -

1965-1988 Prof Peter Hitjitevi Katjavivi: 1941
Katjavivi, PH PA 1 THE KATJAVIVI COLLECTION: 1965-1988 PROF PETER HITJITEVI KATJAVIVI: 1941 - Historical Background Professor Peter Katjavivi was born on 12 May 1941 in Okahandja, Namibia. He travelled into exile in 1966 and was part of the Dar es Salaam exiles that helped transform SWAPO into an international force in the struggle for the liberation of Namibia. Until 1979 he was a fulltime SWAPO activist running the London office and holding the movement’s Information and Publicity post. From the 1980s, he pursued his academic career which saw him gaining a Master’s degree in 1980 from the University of Warwick, UK and a Doctor of Philosophy in1986 from St Anthony’s College, University of Oxford. In 1989, he was elected to the Constituent Assembly and served as National Assembly member until 1991. In 1992 he was named the first Vice-Chancellor of the University of Namibia, a post he held for eleven years. He was appointed as Professor in History by the UNAM Academic Council Staff Appointments Committee in 1994. He was given a diplomatic posting in 2003. Peter Katjavivi has also been very active as SWAPO’s documenter of the liberation struggle. His book, ‘A History of Resistance in Namibia’ (James Currey, 1988) is still widely referred to in academic works on recent Namibian history. Currently, he is the Director-General of the National Planning Commission. THE COLLECTION Summary The collection, covering the period 1965 to 1988 (but also holding some documents from as far back as 1915) consists mainly of SWAPO documents on activities in and outside Namibia during the time for the struggle for the liberation of Namibia (See summary of classes below). -

Ceasefire Agreement Between South Africa and Angola-‐Rejection By
Keesing's Record of World Events (formerly Keesing's Contemporary Archives), Volume 34, September, 1988 Namibia, Page 36132 © 1931-2006 Keesing's Worldwide, LLC - All Rights Reserved. Ceasefire agreement between South Africa and Angola-Rejection by South Africa of draft constitution-Increase in powers of Administrator-General Developments in guerrilla war to mid-1988-Other internal developments-UN activities Signature of ceasefire agreement between Angola and South Africa (Aug. 22, 1988). Submission of draft constitution by constitutional council (July 6, 1987). Talks with South African government (June 19, 1987). Announcement of increase in powers of Administrator-General (April 8, 1988). Arrest of SWAPO leaders and supporters (Aug. 18, 26, 1987). Intervention by President Botha in trial of soldiers accused of murder (March 22, 1988). Deaths in bank explosion at Oshakati (Feb. 19, 1988). Schools boycott (March-June 1988). Strike by mineworkers (July-August 1987). UN security Council resolution (Oct. 30, 1987). Progress appeared to be made on reaching a political solution to the conflict in southern Angola and Namibia after the fourth in a series of negotiating sessions, held in Geneva in early August 1988, involving representatives of the Angolan, South African, Cuban and United States governments 80 for earlier meetings [see pages 36079-80 for earlier meetings]. The Angolan and South African governments on Aug. 22, 1988, signed formally at Ruacana, near the Angola-Namibia border, an agreement announced jointly by Angola, Cuba and South Africa two weeks earlier, covering southern Angola, where since late 1987 fighting had intensified into a major confrontation between on the one hand Angolan armed forces backed by Cuban troops, and on the other the South African Defence Forces (SADF), fighting in support of the Angolan rebel organization Uniao Nacional para Independencia Total de Angola UNITA [see page 35750; 35174 A; 36076 A; for reports of UNITA activity December 1985-April 1988]. -

Crp 2 B 2 0 0
Dei earen6 onein Dei earen6 onein Northwestern University Library Evanston, Illinois 60208-2300 ii11L The Devils \I Haremm The War for Namibia Zed Books Ltd London and New lersey The Devils are Among Us - The War for Namibia was first published by Zed Books Ltd, 57 Caledonian Road. London NI 9BU. UK and 171 First Avenue, Atlantic Highlands. New Jersey 07716, USA. in 1989. Copyright © Namibia Communications Centre. 1989. Cover designed by Andrew Corbett, Photographs John Liebenberg and John Evenson/NCCT. Typeset by EMS Photosetters, Rochford, Essex. Printed and bound in the United Kingdom at Bookcraft (Bath) Ltd, Midsomer Norton. All rights reserved. British Library Cataloguing in Publication Data Herbstein. Denis. The devils are among us: the war for Namibia. 1. Namibia. 1. Title. TI. Evenson. John. 968.8'03. ISBN 0-86232-896-9 ISBN 0-86232-897-7 pbk Contents Acknowledgements v Preface vi Maps x 1. 'Give us back a dwelling place' - Namibia 1945-80 1 Political Organization 3 SWANU 6 SWAPO is Born 8 Exile 11 Armed Struggle 14 The Pretoria Trial 16 Courts, Churches, Unions and Chiefs 19 The Coup in Portugal 23 War in Angola 26 The Gang of Five 29 2. Partners in Liberation: SWAPO and the Churches 34 Divide and Rule 37 The Guerrillas 40 Total Onslaught 45 The Rough and the Smooth 47 The Churches 50 Exilitis 58 3. The Crowbar 61 'Sterk' Hans Dreyer 64 Namibianization of the War 69 Extermination 73 The Law 79 Information Gathering 82 Jonas Paulus 87 Death in Kavango 89 What Did Koevoet Achieve? 93 4. -

South West Africa People's Organization (SWAPO)
UN Secretariat Item Scan - Barcode - Record Title Page 141 Date 06/06/2006 Time 11:29:27 AM S-0902-0007-02-00001 Expanded Number S-0902-0007-02-00001 Items-in-Africa - Question of Namibia - organizations and individuals - South West Africa People's Organization (SWAPO) Date Created 29/07/1978 Record Type Archival Item Container s-*>902-0007: Peacekeeping - Africa 1963-1981 Print Name of Person Submit Image Signature of Person Submit RECEIVED South West Africa People's Organ! ition NOV - 81879 Solidarity — Freedom — Justice SWAPO OBSERVER MISSION to the United Nations 801 Second Avenue Room 1401 New York, N.Y. 10017 Telex - 237249 Telephone: (212) 986-7863/7864 November 8, 1979. Dr. Kurt Waldheim Secretary General Room 3800 United Nations New York, N.Y. 10017 Your Excellency, President of SWAPO Mr. Sam Nujoma wishes me to acknowledge with thanks receipt of your letter dated 5 November 1979, regarding a proposed meeting in Geneva on Namibia and further directs me to express SWAPO's acceptance of your kind invitation. SWAPO delegation will be composed of eight members led by Mr, Sam Nujoma himself. Please accept, Your Excellency, the renewed assurances of my highest consideration. Sincerely, Pheo-Ben Gurirab Permanent Observer Note of Meeting between the Secretary-General and SWAPO held on 23 March 1979 Present : The Secretary -General Mr . Farah Mr. Ahtisaari Mr . Jonah Mr . Omayad Mr. Muganda Mr. Thorn"berry Mr. Muyongo Mr . Gurirab Mr. Harautenya Mr. Tjirimuje The Secretary-General velcomed the SWAPO delegation at 1515 hours and said that he had now been informed of the progress of the proximity talks. -

History November 2007 10
1 SECTION A Answer all the questions in Section A. For each question there are four possible answers, A, B, C and D. Choose the one you consider correct and mark your choice in soft pencil on the separate answer sheet provided. If you want to change an answer, erase the one you wish to change completely. NAMIBIAN HISTORY 1. Which SWAPO leader served a sentence of 27 years in prison on Robben Island? A Peter Kalangula B Hosea Kutako C Andimba Toivo yaToivo D Sam Nuyoma (1) 2. Who was the first leader of CANU? A Mishake Muyongo B Bredan Simbwaye C Andreas Shipanga D Fanuel Kozonguizi (1) 3. Which day is commemorated in Namibia as International Human Rights Day? A 4 May B 26 August C 21 March D 10 December (1) 4. What does the word apartheid mean? A Separateness B Unity C Responsibility D Struggle (1) 5. When was Resolution 435 adopted? A 1 April 1989 B 21 March 1990 C 23 October 1988 D 29 September 1978 (1) 6. Who was the SA prime minister who wanted to make Namibia a fifth province of SA in 1948? A L. Botha B J.C. Smuts C D.F. Malan D B.J. Voster (1) JSC 2007, History [Turn over 2 7. Which Anglican priest helped Namibians to prepare a petition to the United Nations Organisation in 1946? A Michael Scott B Collin Winter C Heinrich Vedder D Heinrich Goëring (1) 8. Why were independent churches established? A To create support for the South African government. B To give black people an opportunity to become pastors. -

Namibia: from SWANU to SWAPO
Namibia: from SWANU to SWAPO http://www.aluka.org/action/showMetadata?doi=10.5555/AL.SFF.DOCUMENT.naip100010 Use of the Aluka digital library is subject to Aluka’s Terms and Conditions, available at http://www.aluka.org/page/about/termsConditions.jsp. By using Aluka, you agree that you have read and will abide by the Terms and Conditions. Among other things, the Terms and Conditions provide that the content in the Aluka digital library is only for personal, non-commercial use by authorized users of Aluka in connection with research, scholarship, and education. The content in the Aluka digital library is subject to copyright, with the exception of certain governmental works and very old materials that may be in the public domain under applicable law. Permission must be sought from Aluka and/or the applicable copyright holder in connection with any duplication or distribution of these materials where required by applicable law. Aluka is a not-for-profit initiative dedicated to creating and preserving a digital archive of materials about and from the developing world. For more information about Aluka, please see http://www.aluka.org Namibia: from SWANU to SWAPO Author/Creator Sellström, Tor Publisher Nordiska Afrikainstitutet (Uppsala) Date 1999 Resource type Articles Language English Subject Coverage (spatial) Sweden, Southern Africa (region), Namibia Coverage (temporal) 1960-1970 Source Nordiska Afrikainstitutet (Uppsala) Relation Sellström, Tor. Sweden and national liberation in Southern Africa, Vol. I. Nordiska Afrikainstitutet, 1999. -

THE Kissinger/VORSTER/KAUNDA DETENTE GENESIS of the SWAPO 'SPY-DRAMA' :Part II Paul Trewhela
THE KiSSINGER/VORSTER/KAUNDA DETENTE GENESIS OF THE SWAPO 'SPY-DRAMA' :Part II Paul Trewhela Between Imperialism and Revolt The totality of antagonisms in Zambia, sharply heightened by the war in Angola and the detente scenario of Vorster and Kaunda, became con centrated within Swapo during 1975. With the Zambian regime as active protagonist, the pressure bearing downward from the major bourgeois states coincided with a countervailing force pressing upward on the Swapo leaders. In late 1971/early 1972, Namibia was shaken by the most important labour struggle in the country's history: the strike of the Ovambo contract workers, who, as Soggot writes, demanded 'freedom to travel, to work where they liked, to live where they liked, and to work where the pay was highest'—basic demands against a system of labour control more severe than any existing in South Africa at the time. This was the first salvo of the working class in its series of strikes in southern Africa during the 1970s, resulting in the organiza tion of workers in combative trade unions: a phenomenon that was to change the balance offerees in southern Africa. Then, in April 1974, the officers' coup in Lisbon brought down the Caetano dictatorship, ensuring the emergence of black-ruled states on the borders of South Africa and Namibia, headed by organizations which had undermined Portuguese colonial rule through armed insurgency. The new working class militancy, followed by the collapse of Portuguese colonialism, radicalized young people in South Africa, especially high school and university students, and acted as a mighty stimulus towards the Soweto revolt of June 1976.