Download Download
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
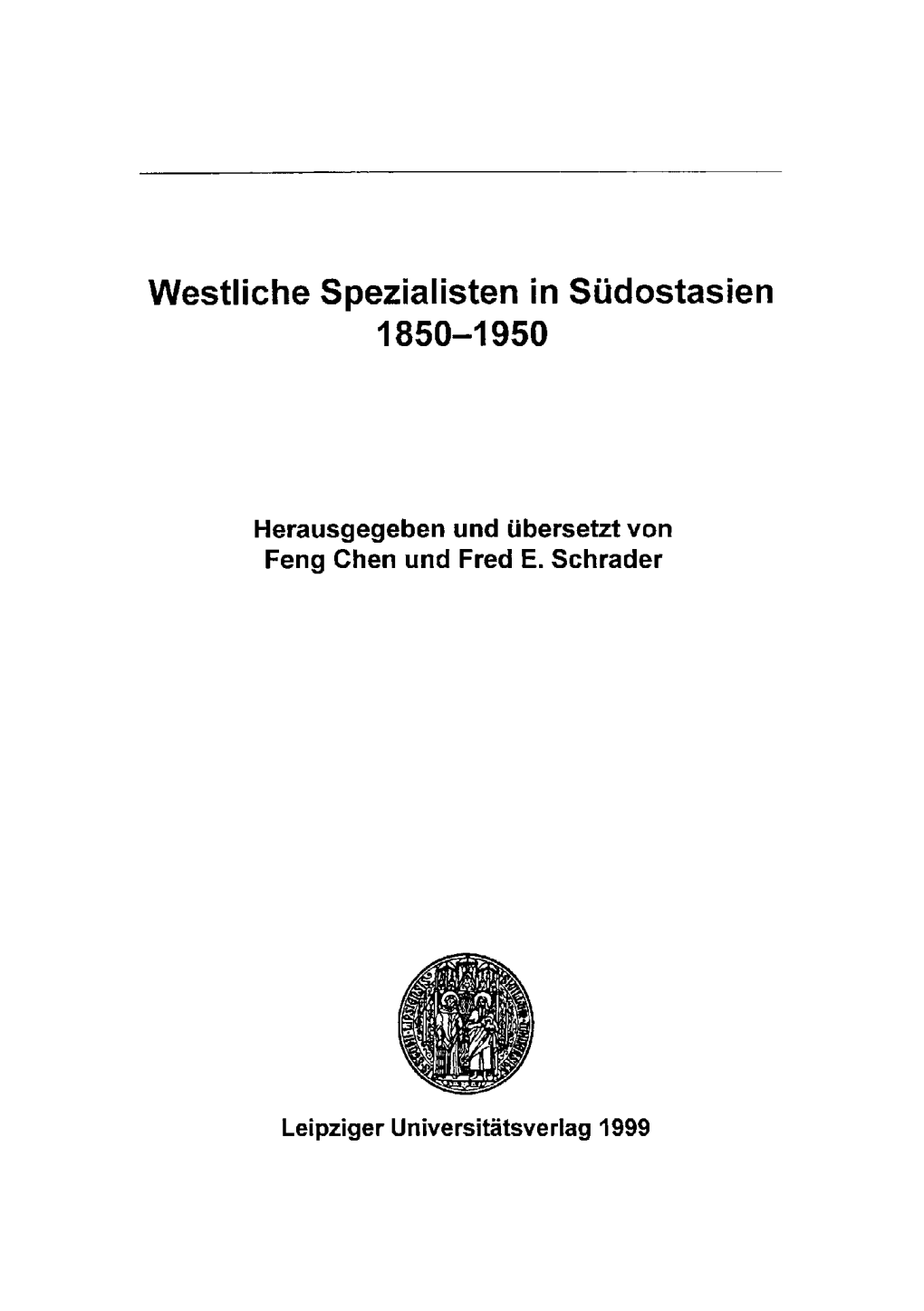
Load more
Recommended publications
-

ROBERT BURNS and PASTORAL This Page Intentionally Left Blank Robert Burns and Pastoral
ROBERT BURNS AND PASTORAL This page intentionally left blank Robert Burns and Pastoral Poetry and Improvement in Late Eighteenth-Century Scotland NIGEL LEASK 1 3 Great Clarendon Street, Oxford OX26DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York # Nigel Leask 2010 The moral rights of the author have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published 2010 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this book in any other binding or cover and you must impose the same condition on any acquirer British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Cataloging in Publication Data Data available Typeset by SPI Publisher Services, Pondicherry, India Printed in Great Britain on acid-free paper by MPG Books Group, Bodmin and King’s Lynn ISBN 978–0–19–957261–8 13579108642 In Memory of Joseph Macleod (1903–84), poet and broadcaster This page intentionally left blank Acknowledgements This book has been of long gestation. -

Proceedings Society of Antiquaries of Scotland
PROCEEDINGS SOCIETY OF ANTIQUARIES OF SCOTLAND. HUNDRED AND SECOND SESSION, 1881-82. ANNIVERSARY MEETING, SOtJi November 1881. PEOFBSSOS DUNS, D.D., Vice-President Chaire th n i ,. A Ballot having been taken, the following Gentlemen recom- mended by the Council were unanimously elected HONOKAKY FELLOW e Societth f So y :— Dr. LUDWIG LINDENSCHMIDT, Director of the Romisch-Gernianischen Central Museum, Maintz. Professor OLAF RYGH, Director of the National Museum of the Royal University, Christiania. Professor VIECHOW, Royal University, Berlin. Colonel HENRY YULE, Royal Engineers. The following Gentlemen were duly elected Fellows :— WILLIAM TBAQUAIH DICKSON, W.S. GEORGE GRAY, Solicitor, Glasgow. FREDERICK WALTER HADWEN, Kebroyd, Halifax. JAMES MAXTONE GHAHAME f Cultoc[uheyo , , Crieff. Rev. JAMES FORBES LEITH, Paris. VOL. xvr. A PROCEEDINGS OF THE SOCIETY, NOVEMBER 30, 1881. KENNETH MACDONALD, Town Clerk of Inverness. HENRY COCKBURN MACANDREW, Sheriff Clerk of Inverness-shire. DAVID MACRITOHIE, C.A., Nort . AndrehSt w Street. Rev. JOHN OLIVER, Belhaven, Dunbar. Rev. ROBERT PAUL, F.C. Manse, Dollar. JOH . NREIDJ , Advocate, Queen' Lord san d Treasurer's Remembrancer in Exchequer for Scotland. ALEXANDER GEORGE REID, Solicitor, Auchterarder. Eev. W. ROBERTSON SMITH, 20 Duke Street. Office-Bearftre Th e ensuinth r fo s g year were electe follows da s :— President. THE MOST HON. THE MARQUESS OF LOTHIAN, K.T. ' Vice-Presidents. Rev. THOMAS MACLAUCHLAN, LL.D. R. W. COCHRAN-PATRICK, LL.D., M.P. The Right Hon. The EARL OF STAIR. Councillors. Sir J. NOEL PATON, Kt, LL.D., R.S.A., ^Representing the FRANCIS ABBOTT, ) Board f Trustees.o Professor NORMAN MACPHEHSON, LL.D. Captai . L.W THOMAS. -

SCOTLAND Asch, Ronald
SCOTLAND Asch, Ronald. Three Nations--a Common History?: England, Scotland, Ireland and British History c. 1600-1920. Bochum: Universiteatsverlag N. Brockmeyer, 1993. DA 300 .T47 1993 Ascherson, Neal. Stone Voices: the Search for Scotland. London: Granta, 2002. DA 772 .A83 2002 Ash, Marinell. The Strange Death of Scottish History. Edinburgh: Ramsay Head Press, 1980. DA 759 .A84x Barber, John Warner. European Historical Collections: Comprising England, Scotland, with Holland, Belgium, and Part of France. New Haven CT: Barber, 1855. DA 30 .B36 Basu, Paul. Highland Homecomings: Genealogy and Heritage Tourism in the Scottish Diaspora. London ;New York: Routledge, 2007. E 184 .S3 B37 2007 Berry, W. Grinto. Scotland's Struggles for Religious Liberty. London: National Council of Evangelical Free Churches, 1904. BR 782 .B459 Beveridge, Craig. Scotland After Enlightenment: Image and Tradition in Modern Scottish Culture. Edinburgh: Polygon, 1997. DA 826 .B49x 1997 Bingham, Caroline. Land of the Scots: a Short History. [London]: Fontana Paperbacks, 1983. DA 761 .B5 Brotchie, Theodore C. F. The Battlefields of Scotland, their Legend and Story. New York: Dodge Publishing Co., [1913]. DA 767 .B7 Brown, Keith M. Noble Society in Scotland: Wealth, Family, and Culture from the Reformation to the Revolution. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000. HT 653 .B7 B76 2000 Brown, Peter Hume. History of Scotland. Cambridge: University press, 1899-1909. DA 760 .B88 vol.1- 3 Brown, Peter Hume. A Short History of Scotland. New ed., by Henry W. Meikle. ed. Edinburgh: Oliver & Boyd Ltd., [1961]. DA 760 .B88 1961 and DA 760 .B88 1908 Browne, James. The History of Scotland its Highlands, Regiments and Clans. -

Rollofhonour WWII
TRINITY COLLEGE MCMXXXIX-MCMXLV PRO MURO ERANT NOBIS TAM IN NOCTE QUAM IN DIE They were a wall unto us both by night and day. (1 Samuel 25: 16) Any further details of those commemorated would be gratefully received: please contact [email protected]. Details of those who did not lose their lives in the Second World War, e.g. Simon Birch, are given in italics. Abel-Smith, Robert Eustace Anderson, Ian Francis Armitage, George Edward Born March 24, 1909 at Cadogan Square, Born Feb. 25, 1917, in Wokingham, Berks. Born Nov. 20, 1919, in Lincoln. Son of London SW1, son of Eustace Abel Smith, JP. Son of Lt-Col. Francis Anderson, DSO, MC. George William Armitage. City School, School, Eton. Admitted as Pensioner at School, Eton. Admitted as Pensioner at Lincoln. Admitted as State Scholar at Trinity, Trinity, Oct. 1, 1927. BA 1930. Captain, 3rd Trinity, Oct. 1, 1935. BA 1938. Pilot Officer, Oct. 1, 1938. BA 1941. Lieutenant, Royal Grenadier Guards. Died May 21, 1940. RAF, 53 Squadron. Died April 9, 1941. Armoured Corps, 17th/21st Lancers. Died Buried in Esquelmes War Cemetery, Buried in Wokingham (All Saints) June 10, 1944. Buried in Rome War Hainaut, Belgium. (FWR, CWGC ) Churchyard. (FWR, CWGC ) Cemetery, Italy. (FWR, CWGC ) Ades, Edmund Henry [Edmond] Anderson, John Thomson McKellar Armitage, Stanley Rhodes Born July 24, 1918 in Alexandria, Egypt. ‘Jock’ Anderson was born Jan. 12, 1918, in Born Dec. 16, 1902, in London. Son of Fred- Son of Elie Ades and the Hon. Mrs Rose Hampstead, London; son of John McNicol erick Rhodes Armitage. -
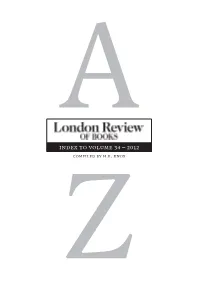
Download a PDF File of the Index for Volume 34
A index to volume 34 – 2012 compiled by h.e. knox Z INDEX Index of Authors: books reviewed are listed by author, with the title in italics and the reviewer’s name in brackets, followed by the issue number. Index of Reviewers: books reviewed are listed by reviewer, with the author’s name after the title. Subject Index: the subject is followed by the name of the author of the book discussed, with the reviewer’s name in brackets. Corres. refers to letters sent to the editor in response to the article listed, and printed in subsequent issues. Index of Original Contributions: all articles which are not strictly book reviews (features, diaries, poems, short stories) are listed here, as well as appearing in the index of authors. Index of Authors Abulafia, D.: The Great Sea: A Human History of the Bianchini, P.: Suret-Canale de la Résistance à l’anticolonialisme. Cockburn, P.: A Prehistory of Extraordinary Rendition. Mediterranean. (McGilchrist, N.) 34.6 (Johnson, R.W.) 34.18 (Feature) 34.17 Achebe, C.: There Was a Country: A Personal History of Biafra. Biggs, J.: Among the Writers. (Feature) 34.9 Coggan, P.: Paper Promises: Money, Debt and the New World (Adichie, C.) 34.19 Binet, L.: Translator Taylor, S. HHhH. (Newton, M.) 34.21 Order. (Kunkel, B.) 34.9 Acosta-Hughes, B. and Stephens, S.: Callimachus in Bloomer, M.: The School of Rome: Latin Studies and the Cohen, L.: All We Know: Three Lives. (Castle, T.) 34.18 Context. (Green, P.) 34.24 Origins of Liberal Education. (Whitmarsh, T.) 34.11 Coll, S.: Private Empire: ExxonMobil and American Power. -

Englischer Diplomat, Commissioner Chinese Maritime Customs Biographie 1901 James Acheson Ist Konsul Des Englischen Konsulats in Qiongzhou
Report Title - p. 1 of 266 Report Title Acheson, James (um 1901) : Englischer Diplomat, Commissioner Chinese Maritime Customs Biographie 1901 James Acheson ist Konsul des englischen Konsulats in Qiongzhou. [Qing1] Adam, James Robertson (Dundee, Schottland 1863-1915 Anshun, Guizhou vom Blitz erschlagen) : Protestantischer Missionar China Inland Mission Biographie 1887 James Robertson Adam wird Missionar der China Inland Mission in China. [Prot2] Addis, John Mansfield = Addis, John Mansfield Sir (1914-1983) : Englischer Diplomat Biographie 1947-1950 John Mansfield Addis ist Erster Sekretär der britischen Botschaft in Nanjing. [SOAS] 1950-1954 John Mansfield Addis ist im Foreign Office der britischen Botschaft in Beijing tätig. [ODNB] 1954-1957 John Mansfield Addis ist Generalkonsul der britischen Botschaft in Beijing. [SOAS] 1970-1974 John Mansfield Addis ist Botschafter der britischen Regierung in Beijing. [SOAS] 1975 John Mansfield Addis wird Senior Research Fellow in Contemporary Chinese Studies am Wolfson College, Oxford. [SOAS] Adeney, David Howard (Bedford, Bedfordshire 1911-1994) : Englischer protestantischer Missionar China Inland Mission Biographie 1934 Ruth Adeney lernt Chinesisch an der Sprachenschule der China Inland Mission in Yangzhou (Jiangsu) ; David Howard Adeney in Anqing (Anhui). [BGC] 1934-1938 David Howard Adeney ist als Missionar in Henan tätig. [BGC] 1938 Heirat von David Howard Adeney und Ruth Adeney in Henan. [BGC] 1938-1941 David Howard Adeney und Ruth Adeney sind als Missionare in Fangcheng (Henan) tätig. [BGC] 1941-1945 David Howard Adeney und Ruth Adeney halten sich in Amerika auf. [BGC] 1946-1950 David Howard Adeney und Ruth Adeney sind für das Chinese Inter-Varisty Fellowship für Universitäts-Studenten in Nanjing und Shanghai tätig. [BGC] 1950-1956 David Howard Adeney und Ruth Adeney halten sich in Amerika auf. -

Report Title 16. Jahrhundert 17. Jahrhundert 18. Jahrhundert
Report Title - p. 1 Report Title 16. Jahrhundert 1583 Geschichte : China - Europa : England Elizabeth I. schreibt einen Brief an den Kaiser von China um Kontakt aufzunehmen. [Hsia8:S. 220] 1596-1597 Geschichte : China - Europa : England Elizabeth I. schickt drei Schiffe nach China und gibt Benjamin Wood einen Brief an den Kaiser mit. Die Schiffe erleiden Schiffbruch im Golf von Martaban, Burma. [Hsia8:S. 220,LOC] 17. Jahrhundert 1625 Geschichte : China - Europa : England Engländer erreichen die chinesische Küste. [Wie 1] 1637 Geschichte : China - Europa : England Die ersten englischen Schiffe kommen an der Küste von Süd-Ost China an. [Stai 1] 1683-1684 Geschichte : China - Europa : England William Dampier durchquert die chinesischen Meere. [Boot] 1698-1701 Geschichte : China - Europa : England James Cunningham reist 1698 als Arzt einer Fabrik der British E.I. Company nach Amoy [Xiamen]. 1699 wird er Fellow der Royal Society und reist 1700 wieder nach China. 1701 erreicht er die Insel Chusan [Zhoushan]. 1699 Geschichte : China - Europa : England / Wirtschaft und Handel Gründung der British East India Company in China, was den Handel mit Hong Kong fördert. [Wik] 18. Jahrhundert 1766 Geschichte : China - Europa : England James Lind besucht Guangzhou und sammelt chinesische Gegenstände und Bücher. [Kit1:S. 59] Report Title - p. 2 1774-1784 Geschichte : China - Europa : England Huang Yadong hält sich in England auf. He is described as Wang-y-Tong, who worked as a page in the John Frederick Sackville's household at Knole and attended the local Sevenoaks School. Huang Yadong is known to have visited the naturalists Mary Delany and the Duchess of Portland at the latter’s country seat of Bulstrode, discussing Chinese plants and their uses with them. -

COCKBURN of LANGTON
© Red Book of Scotland – 2020. [email protected] COCKBURN of LANGTON SIR ALEXANDER DE COCKBURN OF LANGTON, was a son of Sir Alexander de Cockburn by his first wife, Mariote, only child of Sir William de Vitrepont, and heiress to extensive baronies including those of Langton and Ormiston. To their son Alexander the baronies of Langton, Bolton and Carriden were conveyed and which were confirmed to him by charter expede under the Great Seal on 13 February 1372.1 He was appointed keeper of the Great Seal, being so-styled when witness to a considerable number of charters, including that to the Monks at Kilwinning on 26 February 1393,2 and had a payment from the customs of Haddington in 1406.3 He d. after then and before December 1423, and was father of, 1. Alexander de Cockburn of Langton, (see below). 2. William de Cockburn, was an armour-bearer to Archibald, Earl of Douglas, from whom he had a charter for the lands of Crumaws on 10 December 1423, with remainder to himself and the heirs of his body, which failing, to his brother Patrick. and in which he is styled son to the deceased Sir Alexander de Cockburn of Langton.4 3. Patrick de Cockburn, was a substitute heir to his brother William in the lands of Crumaws, in 1423. He is said, without suitable evidence, to be ancestor of Cockburn of Clerkington. 1 NRAS2177/645/Misc. 2 C2/13/617. 3 Ex. Rolls. Vol. IV. P. 3. 4 C2/3/146. © Red Book of Scotland – 2020. -

DH.89 DRAGON RAPIDE DH.89 Fitted with 2X200hp Gipsy Six DH
DH.89 DRAGON RAPIDE DH.89 Fitted with 2x200hp Gipsy Six DH.89A Fitted with 2x200hp Gipsy Queen III & small training edge flaps under lower wing 6250 Prototype Dragon Six (Gipsy Six #6008/6009); first flown Hatfield by Hubert Broad 17.4.34 as E.4. [Sale to R Herzig of Ostschweiz AG announced 4.34] CofA 4306 issued 10.5.34. CofA renewed 14.7.34 and handed over 16.7.34; dd Altenrhein 18.7.34. Regd CH-287 19.7.34 to Ostschweiz Aero-Gesellschaft, Altenrhein. Regd HB-ARA 1.35 to same owner. Wore Aero St Gallen titles [3.35] for St Gallen/Zurich/Berne service. Damaged in crash 3.35; repaired. Regd 20.3.37 to Swissair AG, Zurich-Dubendorf. Regd HB-APA 6.37 to same owner. To Farner-Werke AG .54 and on overhaul Grenchen [8.54]. Reported sale to Spain .54 fell through and regd .55 to Farner Werke AG, Grenchen. Regd .55 to Motorflugruppe Zurich, Aero Club de Suisse, Kloten. Wfu Kloten after final flight 3.10.60. Regn cld 10.5.61. Dumped [62] on Zurich-Kloten airfield and burnt by Zurich Airport Fire Service 8.64. 6251 Regd G-ACPM [CofR 4955] 7.6.34 to Hillman's Airways Ltd, Stapleford. (Gipsy Six #6014/6015) CofA 4365 issued 5.7.34. Entered by Lord Wakefield in King's Cup Air Race 13.7.34, flown by Capt Hubert Broad but withdrawn following hail damage over Waddington. Dd Hillmans 27.7.34. Crashed into English Channel in low cloud 4 mls off Folkestone 2.10.34 inbound from Paris; 7 killed including Capt Walter R Bannister. -

Broadly Speaking : Scots Language and British Imperialism
BROADLY SPEAKING: SCOTS LANGUAGE AND BRITISH IMPERIALISM Sean Murphy A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of St Andrews 2017 Full metadata for this item is available in St Andrews Research Repository at: http://research-repository.st-andrews.ac.uk/ Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10023/11047 This item is protected by original copyright Sean Murphy, ‘Broadly Speaking. Scots language and British imperialism.’ Abstract This thesis offers a three-pronged perspective on the historical interconnections between Lowland Scots language(s) and British imperialism. Through analyses of the manifestation of Scots linguistic varieties outwith Scotland during the nineteenth century, alongside Scottish concerns for maintaining the socio-linguistic “propriety” and literary “standards” of “English,” this discussion argues that certain elements within Lowland language were employed in projecting a sentimental-yet celebratory conception of Scottish imperial prestige. Part I directly engages with nineteenth-century “diasporic” articulations of Lowland Scots forms, focusing on a triumphal, ceremonial vocalisation of Scottish shibboleths, termed “verbal tartanry.” Much like physical emblems of nineteenth-century Scottish iconography, it is suggested that a verbal tartanry served to accentuate Scots distinction within a broader British framework, tied to a wider imperial superiorism. Parts II and III look to the origins of this verbal tartanry. Part II turns back to mid eighteenth-century Scottish linguistic concerns, suggesting the emergence of a proto-typical verbal tartanry through earlier anxieties to ascertain “correct” English “standards,” and the parallel drive to perceive, prohibit, and prescribe Scottish linguistic usage. It is argued that later eighteenth-century Scottish philological priorities for the roots and “purity” of Lowland Scots forms – linked to “ancient” literature and “racially”-loaded origin myths – led to an encouraged “uncovering” of hallowed linguistic traits. -

“Harry the Ninth (The Uncrowned King of Scotland)”
“Harry the Ninth (The Uncrowned King of Scotland)” Henry Dundas and the Politics of Self-Interest, 1790-1802 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Arts (Honours) in History. Sam Gribble 307167623 University of Sydney October 2012 Abstract The career of Henry Dundas, 1st Viscount Melville underscores the importance of individual self-interest in British public life during the 1790-1802 Revolutionary Wars with France. Examining the political intrigue surrounding Dundas’ 1806 impeachment, the manner in which he established his political power, and contemporary critiques of self-interest, this thesis both complicates and adds nuance to understandings of the political culture of ‘Old Corruption’ in the late-Georgian era. As this thesis demonstrates, despite the wealth of opportunities for personal enrichment, individual self-interest was not always focused on obtaining sinecures and financial windfalls. Instead, men like Henry Dundas were primarily focused upon amassing their own political power. In the inherently chaotic politics of the period, the self-seeking concerns of individuals like Henry Dundas, very quickly could, and indeed did, become the thread upon which the whole British political system turned. 2 Acknowledgments My thanks go first and foremost my supervisor, Dr Kit Candlin. His guidance, advice and expertise were vital in devising and writing this thesis, as was his unerring ability to ensure that I came away from our meetings enthusiastic about the task at hand. I would also like to thank Professor Robert Aldrich and Dr Lyn Olsen for their research seminars, both of which made me a better student and historian. -

Inventory Dep.235 Cockburn & Pitcairn Families
Inventory Dep.235 Cockburn & Pitcairn Families National Library of Scotland Manuscripts Division George IV Bridge Edinburgh EH1 1EW Tel: 0131-466 2812 Fax: 0131-466 2811 E-mail: [email protected] © Trustees of the National Library of Scotland Papers of the Cockburn and Pitcairn families. Deposited, March 1975. Two letters, 25 February 1833, 3 August 1840 [see inventory, Box 1], deposited November 1980. Box 3A, deposited 15 November 1982. Francis Jeffrey Cockburn’s privately-printed Recollections of an Indian Civilian (London 1906), added to Box 4, March 1981. Boxes 7-9 deposited November 1984. BOX 1 Letters to and from Henry Cockburn, Lord Cockburn. Date To/From SL or other ref where given [?1806] To John Richardson SL 9-10 [30 Jun 1807] To John Richardson 31 Dec 1808 To John Richardson SL 11-12 8 Oct 1819 To John Richardson SL 17-18 6 Nov 1820 To Sir Thomas Dick Lauder 11 Nov 1820 To Sir Thomas Dick Lauder 15 Feb 1822 To Sir Thomas Dick Lauder SL 20-21 25 Sept 1822 From John Abercrombie 2 Feb 1823 To Mrs Jeffrey 23 Jun 1823 To Mrs Cockburn (copy) 9 Nov 1825 To Sir Thomas Dick Lauder 15 Sept 1826 To Sir Thomas Dick Lauder 27 Apr 1827 To Francis Jeffrey 15 Aug 1827 To Francis Jeffrey SL 22-3 15 Sept 1828 To Sir Thomas Dick Lauder 26 Apr 1829 To Sir Thomas Dick Lauder SL 25-6 28 Jun 1829 From Francis Jeffrey 9.1.10, pp.898-9 12 Aug 1829 To Sir Thomas Dick Lauder SL 26-7 21 Jul 1830 To Francis Jeffrey SL 27-8 30 Dec 1830 To Sir Thomas Dick Lauder SL 28-30 5 Feb 1831 To Sir Thomas Dick Lauder 16 Feb 1831 To Francis Jeffrey 22 Feb 1831 To