Bayerisches Vogtland, Fichtelgebirge, Steinwald
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-
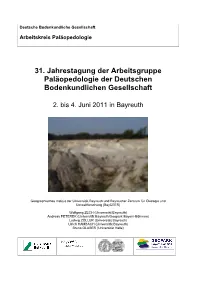
Agpp Bayreuth 2011
Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft Arbeitskreis Paläopedologie 31. Jahrestagung der Arbeitsgruppe Paläopedologie der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 2. bis 4. Juni 2011 in Bayreuth Geographisches Institut der Universität Bayreuth und Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung (BayCEER) Wolfgang ZECH (Universität Bayreuth) Andreas PETEREK (Universität Bayreuth/Geopark Bayern-Böhmen) Ludwig ZÖLLER (Universität Bayreuth) Ulrich HAMBACH (Universität Bayreuth) Bruno GLASER (Universität Halle) Inhaltsverzeichnis Seite A. Programm A1 – A3 B. Arbeitsgruppensitzung am 2.6.11 B1 – B9 C. Einführung in das Exkursionsgebiet C1 – C41 D. Analysendaten 1. Fichtelgebirge und Oberpfalz D1 1. Halt: Schweinsbach (Braunerde-Podsol über Fersiallit) D1 – D7 2. Halt: Luisenburg (Blockmeere) D8 3. Halt: Schirnding (Kaolingrube mit Braunkohle) D9 – D11 4. Halt: Seedorf (reliktischer Pseudogley über fossilem Pseudogley-Ferrallit aus Phyllit) D12 – D17 5. Halt: Waldsassen (Mittagessen, Kirche) D18 6. Halt: Tirschenreuth, Rappauf (fossiler Ferrallit über Granitzersatz) D19 – D24 7. Halt: Windischeschenbach (KTB) D25 8. Halt: Kirchenthumbach (oberkreidezeitl. Boden) D26 2. Bindlach - Tschernozem D27-D33 - „Lößprofil“ D34-D39 Weitere Informationen zur Anmeldung, Anreise, Programm und Unterkunft finden sich unter http://www.bayceer.uni-bayreuth.de/agpp2011/de/top/grü/html.php? id_obj = 12982 A. Programm Das Programm zur 31. Jahrestagung, zu der wir Sie herzlich einladen, umfasst: Donnerstag, 2.6.2011 14.30 – ca. 18.30 Uhr: Begrüßung und Arbeitsgruppensitzung, Hörsaal H 8, Gebäude Geowissenschaften I Ab 19.00 Uhr gemeinsames Abendessen im Gasthof „Schwenk-Saal“ (5 Minuten Fußweg von der Universität) A1 Programm Freitag, 3.6.2011 Von 8.00 bis ca. 19.00 Uhr Exkursion zum Thema „Tertiäre Verwitterungsreste im Fichtelgebirge und in der Nördlichen Oberpfalz“. 1. Halt: Schweinsbach (Braunerde-Podsol über Fersiallit) 2. -

Rund Um Den Ochsenkopf 7 Sonntagstouren Im Fichtelgebirge Rund Um Den Ochsenkopf
Rund um den Ochsenkopf 7 Sonntagstouren im Fichtelgebirge Rund um den Ochsenkopf Einleitung Vorwort S. 4 Gut zu wissen! S. 6 Fahrradmitnahme im Bus S. 7 Sieben auf einen Streich! Unsere Entdecker-Touren Übersichtskarte S. 8 1 Von Bischofsgrün bis Bad Berneck (sehr leicht) und über St. Georgen nach Bayreuth (mittelschwer) S. 10 Impressum 2 Fünf Quellen und drei Brunnen (schwer) S. 22 Idee und Ausarbeitung: VGN / S. Daßler, Gertrud Härer (Stand: 11 / 2018) 3 Seen- und Flusstour (leicht) S. 37 Bilder: Gertrud Härer, Susanne Daßler, Karin Allabauer, Karl Mistelberger 4 Von Bischofsgrün nach Pegnitz (mittelschwer) S. 41 Fehler in der Tourenbeschreibung? Korrekturen 5 Baden, Bahntrassenrollen, Besichtigen (mittelschwer) S. 57 können gerne an [email protected] geschickt werden. 6 Mit Seilbahn und Fahrrad hinauf auf den Ochsenkopf, Kartengrundlagen: Inkatlas.com, © OpenStreetMap Mitwirkende (openstreetmap.org), OpenTopoMap (CC-BY-SA) reich mäandrierend wieder hinunter (mittelschwer) S. 66 7 Historisches Weidenberg und mehr – solo oder im Gestaltung: WerbeAtelier Kolvenbach-Post Druck: Gutenberg Druck + Medien GmbH Anschluss an die Touren 2, 4 und 5 (mittelschwer) S. 72 Auflage: 7.500 Fotos Titelseite – links oben: Bad Berneck Marktplatz, Einkehren und genießen links unten: neuer Radweg zwischen Warmensteinach und Weidenberg, Einkehrmöglichkeiten S. 79 rechts: Ochsenkopfgipfel mit Wahrzeichen; © VGN/S. Daßler Fotos Rückseite – links: Felsen am Radweg, rechts: Wegeauswahl; © G. Härer 2 Tour 1 Bischofsgrün – Bad Berneck – Bad Berneck 329 369 Abzw. -

Naturschutzkonzept Für Den Forstbetrieb Waldsassen
Naturschutzkonzept für den Forstbetrieb Waldsassen Stand: 07/2010 Blick über den Steinwald Bearbeitung: Gerhard Schneider, Daniel Zippert Karl Kuhbandner Forstbetrieb Waldsassen Naturschutzbeauftragter Nordost Egerer Str. 30a Bayerische Staatsforsten (Zentrale) 95652 Waldsassen Tillystr. 2 93053 Regensburg Hinweis Alle Inhalte dieses Naturschutzkonzeptes, insbesondere Texte, Tabellen und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt (Copyright). Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei den Bayerischen Staatsforsten. Nachdruck, Vervielfältigung, Veröffentlichung und jede andere Nutzung bedürfen der vorherigen Zustimmung des Urhebers. Wer das Urheberrecht verletzt, unterliegt der zivilrechtlichen Haftung gem. §§ 97 ff. Urheberrechtsgesetz und kann sich gem. §§ 106 ff. Urheberrechtsgesetz strafbar machen. INHALTSVERZEICHNIS 1 Zusammenfassung ...................................................................... 4 2 Allgemeines zum Forstbetrieb Waldsassen ............................... 8 2.1 Naturraum...................................................................................................... 8 2.2 Geschichte ...................................................................................................10 2.3 Waldzusammensetzung und natürliche Vegetation .................................12 2.4 Ziele der Waldbewirtschaftung ...................................................................14 3 Naturschutzfachlicher Teil ........................................................ 16 3.1 Schutz alter -

Abfallwegweiser 2020
POSTAKTUELL An sämtliche Haushalte im Landkreis Tirschenreuth Abfallwegweiser 2020 DAS JAHR ÜBER GUT AUFBEWAHREN: Wichtige Formulare, Termine und Tipps zur Abfallentsorgung! Beauftragte Firmen Reststoffdeponie Steinmühle Abfuhrbezirk Ost Wertstoffsammelstelle Müllumladestation ZMS X Abfuhrbezirk West Im Landkreis Tirschenreuth sind folgende Firmen für die Entsorgung Ihrer Abfälle zuständig: Firma Bergler GmbH & Co. KG Problemabfallsammlung Etzenrichter Straße 12 92729 Weiherhammer 09605/9202-0 www.bergler.de Firma Magnitz GmbH Altpapiertonnenabfuhr Franz-Heldmann-Straße 58 Biotonnenabfuhr 95643 Tirschenreuth Restmüllabfuhr 09631/7031-0 www.magnitz.de Sperrmüllabholung Altglas- & Weißblechcontainer Gelbe Sack-Sammlung 3 goldene Regeln – damit die Müllabfuhr klappt 1. Abfälle richtig trennen: Nutzen Sie das komfortable Holsystem aus Biotonne, Papiertonne und Restmülltonne. Gelbe Säcke sind ausschließlich für restentleerte Verkaufsverpackungen zu verwenden. Für die Entsorgung von Akkus, Batterien, Elektroaltgeräten und weiteren Problem- abfälle stehen Ihnen umweltfreundliche Entsorgungswege zur Verfügung (s. Abfall- ABC). 2. Abfallgefäße müssen eine gültige Gebührenkontrollmarke aufweisen. 3. Mülltonnen und Gelbe Säcke unbedingt rechtzeitig bis 6 Uhr morgens bereitstellen. 2 Beauftragte Firmen Sehr geehrte Damen und Herren, Reststoffdeponie Steinmühle Abfuhrbezirk Ost liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Wertstoffsammelstelle Müllumladestation ZMS in gewohnter Weise erhalten Sie mit dem Abfallwegweiser alle X Abfuhrtermine für das kommende -

Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Political Studies
Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Political Studies Master’s Thesis Breaking Down Barriers: Euroregional Cooperation of the Czech Republic Author: Bc. Karen Benko Subject: IEPS Supervisor: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D Academic Year: 2013/2014 Date of Submission: May 14, 2014 Declaration of Authorship I hereby declare that this thesis is my own work, based on the sources and literature listed in the appended bibliography. The thesis as submitted is 130,962 keystrokes long including spaces, i.e. 51 manuscript pages excluding the initial pages, the list of references and appendices. Prague, 14.05.2014 Bc. Karen Benko 2 Acknowledgement I would like to express my gratitude to my supervisor, PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D, for her guidance during the writing process. 3 Abstract: Cooperation between people of different nations has existed throughout Europe for centuries on an informal basis as borders have shifted and power has found its way into different hands. During the European integration process of the 1950s, this cooperation was formalized with the creation of the Euroregions, or cross-border regions. These regions were formed to promote common interests and cooperation to counteract barriers and benefit the people residing in the area. The Czech Republic is currently a member of 13 different Euroregions either exclusively or with multiple neighboring countries: Poland (7), Austria (3), Germany (4), and Slovakia (2). Of these 13 regions, four – Silva Nortica (Czech-Austrian, 2002), Bílé-Biele Karpaty (Czech- Slovak, 2000), Silesia (Czech-Polish, 1998), and Egrensis (Czech-German, 1993) – have been chosen to further evaluate how the creation of Euroregions has facilitated regional development. -

The Youngest Inactive Volcano Komorní Hůrka
Points of interest in close surrounding: - the youngest inactive volcano Komorní h ůrka – in 3 km walking distance from Apartment. Despite its history this isn't a particularly prominent landmark, just a low, partly wooded hill between Cheb and Františkové Lázn ě. The striking crater-like formation found there isn't actually a crater but an old quarry. Records suggest its last activity was no more than a small amount of ash being blown out here and there and one small gush of lava, which is not surprising given that the volcano was born in the final closing phase of volcanic activity in the Czech Republic. It also has a sister, practically a twin, in the nearby Železná H ůrka. The name Železná meaning 'iron' probably comes from the fact that both of these small volcanoes were later found to be sites that contained mineral rarities – sheets of pure natural iron. - Chateau and castle Starý Rybník - 5 km, Gothic castle standing between two was built in the mid 14th century. A part of the castle tumbled down in the 18th century. Nonetheless, the entrance building had remained in use up to the early 20th century when it was finally abandoned. Apart from cellarage, a major part of the western wall has been preserved while the eastern wall and the inner curtain are hardly noticeable. Two half-cylindrical towers supported the palace from the south of which only the western section remains standing. Renaissance and Baroque elements along with half-timbered structures have also been preserved.The castle ruins are freely accessible. -

Abfallwegweiser 2021
POSTAKTUELL An sämtliche Haushalte im Landkreis Tirschenreuth Abfallwegweiser 2021 DAS JAHR ÜBER GUT AUFBEWAHREN: Wichtige Formulare, Termine und Tipps zur Abfallentsorgung! Beauftragte Firmen Reststoffdeponie Steinmühle Abfuhrbezirk Ost Wertstoffsammelstelle ZMS - Müllumladestation X Abfuhrbezirk West Im Landkreis Tirschenreuth sind folgende Firmen für die Entsorgung Ihrer Abfälle zuständig: Firma Bergler GmbH & Co. KG Problemabfallsammlung Etzenrichter Straße 12 92729 Weiherhammer 09605/9202-0 www.bergler.de Firma Magnitz GmbH Altpapiertonnenabfuhr Franz-Heldmann-Straße 58 Biotonnenabfuhr 95643 Tirschenreuth Restmüllabfuhr 09631/7031-0 www.magnitz.de Sperrmüllabholung Altglas- & Weißblechcontainer Gelbe Sack-Sammlung 3 goldene Regeln – damit die Müllabfuhr klappt 1. Abfälle richtig trennen: Nutzen Sie das komfortable Holsystem aus Biotonne, Papiertonne und Restmülltonne. Gelbe Säcke sind ausschließlich für restentleerte Verkaufsverpackungen zu verwenden. Für die Entsorgung von Akkus, Batterien, Elektroaltgeräten und Problemabfällen stehen Ihnen umweltfreundliche Entsorgungswege zur Verfügung (s. Abfall-ABC). 2. Abfallgefäße müssen eine gültige Gebührenkontrollmarke aufweisen. 3. Mülltonnen und Gelbe Säcke unbedingt rechtzeitig bis 6 Uhr morgens bereitstellen. 2 Beauftragte Firmen Sehr geehrte Damen und Herren, Reststoffdeponie Steinmühle Abfuhrbezirk Ost liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Wertstoffsammelstelle ZMS - Müllumladestation auch wenn im Jahr 2020 so manche „Selbstverständlichkeit“ verloren ging, halten Sie heute doch wie -

Das Magazin Der Steinwald-Allianz
STEIN& WALD STAusgabe 10 / OktoberEI 2020 N& WALD Das Magazin der Steinwald-Allianz BRAND / EBNATH / ERBENDORF / FALKENBERG / FRIEDENFELS / FUCHSMÜHL / IMMENREUTH / KASTL / KEMNATH / KRUMMENNAAB / KULMAIN / NEUSORG / PULLENREUTH / REUTH BEI ERBENDORF / WALDERSHOF / WIESAU / WINDISCHESCHENBACH INHALT 1 Regionalbudget Platz für Ideen - Das neue Förderprogramm Regionalbudget Regionalbudget 2020 - Eindrücke von Projekten 2 Natur und Freizeit Der Habichtskauz im Steinwald - Rückkehr einer seltenen Vogelart Einzigartig wandern auf dem Fränkischen Gebirgsweg Eine besondere Idee: Der Bio-Geschenkkorb PLATZ FÜR IDEEN aus dem mobilen Dorfladen Das neue Förderprogramm Regionalbudget 3 Öko-Modellregion Steinwald Zuwachs für die Bio-Burger-Familie aus dem Steinwald "Kleiner finanzieller Einsatz, große Wir- Projekte müssen ein Volumen von mindes- projekt" zu verwandeln. Barrierefreie und Artenvielfalt fördern mit kung" - nach diesem Motto lassen sich die tens 500 € haben, dürfen aber 20.000 € nicht öffentlich zugängliche Maßnahmen wurden der eigenen Blumenwiese Projekte umschreiben, die im Jahr 2020 überschreiten. Die ausgewählten Projekte bei der Auswahl besonders gewürdigt. Neue Broschüren in der eine Förderzusage aus dem Regionalbud- können mit bis zu 80 % aber maximal mit Öko-Modellregion Steinwald get erhalten haben. Die Steinwald-Allianz 10.000 € gefördert werden. Damit ist das Re- Herausforderungen hat sich im vergangenen Dezember beim gionalbudget eine Chance für Kommunen, Für alle Beteiligten war es ein erstes span- 4 Wissensvorsprung Amt -

Radiogenic Heat Production of Variscan Granites from the Western Bohemian Massif, Germany
Journal of Geosciences, 64 (2019), 251–269 DOI: 10.3190/jgeosci.293 Original paper Radiogenic heat production of Variscan granites from the Western Bohemian Massif, Germany Lars SCHARFENBERG1,2*, Anette REGELOUS1, Helga DE WALL1 1 GeoZentrum Nordbayern, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Schlossgarten 5, D-91054 Erlangen, Germany 2 Present address: Department für Geodynamik und Sedimentologie, Department für Lithosphärenforschung, Universität Wien, Althanstraße 14, A-1190 Vienna, Austria; [email protected] * Corresponding author Much of the Mid-European basement has been consolidated during the Variscan Orogeny and includes large volumes of granitic intrusions. Gamma radiation spectroscopic measurements in three study areas along the western margin of the Bohemian Massif give a record of radiogenic element concentrations in the Variscan granites. Most intrusions of the Fichtelgebirge (except for the Tin Granite) and intrusive complexes in the Bavarian Forest show Th/U ratios exceeding unity, most likely related to abundance of monazite. In contrast, some of the Oberpfalz granites located near the Saxo- thuringian–Moldanubian boundary (Flossenbürg, Steinwald and Friedenfels types) are characterized by higher uranium concentrations and thus Th/U < 1. The low Th/U ratios here are in agreement with a possible U mobilisation along the Saxothuringian–Moldanubian contact zone observed in previous studies. Heat production rates of granites in the three study areas vary between 3.9 and 8.9 µW/m3, with a mean of 4.9 µW/m3. This classifies the intrusions as moderate- to high-heat-producing granites. Considering the huge volume of granitic bodies in the Variscan crust of the Bohemian Massif, the contribution of in situ radiogenic heat production had to have a major impact and should be considered in further thermal modeling. -
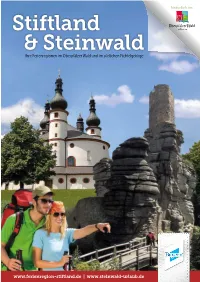
Stiftland & Steinwald
Stiftland & Steinwald Ihre Ferienregionen im Oberpfälzer Wald und im südlichen Fichtelgebirge 1 www.ferienregion-stiftland.de | www.steinwald-urlaub.de IMPRESSUM Herausgeber: Steinwald-Allianz Bräugasse 6, 92681 Erbendorf Tel. 09682/182219-0, Fax 09682/182219-22 www.steinwald-urlaub.de Ferienregion Stiftland Johannisplatz 11, 95652 Waldsassen Tel. 09632/88-160 Fax 09632/882160 www.ferienregion-stiftland.de Gestaltung: Wittmann Druck & Werbung, 95652 Waldsassen Bildnachweis: Archive der Tourismusreferate Stiftland/Steinwald, Archiv des Tourismuszentrums Oberpfälzer Wald Tirschenreuth, Luftbild A. Laumer, Weiden; J. Dostler, Erbendorf; B. Eckstein, Waldsassen; S. Gruber, Regensburg; shutterstock.com Druck: Spintler Druck und Verlag, 92637 Weiden i.d. Opf. Die Angaben wurden sorgfältig erhoben und bear- beitet. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Dieser Prospekt dient lediglich der Absatzförderung und Ihrer Information. Aus unzutreffenden Angaben oder nicht erfüllten Leistungszusagen des jeweiligen Leis- tungsträger kann keine Schadensersatzpflicht geltend gemacht werden. Nachdruck, auch auszugsweise nur mit vorheriger Genehmigung der Herausgeber. Titelbild: Dreifaltigkeitskirche Kappl / Burgruine Weißenstein Rückseite: Lageplan / Impressionen Geschichtspark Bärnau-Tachov 2 INHALTSVERZEICHNIS Natur pur im Steinwald und Stiftland 4 Land der tausend Teiche 6 Wandern 8 Radeln 10 Museen 12 Klettern und bizarre Felsengebilde, Burgen und Schlösser 14 Ortsvorstellung Steinwald 16 Karte 17/18 Ortsvorstellung Stiftland 19 Sibyllenbad 20 Kunst, Kultur, -

35. Jahrgang · Heft 3 · Oktober 2015 DER SEKTION WEIDEN DES
Sektion Weiden e.V. des Deutschen Alpenvereins Fleischgasse 18 92637 Weiden Postvertriebsstück B 7154 Entgelt bezahlt MITTEILUNGENDER SEKTION WEIDEN DES DAV Ganz nach oben für Ihre Finanzen. Steigen Sie mit uns auf. S Sparkasse Oberpfalz Nord Klinken Sie sich bei uns ein – machen Sie jetzt Ihren individuellen Finanz-Check bei der Sparkasse. Wann und wo immer Sie wollen, analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Situation und entwickeln eine maßgeschneiderte Rundum-Strategie für Ihre Zukunft. Mehr dazu in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse-oberpfalz-nord.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse. 35. Jahrgang · Heft 3 · Oktober 2015 Sektionsbücherei Liebe Bergfreunde! In der Geschäftsstelle sind alle AV-Führer und AV-Karten vorhan- den, die Sie sich zur Planung Ihrer Bergtouren und Wanderfahrten kostenlos ausleihen können. Weiterhin liegen die monatlich erscheinenden Zeitschriften „Bergstei- ger/Bergwanderer“ und „Alpin“ auf, in denen Sie Interessantes aus den Alpen nden. AV-Skiführer und AV-Karten mit Skitouren, Bücher über Klettersteige und Höhenwege in den Alpen, Gebietsführer über Südtirol, BV-Touren- blätter, Alpin-Lehrpläne und sonstige Bergliteratur ergänzen unsere Büchersammlung. Die Geschäftsstelle ist jeden Donnerstag von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr geönet. Ausgeliehenes Bücher- und Kartenmaterial bitte schonend behandeln und innerhalb 3 Wochen wieder zurückgeben. Hochstraße 21 · 92637 Weiden i. d. OPf. Telefon (09 61) 3 89 29 - 0 · Fax (09 61) 3 74 35 E-Mail: [email protected] www.kiessling-werbedruck.de um ihr Hobby ausüben zu können. Zudem kann eine lan- VORWORT ge Warteliste für Kletterkurse nicht abgearbeitet werden. Eine Normalisierung ist leider noch nicht in Sicht. Rechtzeitig möchte ich für die kommenden Wahlen bei unserer Jahreshauptversammlung im Februar 2016 auf zwei neu zu besetzende ehrenamtliche Aufgabenfelder Liebe Sektions- aufmerksam machen. -

Im Winter Erleben! Den Steinwald Mit Seiner Romantisch Verschneiten Winter- Landschaft Erleben Kann Man Am Besten, Wenn Man Sich Die
Für eine Stärkung zwischendurch oder für einen zünftigen Abschluss Ihrer Langlauftour bietet sich die Einkehr in einer der nachstehend genannten Gaststätten an: Pfaben: Waldhaus Hotel „Steinwaldhaus" Harlachberg: Landgasthof „Rosenberger" Friedenfels: „Schlossschänke Friedenfels" Hohenhard: „Marktredwitzer Haus" Fuchsmühl: Gasthof „Hackelstein" Herzogöd: „Heidi's Kaffeestüberl" Pechbrunn: Landgasthof „Obst“ Wiesau: Gaststätte „Sportzentrum“ Und um an Werktagen nicht vor verschlossenen Türen zu stehen, erkundigen Sie sich bitte vor Beginn Ihrer Loipentour über die aktuellen Önungszeiten bzw. Ruhetage der in Frage kommenden Gaststätten. Nähere Angaben zu den Gastronomiebetrieben nden Sie auf den Informationstafeln an den Parkplätzen, bzw. Loipeneinstiegsstellen. Sollten Sie eine Übernachtungsmöglichkeit für einen mehrtägigen Aufenthalt oder auch nur für ein Wochenende suchen, werden Sie sicher im Impressum Zweckgemeinschaft "Steinwaldloipe“ Internetangebot der Steinwald-Allianz unter Erbendorf - Friedenfels - Fuchsmühl - Pechbrunn - Pullenreuth - Waldershof - Wiesau - Naturpark www.steinwald-urlaub.de fündig. Steinwald - Bay. Staatsforsten - Güterverwaltung Friedenfels - Stadt Augsburg (Forst) Geschäftsstelle: Weitere Informationen: Gemeindeverwaltung Fuchsmühl Service-Telefon: 0180 / 57 83 469 Natürlich beraten Sie die Steinwald-Allianz (Tel.: Rathausplatz 1 www.fuchsmuehl.de /steinwaldloipe 95689 Fuchmühl 09682/1822190) und die örtlichen Tourist-Infos Tel. 09634 / 92090 gerne auch individuell. Bildernachweis: Fotolia, Robert Mertl im Winter