Sinekkale – Herberge, Kloster Oder Gutshof?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Hodos Olba 2008
Hodos, T. (2008). Relative ceramic densities in the north-eastern Mediterranean Iron Age. Olba, 16, 57-72. Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication record in Explore Bristol Research PDF-document © 2008 Mersin/Türkiye. University of Bristol - Explore Bristol Research General rights This document is made available in accordance with publisher policies. Please cite only the published version using the reference above. Full terms of use are available: http://www.bristol.ac.uk/red/research-policy/pure/user-guides/ebr-terms/ ISSN 1301 7667 MERSİN ÜNİVERSİTESİ KILIKIA ARKEOLOJİSİNİ ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSIN UNIVERSITY PUBLICATIONS OF THE RESEARCH CENTER OF CILICIAN ARCHAEOLOGY KAAM YAYINLARI OLBA XVI (Offprint) MERSİN 2008 KAAM YAYINLARI OLBA XVI © 2008 Mersin/Türkiye ISSN 1301 7667 OLBA dergisi TÜBİTAK - ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında taranmaktadır. OLBA dergisi hakemlidir ve Mayıs ayında olmak üzere, yılda bir kez basılmaktadır. Published each year in May. KAAM’ın izni olmadan OLBA’nın hiçbir bölümü kopya edilemez. Alıntı yapılması durumunda dipnot ile referans gösterilmelidir. It is not allowed to copy any section of OLBA without the permit of KAAM. OLBA’ya gönderilen makaleler aşağıdaki web adresinde ve bu cildin giriş sayfalarında belirtilen formatlara uygun olduğu taktirde basılacaktır. Articles should be written according the formats mentioned in the following web address. OLBA’nın yeni sayılarında yayınlanması istenen makaleler için yazışma adresi: Correspondance addresses for sending articles to following volumes of OLBA: Prof. Dr. Serra Durugönül Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Çiftlikköy Kampüsü 33342-MERSİN TURKEY Diğer İletişim Adresleri Other Correspondance Addresses Tel: 00.90.324.361 00 01 (10 Lines) 4730 / 4734 Fax: 00.90.324.361 00 46 web mail: www.kaam.mersin.edu.tr e-mail: [email protected] Dağıtım / Distribution Zero Prod. -

Roma Dönemi Doğu Akdeniz Deniz Ticaretinde Kiyi Kilikya Bölgesi'nin Yeri Ve Önemi
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI KLASİK ARKEOLOJİ BİLİM DALI ROMA DÖNEMİ DOĞU AKDENİZ DENİZ TİCARETİNDE KIYI KİLİKYA BÖLGESİ’NİN YERİ VE ÖNEMİ AHMET BİLİR DOKTORA TEZİ Danışman YRD. DOÇ. DR. MEHMET TEKOCAK Konya 2014 II T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Bilimsel Etik Sayfası Adı Soyadı Ahmet Bilir Numarası 104103011001 Ana Bilim / Bilim Dalı Arkeoloji / Klasik Arkeoloji Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Öğrencinin Roma Dönemi Doğu Akdeniz Deniz Ticaretinde Tezin Adı Kıyı Kilikya Bölgesi’nin Yeri Ve Önemi Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Öğrencinin imzası (İmza) III T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Doktora Tezi Kabul Formu Adı Soyadı Ahmet Bilir Numarası 104103011001 Ana Bilim / Bilim Dalı Arkeoloji / Klasik Arkeoloji Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tekocak Tez Danışmanı Öğrencinin Roma Dönemi Doğu Akdeniz Deniz Ticaretinde Tezin Adı Kıyı Kilikya Bölgesi’nin Yeri Ve Önemi Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan Roma Dönemi Doğu Akdeniz Deniz Ticaretinde Kıyı Kilikya Bölgesi’nin Yeri Ve Önemi Yeri başlıklı bu çalışma ……../……../…….. tarihinde yapılan savunma sınavı sonu- cunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Ünvanı, Adı Soyadı Danışman ve Üyeler İmza IV Önsöz Geriye dönüp bakınca hep üniversite yılları, kazılar, bölümün koridorları, dostluklar ve hocalar akla geliyor. Bu süre zarfında hissettiğim duygunun bir tarifi olarak aile sıcaklığı kavramını yakıştırabilirim. -

Maybach Miami Hisart Kilikia Kokular
4/2015 MengerlerYAŞAMIN RENKLERİNİ YANSITIR... Lifestyle Mengerler Lifestyle MAYBACH MIAMI HİSART KİLİKİA YAŞAMIN RENKLERİNİ YANSITIR... RENKLERİNİ YAŞAMIN KOKULAR 4/2015 YILDIZLI HAYATLAR • KÜLTÜR • SANAT • SÖYLEŞİ • GEZİ • LEZZET • SAĞLIK Merhaba saygıdeğer dostlarımız, Her yıl sonu otomotiv sektöründe, yeni modellerin tanıtıldığı heyecanlı, bir o kadar da yoğun günler başlar. Konu Mercedes-Benz olunca da, seçkin müşterilerimiz, sektöre yön verecek yenilikleri bir an önce öğrenmek için showroom’larımıza gelirler. Bizleri mutlu eden bu yoğun ziyaretleriniz için şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek isterim, yeni modellerimiz, ayıracağınız vakte fazlası ile değecektir. Servislerimiz ise araçlarınızı yaklaşan kışa hazırlamak için hizmetinizdedir. Lüks segmentte yepyeni standartlar belirleyen Mercedes-Benz Maybach S-Serisi, hakkında bir an önce bilgi edinmek isteyen okuyucularımız için bu sayımızda işlendi. Amerika’daki konsolosluklarımıza bir yenisi daha eklendi. Türk Hava Yolları, Miami Konsolosluğumuzun açılışı ile birlikte, uzun süredir ara verdiği direkt İstanbul-Miami uçuşlarına tekrar başlıyor. Hal böyle olunca da, kış aylarının vazgeçilmez destinasyonlarından biri olan Miami’yi dergimizin Sanat Yönetmeni Ayşen Gürel Sile sizler için yazdı. Dünyanın ilk diorama müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu ile dergimiz yazarlarından Zeynep Çiftçioğlu keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Gazeteci Yazar Hülya Ekşigil’in söyleşisinde ödüllü Fotoğraf Sanatçısı Ani Çelik Arevyan’ı daha yakından tanıyabilirsiniz. Fotoğrafları Senih Gürmen çekti. Yazarlarımızdan Bünyad Dinç sonbaharda direksiyonunuzu güneye çevirmenizi öneriyor. Hala yazdan kalma günlerin yaşandığı güney bölgemizde deniz, tarih ve keyifli sürüş arayanlar için, ihtişamı ile göz kamaştıran Kilikia Trakheia, yani Dağlık Kilikia hakkında, ayrıntılı bilgi veriyor. Tropikal bölgelerde, ormanların içinde yaşayan orkideler, salonlarımızda başköşeyi hak edecek kadar alımlılar. Ayşen Gürel Sile orkideleri ve bakımlarını anlatırken; keyifli aranjmanlar hazırlayabilmeniz için sizlere ipuçları veriyor. -

Hodos, T. (2008)
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Explore Bristol Research Hodos, T. (2008). Relative ceramic densities in the north-eastern Mediterranean Iron Age. Olba, 16, 57-72. Link to publication record in Explore Bristol Research PDF-document University of Bristol - Explore Bristol Research General rights This document is made available in accordance with publisher policies. Please cite only the published version using the reference above. Full terms of use are available: http://www.bristol.ac.uk/pure/about/ebr-terms.html Take down policy Explore Bristol Research is a digital archive and the intention is that deposited content should not be removed. However, if you believe that this version of the work breaches copyright law please contact [email protected] and include the following information in your message: • Your contact details • Bibliographic details for the item, including a URL • An outline of the nature of the complaint On receipt of your message the Open Access Team will immediately investigate your claim, make an initial judgement of the validity of the claim and, where appropriate, withdraw the item in question from public view. ISSN 1301 7667 MERSİN ÜNİVERSİTESİ KILIKIA ARKEOLOJİSİNİ ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSIN UNIVERSITY PUBLICATIONS OF THE RESEARCH CENTER OF CILICIAN ARCHAEOLOGY KAAM YAYINLARI OLBA XVI (Offprint) MERSİN 2008 KAAM YAYINLARI OLBA XVI © 2008 Mersin/Türkiye ISSN 1301 7667 OLBA dergisi TÜBİTAK - ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında taranmaktadır. OLBA dergisi hakemlidir ve Mayıs ayında olmak üzere, yılda bir kez basılmaktadır. Published each year in May. KAAM’ın izni olmadan OLBA’nın hiçbir bölümü kopya edilemez. -

Bibliographie Zu Kilikien
Bibliographie zu Kilikien Philipp Pilhofer Stand: 30. Mai 2020 (Datenbankversion 3542) Vorwort Diese unvollständige Bibliographie ist Beiprodukt der Vorarbeiten zu meinem patristi- schen Dissertationsprojekt über Kilikien. Die Bibliographie wird stetig erweitert; in Planung ist insbesondere ein geographischer Teil. Für Hinweise jeder Art bin ich dankbar. Münster, 17. Januar 2013 Ph. P. Vorwort zur 2. Auflage Mittlerweile ist das Dissertationsprojekt abgeschlossen und auch schon publiziert (TU 184 und 188). Daß ich mich in besagtem Projekt auf das Rauhe Kilikien konzentriert habe, bringt es mit sich, daß auch diese (weiterhin natürlich unvollständige) Biblio- graphie einen starken westkilikischen Einschlag hat. Eine geographische Unterteilung habe ich nun doch nicht vorgenommen; wer nach einem speziellen Ort sucht, möge das per Suchfunktion innerhalb dieser PDF-Datei tun. Die Abkürzungen richten sich weitgehend nach RGG, vgl. darüber hinaus das Abkürzungsverzeichnis in TU 184. Berlin, 30. Mai 2020 Ph. P. Gesetzt mit LATEX 2" unter Benutzung von biblatex(-dw) und subversion. II Inhaltsverzeichnis 1 Alphabetisch sortierte Bibliographie 1 2 Chronologisch sortierte Bibliographie 42 III 1 Alphabetisch sortierte Bibliographie Hier sind sämtliche Werke alphabetisch sortiert. Die Sortierung folgt den Richtlinien des Duden. [Acta SS Ianuarii II] Acta Sanctorum Ianuarii. Quotquot toto orbe coluntur, vel a Catholicis Scriptoribus celebrantur, quæ ex antiquis monumentis Latinis, Græcis, aliarumque gentium collegit, digessit notis illustravit Ioannes Bollandus Societatis Iesu Theologus, Seruatâ primi- geniâ Scriptorum phrasi. Operam et studium contulit Godefridus Henschenius eiusdem Societatis Theologus. Ianuarii Tomus II. XVI. posteriores dies complectens, Antwerpen 1643. [Acta SS Iunii I] Acta Sanctorum Iunii. Ex Latinis & Græcis aliarumque gentium Monumentis, fervatâ primigeniâ veterum Scriptorum Phrasi, collecta, digesta, Commentariis & Observa- tionibus illustrata, a Godefrido Henschenio P.M., Daniele Papebrochio, Francisco Baertio, et Conradio Janningo. -

Doğu Dağlık Kilikia: Polis-Khora İlişkileri Üzerine İlk Düşünceler1
Colloquium Anatolicum VI 2007 115-179 Doğu Dağlık Kilikia: Polis-Khora İlişkileri Üzerine İlk Düşünceler 1 Hamdi Şahin Giriş-Amaç ve Kapsam Kilikia, coğrafi özellikleri nedeniyle, antik kaynaklarda Ovalık Kilikia2 ( = Lat. Cilicia Campestris) ve Dağlık Kilikia3 (Κιλικία Τραχεῖα = Lat. Cilicia Aspera) olmak üzere iki bölgeye ayrılır. Dağlık Kilikia Bölgesi (Harita 1), doğuda Soli-Pompeiopolis4, batıda Korakesion, kuzeyde ise Toros Dağları ile sınır oluşturmaktadır. Güneyini ise, doğal bir sınır olan Kilikia Denizi5 (=Kilik Ylass) çevreler. Kıbrıs ile Kilikia’nın sahil kesiminin en doğusu arasındaki deniz ise, Ptolemaios tarafından Kilikios Aulon (=likio An) olarak adlandırılmaktadır (Ptolemaios, V, 8.1; V, 14. 4; Ruge 1921a: 390). Dar bir sahil şeridine sahip olan Kilikia Trakheia’nın tarım yapılabilecek toprak alanları azdır (Strabon, XIV, 5.1; Erzen 1940: 31). Buna karşılık, özellikle gemi yapımı için gerekli olan Sedir ağaçları açısından 1 Bu makale 2005-2007 yılları arasında tespit edilen yerleşmelerin küçük bir bölümünü kapsa- maktadır. 2005-2006 yılları arasındaki yüzey araştırmaları Prof. Dr. Mustafa H. Sayar (Proje No: 327/03062005 ve 21229042004), 2007 yılı araştırmaları ise makale yazarının başkanlığında yürü- tülmüştür. Bu vesileyle, 2005-2006 yılı buluntularını değerlendirmeme olanak tanıyan Prof. Sayar’a teşekkürlerimi borç bilirim. 2007 yılı araştırmalarına Afyon Kocatepe Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Selim Pullu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Yüksek Lisans öğrencilerinden, Klasik Filolog Filiz Camgöz, Klasik Filolog Figen Sağlam, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı temsilen ise Fethiye Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Orhan Köse katılmıştır. Tüm ekip üyelerine, uyumlu ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Silifke Orman İşletme Müdürlüğü, Değirmendere İşletme Şefi Sayın Ali İhsan Bakırtaş’a ve Susanoğlu’na bağlı Karadedeli Köyü sakinlerinden Sayın Gazi Cücel’e rehberlikleri için ne kadar teşekkür etsem azdır. -

Alanya Kalesi 2007 Yılı Çalışmaları Work on the Alanya Citadel in 2007
KAZI RAPORLARI / EXCAVATION REPORTS Alanya Kalesi 2007 Yılı Çalışmaları Work on the Alanya Citadel in 2007 M. Oluş ARIK – Z. Kenan BİLİCİ “Alanya Kalesi Kazı ve Onarım Çalışmaları”nın 2007 yılı The 2007 campaign of excavations and repair work on kampanyasına Ağustos ve Eylül ayları boyunca devam the Alanya Citadel was conducted during the months of edilmiştir. August and September. A. Tophane Mahallesi Araştırması A. Survey in the Tophane Mahallesi 2006 yılında kentin alt kesiminde, Tophane Mahallesi’nde In the lower part of the city, we had initiated excavations başladığımız kazı çalışmaları sırasında, harabe konut in the Tophane quarter in 2006 and we continued our alanı ile yerleşimin bulunduğu çevrede gerçekleştirilen research and documentation in the ruined houses and araştırma ve belgelemeye 2007 yılında da devam edil- settlement also during 2007. In addition the present situ- miş; ayrıca Hisariçi Mahallesi’nde de mevcut durum ation of the Hisariçi quarter was re-documented. yeniden belgelenmiştir. During the course of the work the following were Çalışmalar sırasında, “Alanya Kalesi Koruma Amaçlı encountered: a few cisterns and several pieces of archi- İmar Planı”na işlenmemiş birkaç sarnıç ve bazı mimari tectural sculpture as well as some building remains, none plastikler (284 Ada 1 parseldeki konutun duvar dokusu of these were registered in the Construction Programme içinde devşirme olarak kullanılmış ve bir benzerine de for the protection of Alanya Citadel. These include a Hisariçi-Süley maniye Camii’nin bahçe duvarında tesa- -
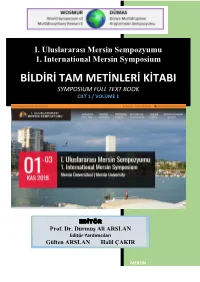
I. Uluslararası Mersin Sempozyumu 1. International Mersin Symposium
I. Uluslararası Mersin Sempozyumu 1. International Mersin Symposium BİLDİRİ TAM METİNLERİ KİTABI SYMPOSIUM FULL TEXT BOOK CİLT 1 / VOLUME 1 EDİTÖR Prof. Dr. Durmuş Ali ARSLAN Editör Yardımcıları Gülten ARSLAN Halil ÇAKIR MERSİN I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium I. Uluslararası Mersin Sempozyumu 1. International Mersin Symposium BİLDİRİ TAM METİNLERİ KİTABI SYMPOSIUM FULL TEXT BOOK CİLT 1 / VOLUME 1 Editör: Prof. Dr. D. Ali ARSLAN Editör Yardımcısı: Gülten ARSLAN Halil ÇAKIR Kapak Tasarımı: Prof. Dr. D. Ali ARSLAN Mizanpaj-Ofset Hazırlık: Prof. Dr. D. Ali ARSLAN © Durmuş Ali ARSLAN Mer Ak Yayınları 2018 – Mersin ISBN: 978-605-89406-8-0 Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Yayınları Adres: Çiftlikköy Mahallesi, 34. Cadde, Nisa 1 Evleri, No: 35, 6/12, Yenişehir/MERSİN Tel: 0532 270 81 45 / 0553 666 06 06 Basım: Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampusu, Mersin. Not: Bölümlerin her türlü idari, akademik ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. 1 I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium ÖNSÖZ Çok Değerli Bilim İnsanları ve Kıymetli Araştırmacılar, Her yıl periyodik olarak düzenlenmesi planlanan Uluslararası Mersin Sempozyumu’nun ilki, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Mersin’de, Mersin Üniversitesi ve Mersin Akademi Danışmanlık iş birliği ile gerçekleştirildi. Sizleri, yılın en güzel döneminde, dünyanın en güzel şehirlerinden biri, Akdeniz’in kalbi Mersin’de ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduk. Bu yıl “Her Yönüyle Mersin” teması ile bir araya geldiğimiz bilgi şölenimizde, Akdeniz’in incisi Mersinimizi, kırsalından kent merkezine, bütün yönleriyle akademik açıdan ele aldık. Tabi ki bu sizlerin etkin katılım ve destekleriyle mümkün oldu. Mersin ve yöresi ile ilgili, çevreden ekonomiye, sağlıktan nükleer enerjiye, tarımdan sanayiye ve ticarete, güzel sanatlardan tarih ve arkeolojiye, sosyolojik yapıdan spor ve sanata, doğa bilimlerinden mühendisliğe her türlü toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda tartışılıp, kayıt altına alınması bu bilgi şöleninin temel amacıdır. -

Scientific Meetings 005.Pdf
THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017) PROCEEDING BOOK 28-30 September 2017 - Mersin/TURKEY 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2017) BİLDİRİLER KİTABI 28-30 Eylül 2017 - Mersin/TÜRKİYE Editor/Editör: Prof. Dr. Kemal BİRDİR Co-Editors/Editör Yardımcıları: Doç. Dr. Erdinç KARADENİZ Doç. Dr. Levent KOŞAN Yrd. Doç. Dr. Beril DÖNMEZ Arş. Gör. Ozan GÜLER Arş. Gör. Ali DALGIÇ Arş. Gör. Sercan BENLİ Arş. Gör. Fatih GÜNAY Prepare for Publication/Yayına Hazırlayanlar Arş. Gör. Dr. Tuğba PALA MORKOÇ Arş. Gör. Elif BAK Arş. Gör. Mehmet BEYAZGÜL Arş. Gör. Mehtap ÖZKAN BUZLU Arş. Gör. Gizem ÇAPAR Arş. Gör. Burhan ÇINAR Arş. Gör. Selda DALAK Arş. Gör. Ahmet ERDEM Arş. Gör. Anıl KALE Arş. Gör. Muhammed A. KINIKLI Arş. Gör. Aykut SOYLU Arş. Gör. Ferhat ŞEKER Arş. Gör. Neslihan ŞİMŞEK Arş. Gör. Derya TOKSÖZ Mersin Üniversitesi Yayınları Yayın No : 48 ME.Ü. Turizm Fakültesi Yayınları Yayın No : 1 ISBN : 978-975-6900-56-7 Mersin Üniversitesi Yayınları Her hakkı saklıdır. Yazarından ve yayınevinden yazılı izin alınmaksızın bu kitabın fotokopi veya diğer yollarla kısmen veya tamamen çoğaltılması, basılması ve yayınlanması yasaktır. Aksine davranış, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince, 5 yıla kadar hapis ve adli para cezaları ile fotokopi ve basım aletlerine el konulmasını gerektirir. Dizgi : Hakan KURTCAN Kapak Tasarım : Hakan KURTCAN Baskı : 1. Basım Yayın Yılı ve Yeri : 2017, Mersin/TÜRKİYE Bu kitap, “1. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi” organizasyonu kapsamında yayımlanmıştır. Bu kitapta yayımlanan tüm bildirilerin içeriklerinden yazarları sorumludur. Bildiriler yazar(lar)ın kendi düşüncelerini yansıtmaktadır. -

Silifke'nin Tarihi Ve Turistik Yerleri Atatürk Evi Müzesi
SİLİFKE’NİN TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ ATATÜRK EVİ MÜZESİ Büyük Atatürk, Silifke’ye olan ilgisini burayı dört defa şereflendirerek göstermiştir. Ulu Önder, Silifke’yi ziyaretlerinden birinde burada bir çiftlik satın almış ve merkezi bu çiftlik olmak üzere bir Tarım Kredi Kooperatifi kurulması için talimat vererek kendileri de bu kuruluşun 1 no’lu üyesi olmuştur. Atatürk, Silifke’ye ve Silifkelilere olan sevgisini, Silifke İdman Yurdu’nu ziyaretinde, şeref defterine yazdığı şu ibarelerle belirtmiştir: “Silifke’ye geldiğimden çok memnunum. Beni unutmayacağınızı bilirim. Sizi kalbimden çıkarmam. Gazi Mustafa Kemal “ Ata’nın Silifke’ye ilk gelişlerinde (27 Ocak 1925) gecelediği ev bugün restore edilmiş; kullandığı eşyalar sergilenerek Atatürk Evi Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. SİLİFKE MÜZESİ Taşucu yolu üzerinde bulunan Silifke Müzesinin iki katlı teşhir binası ve avlusunda çeşitli dönemlere ait yörede bulunmuş altın, gümüş, bronz sikke ve eşyalar, seramikler, mermer büst ve heykeller, lahitler ve diğer tarihi bulguların yanı sıra Etnografik parçalar da sergilenmektedir. SİLİFKE KALESİ Temel tespitlerine göre Helenistik veya erken Roma dönemine ait olduğu anlaşılan kale, geçirdiği onarım ve değişiklikler sonucu bugün bir Ortaçağ kalesi görünümündedir. Silifke’ye hakim, 185 m yüksekliğinde bir tepe üzerinde yapılmış olan, etrafı kuru hendekle çevrili oval biçimdeki kalenin içinde kemerli galeriler, su sarnıçları, depolar ve diğer yapı kalıntıları bulunmaktadır. Ünlü gezgin Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, XVII. yy’da Silifke Kalesi’nin 23 burcu olduğunu, içinde bir cami ve 60 ev bulunduğunu yazar. Ancak, burçların bir kısmı ve kale içi tamamen yıkık durumda olduğundan tam tespiti yapmak mümkün değildir. Halen görülebilen 10 adet burç mevcuttur. TAŞKÖPRÜ Şehir merkezinin ortasından geçen Göksu (Kalykadnus) Nehri’nin üzerindedir. İ.S. -

Tarsus Republic Square Late Roman Cooking Wares - 2001
TARSUS REPUBLIC SQUARE LATE ROMAN COOKING WARES - 2001 A Master’s Thesis by ÇİĞDEM TOSKAY EVRİN Department of Archaeology and History of Art Bilkent University Ankara May 2002 To Volkan Evrin TARSUS REPUBLIC SQUARE LATE ROMAN COOKING WARES - 2001 The Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University by ÇİĞDEM TOSKAY EVRİN In Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of MASTER OF ARTS IN ARCHAEOLOGY AND HISTORY OF ART in THE DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY AND HISTORY OF ART BİLKENT UNIVERSITY ANKARA May 2002 I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Master of Archaeology and History of Art. --------------------------------- Doç. Dr. Marie-Henriette Gates Supervisor I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Master of Archaeology and History of Art. --------------------------------- Dr. Jacques Morin Examining Committee Member I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Master of Archaeology and History of Art. --------------------------------- Prof. Dr. Levent Zoroğlu Examining Committee Member Approval of the Institute of Economics and Social Sciences --------------------------------- Prof. Dr. Kürşat Aydoğan Director ABSTRACT TARSUS REPUBLIC SQUARE LATE ROMAN COOKING WARES - 2001 Toskay Evrin, Çiğdem Department of Archaeology and History of Art Supervisor: Dr. Marie-Henriette Gates Co- Supervisor: Prof. Dr. Levent Zoroğlu Co- Supervisor: Dr. Jacques Morin May 2002 This thesis deals with the Cooking Wares of the Tarsus Republic Square uncovered during the 2001 Season. -

Silifke Ve Dolaylarinda Yapilan Topraküstü Arkeolojik Arastirmalar Raporu (1978)
Raporlar: SILIFKE VE DOLAYLARINDA YAPILAN TOPRAKÜSTÜ ARKEOLOJIK ARASTIRMALAR RAPORU (1978) Prof. Dr. SEMAV~~ EY~CE Türkiye'nin güneyinde Silifke ve çevresinde yapt~~~ m~z toprak- üstü arkeolojik inceleme ve ara~t~rmalara 1972 y~l~ nda ba~lanarak, her y~l (yaln~z K~ br~s harekat~~ yüzünden ~~ 974 y~l~~ hariç kalmak üzere) buradaki çal~~malar sürdürülmü~tür. ~imdiye kadar bu bölge ve bunun bilhassa Ta~l~ k Kilikya (Cilicia Thracheia) denilen kesimi pek çok ara~t~ r~c~~ taraf~ ndan görülmü~~ olmakla beraber, bugüne kadar yay~ nlanan yaz~ lar~ n bu bölgenin tarihi ve arkeolojik an~ tlar~ n~~ yeteri kadar ortaya koyamad~~~~ ve hatta pek çok eserin hiç dikkati çekmedi~i ve dolay~siyle tan~ t~lmad~~~~ ortaya ç~ kmaktad~r. Güney Anadolu'nun bu bölgesi üzerinde inceleme gezileri yapan ve gördüklerini birçok hallerde eski eserleri de ihmal etmeksizin yazan P. de Tchihatcheffi veya F. Schaffer 2 gibi co~rafyac~lar ile hemen her ~ey ile ilgilenen, ~ ~~ F. Beaufort 3, W. M. Leake 4, C. L. Irby 5 ve daha ba kalar gibi seyyahlar~~ bir tarafa b~ rakacak olursak, bu bölgede en çok kitabe toplay~c~lar~ n (epigrafist) çal~~t~ klar~~ dikkati çeker. Yaln~z bu seyyah- lar~n aras~ nda, Frans~z V. Langlois'n~ n, bu bölgeyi ilk olarak çok ayr~nt~l~~ biçimde kitabeleri ve eski eserleri ile inceleyip yay~ nlayan P. de Tchihatcheff, Lettre sur les AntiquWs de P Asie Mineure adress6e .?t M. Mohl, "journal Asiatique" 5. seri, IV (1854) bilhassa s. 114-138; ay, yaz., Reisen in Klein Asien und Armenien 1847-1863, Itinerare redigirt und mit einer neuen Construction der Karte von Kleinasien von H.