Die Deutsche Jugendbewegung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Chapter 5. Between Gleichschaltung and Revolution
Chapter 5 BETWEEN GLEICHSCHALTUNG AND REVOLUTION In the summer of 1935, as part of the Germany-wide “Reich Athletic Com- petition,” citizens in the state of Schleswig-Holstein witnessed the following spectacle: On the fi rst Sunday of August propaganda performances and maneuvers took place in a number of cities. Th ey are supposed to reawaken the old mood of the “time of struggle.” In Kiel, SA men drove through the streets in trucks bearing … inscriptions against the Jews … and the Reaction. One [truck] carried a straw puppet hanging on a gallows, accompanied by a placard with the motto: “Th e gallows for Jews and the Reaction, wherever you hide we’ll soon fi nd you.”607 Other trucks bore slogans such as “Whether black or red, death to all enemies,” and “We are fi ghting against Jewry and Rome.”608 Bizarre tableau were enacted in the streets of towns around Germany. “In Schmiedeberg (in Silesia),” reported informants of the Social Democratic exile organization, the Sopade, “something completely out of the ordinary was presented on Sunday, 18 August.” A no- tice appeared in the town paper a week earlier with the announcement: “Reich competition of the SA. On Sunday at 11 a.m. in front of the Rathaus, Sturm 4 R 48 Schmiedeberg passes judgment on a criminal against the state.” On the appointed day, a large crowd gathered to watch the spectacle. Th e Sopade agent gave the setup: “A Nazi newspaper seller has been attacked by a Marxist mob. In the ensuing melee, the Marxists set up a barricade. -

Apalast Schlafen Haben Was Verf
Zeitschri des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte Rechts R geschichte g Rechtsgeschichte www.rg.mpg.de http://www.rg-rechtsgeschichte.de/rg2 Rg 2 2003 231 – 234 Zitiervorschlag: Rechtsgeschichte Rg 2 (2003) http://dx.doi.org/10.12946/rg02/231-234 Iring Fetscher Deckname Z. Dieser Beitrag steht unter einer Creative Commons cc-by-nc-nd 3.0 231 Deckname Z. * Das »Office for Strategic Studies« (OSS) hochrangigen Kriegsgefangenen und Kommu- wurde erst 1942, ein Jahr nach Kriegseintritt nisten bestehenden »Nationalkomitees Freies der USA geschaffen, es war ein Vorläufer des Deutschland« in den USA unter deutschen Emig- CIA. Seine Aufgaben bestanden nicht allein in ranten und in der Öffentlichkeit gemacht hatte. der Beschaffung von Informationen über den Bemühungen, ein ähnlich glaubwürdig demo- Zustand der feindlichen Streitkräfte in Europa kratisches Manifest zustande zu bringen, schei- und Asien, sondern unter anderem auch in der terten schließlich daran, dass Thomas Mann sich Entwicklung von Möglichkeiten und Vorstel- im letzten Augenblick der Mitarbeit entzog. lungen für die – nach erfolgreicher Beendigung Erika Mann veröffentlichte zur gleichen Zeit der Kämpfe – einsetzende Aufbauarbeit in den einen Artikel in der Exilzeitung »Aufbau«, in zu besetzenden Ländern. Dieser Aufgabe diente dem sie den samt und sonders nazistisch ge- auch die Beauftragung Carl Zuckmayers mit wordenen Deutschen so gut wie alles Recht auf einem informativen Bericht über die politische eine ersprießliche Zukunft absprach. Auf diesen und moralische Zuverlässigkeit, oder wenigstens Artikel antwortete Zuckmayer in einem »offe- »Brauchbarkeit« von Angehörigen der künstle- nen Brief« im gleichen Blatt und verteidigte die rischen Elite, soweit sie im Deutschen Reich Notwendigkeit, zwischen verantwortlichen und geblieben war; brauchbar nämlich für Betei- schuldigen Nazis auf der einen Seite und anderen ligung am kulturellen Leben in einem neuen, Deutschen zu unterscheiden. -

INFORMATION to USERS the Most Advanced Technology Has Been Used to Photo Graph and Reproduce This Manuscript from the Microfilm Master
INFORMATION TO USERS The most advanced technology has been used to photo graph and reproduce this manuscript from the microfilm master. UMI films the original text directly from the copy submitted. Thus, some dissertation copies are in typewriter face, while others may be from a computer printer. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyrighted material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are re produced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each oversize page is available as one exposure on a standard 35 mm slide or as a 17" x 23" black and white photographic print for an additional charge. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. 35 mm slides or 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. AccessingiiUM-I the World's Information since 1938 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA Order Number 8812304 Comrades, friends and companions: Utopian projections and social action in German literature for young people, 1926-1934 Springman, Luke, Ph.D. The Ohio State University, 1988 Copyright ©1988 by Springman, Luke. All rights reserved. UMI 300 N. Zeeb Rd. Ann Arbor, MI 48106 COMRADES, FRIENDS AND COMPANIONS: UTOPIAN PROJECTIONS AND SOCIAL ACTION IN GERMAN LITERATURE FOR YOUNG PEOPLE 1926-1934 DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University By Luke Springman, B.A., M.A. -

The Experience of the German Soldier on the Eastern Front
AUTONOMY IN THE GREAT WAR: THE EXPERIENCE OF THE GERMAN SOLDIER ON THE EASTERN FRONT A THESIS IN History Presented to the Faculty of the University Of Missouri-Kansas City in partial fulfillment of The requirements for the degree MASTER OF ARTS By Kevin Patrick Baker B.A. University of Kansas, 2007 Kansas City, Missouri 2012 ©2012 KEVIN PATRICK BAKER ALL RIGHTS RESERVED AUTONOMY IN THE GREAT WAR: THE EXPERIENCE OF THE GERMAN SOLDIER ON THE EASTERN FRONT Kevin Patrick Baker, Candidate for the Master of Arts Degree University of Missouri-Kansas City, 2012 ABSTRACT From 1914 to 1919, the German military established an occupation zone in the territory of present day Poland, Lithuania, and Latvia. Cultural historians have generally focused on the role of German soldiers as psychological and physical victims trapped in total war that was out of their control. Military historians have maintained that these ordinary German soldiers acted not as victims but as perpetrators causing atrocities in the occupied lands of the Eastern Front. This paper seeks to build on the existing scholarship on the soldier’s experience during the Great War by moving beyond this dichotomy of victim vs. perpetrator in order to describe the everyday existence of soldiers. Through the lens of individual selfhood, this approach will explore the gray areas that saturated the experience of war. In order to gain a better understanding of how ordinary soldiers appropriated individual autonomy in total war, this master’s thesis plans to use an everyday-life approach by looking at individual soldiers’ behaviors underneath the canopy of military hegemony. -

The Hitler Youth Movement, 1933-1945
Loyola University Chicago Loyola eCommons Master's Theses Theses and Dissertations 1954 The Hitler Youth Movement, 1933-1945 Forest Ernest Barber Loyola University Chicago Follow this and additional works at: https://ecommons.luc.edu/luc_theses Part of the History Commons Recommended Citation Barber, Forest Ernest, "The Hitler Youth Movement, 1933-1945" (1954). Master's Theses. 905. https://ecommons.luc.edu/luc_theses/905 This Thesis is brought to you for free and open access by the Theses and Dissertations at Loyola eCommons. It has been accepted for inclusion in Master's Theses by an authorized administrator of Loyola eCommons. For more information, please contact [email protected]. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License. Copyright © 1954 Forest Ernest Barber • A 'fHBSIS BUB.\{l'n'ED TO nm 'ACULT! OJ' THE ClRAOOAft SOHOOL 0' LOIOLA UNlftlSITY IN fA.BfIAL JULFU,z,MSIT OF 'DIS DQUlrw&NTS FOR 'l'BE l'lIGIIIt or *~aO'A~ . A Good Oull,"Y)e For ~ I=-uture TheSIS / 1922. ae .. pwlua,*, fItoa 1IDeae1aer Publ1c High Scbool, leaualaer, Ind1aDlt June, 19lil, and. troa Ju\l.a> tJn1'ftft1t1'. I.Uan.poU., IDd:5u., June, 1945, w1tth the de&:&'ee of Baohelor of Sc1-... FI"OJI 1945 to 19la6 the author taUlh' 1ft aa.-, CUba. r.om 11&16 to 1948 he taught in'tbeU, QfteoeJ ard btoa 1948 tto 19S1 M acted. .. 8D Educa\i.or& Adv.1.r 1n the Troop Infonatial and Ed.... t14n Propaa, tl'D1tecl statM AJ:vlT of OCovpa1d.OD, ~. ForeA Emen ~ 'bepn bJ.a pa4uate durU.. -

Kevin John Crichton Phd Thesis
'PREPARING FOR GOVERNMENT?' : WILHELM FRICK AS THURINGIA'S NAZI MINISTER OF THE INTERIOR AND OF EDUCATION, 23 JANUARY 1930 - 1 APRIL 1931 Kevin John Crichton A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of St Andrews 2002 Full metadata for this item is available in St Andrews Research Repository at: http://research-repository.st-andrews.ac.uk/ Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10023/13816 This item is protected by original copyright “Preparing for Government?” Wilhelm Frick as Thuringia’s Nazi Minister of the Interior and of Education, 23 January 1930 - 1 April 1931 Submitted. for the degree of Doctor of Philosophy at the University of St. Andrews, 2001 by Kevin John Crichton BA(Wales), MA (Lancaster) Microsoft Certified Professional (MCP) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) (c) 2001 KJ. Crichton ProQuest Number: 10170694 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest 10170694 Published by ProQuest LLO (2017). Copyright of the Dissertation is held by the Author’. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code Microform Edition © ProQuest LLO. ProQuest LLO. 789 East Eisenhower Parkway P.Q. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106- 1346 CONTENTS Abstract Declaration Acknowledgements Abbreviations Chapter One: Introduction 1 Chapter Two: Background 33 Chapter Three: Frick as Interior Minister I 85 Chapter Four: Frick as Interior Ministie II 124 Chapter Five: Frickas Education Miannsti^r' 200 Chapter Six: Frick a.s Coalition Minister 268 Chapter Seven: Conclusion 317 Appendix Bibliography 332. -

L-G-0011155538-0030615265.Pdf
Ulrich Herrmann Vom HJ-Führer zur Weißen Rose Materialien zur Historischen Jugendforschung Herausgegeben von Ulrich Herrmann Ulrich Herrmann Vom HJ-Führer zur Weißen Rose Hans Scholl vor dem Stuttgarter Sondergericht 1937/38 Mit einem Beitrag von Eckard Holler über die Ulmer „Trabanten“ Die Autoren Ulrich Herrmann, Jg. 1939, Promotion Köln 1969, Habilitation Tübingen 1975, dort Professor für Allgemeine und Historische Pädagogik bis 1994, bis 2004 Professor für Schulpädagogik an der Universität Ulm. Derzeitige Arbeitsschwerpunkte: Geschichte der Jugendkulturen im 20. Jahrhundert, Bildungspolitik, Schulentwicklung und Schulbau; Neurodidaktik. Eckhard Holler, Jg. 1941, Gymnasiallehrer i.R.; Zugehörigkeit zu Jugend- bünden: BDP, Deutsche Jungenschaft e.V. in Karlsruhe 1955–1969; Studium: Germanistik, Philosophie, Sport. Gründung und Leitung Club Voltaire Tübingen 1970–1987, Tübinger Folk- und Liedermacher- Festival 1975–1987. Arbeitsschwerpunkte: Biographie von Eberhard Koebel (tusk); Dokumentation der Jungenschaftsbewegung nach 1945; Das Folk-Revival der 1970/80er Jahre in der BRD. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. © 2012 Beltz Juventa · Weinheim und Basel www.beltz.de · www.juventa.de Druck und Bindung: Beltz Druckpartner GmbH & Co. KG, Hemsbach Printed in Germany ISBN 978-3-7799-5040-0 Warnungen hat er in den Wind geschlagen. Bis die Gestapo ihn für eine Woche einsperrte. Da begriff er und brachte seine Gefühle auf den Stand der Dinge. -
Experimental Schools in Germany
"1~1u German Educational Reconstruction No.1 Experimental Schools in Germany by MINNA SPECHT and ALFONS ROSENBERG One Shilling and Sixpence net THIS partlphlet is published by a body known as German Educational Reconstruction, or "G.E.R.". This organisation came into existence in February 1943, when a number of British persons decided to offer some German educationists in this country an opportunity of keeping abreast of educational thought and practice until the time when they would return to their own country and assist with its reconstruction. This British group discovered that a small group of Germans were already at work on the same problem. The two bodies decided to co-operate to form G.E.R., which now consists of a Board, predominantly British, and a Standing Committee, pre dominantly German. G.E.R. is an independent body. It has no outside affiliations and is not working under official auspices. Both the Board and the Standing Committee consist of persons of various shades of political thought .. The whole structure of G.E.R. is held together by a common purpose: to contribute to the building up of a democratic system of education in Germany. The authors of this pamphlet are alone responsible for its contents. The responsi bility of G.E.R. as a body is limited to sponsoring the publication. Further information about G.E.R. may be obtained from the Secretary, So Fellows Road, London, N.W.J. CONTENTS PRIVATE BOARDING SCHOOLS by MINNA SPECHT I. Introduction 3 II. Die Landerziehungsheime (Hermann Lietz) 4 III. Wickersdorf (Gustav Wynecken) .8 IV. -

5. Institut Für Germanistik: Teilfächer I–V
Universität Regensburg Philosophische Fakultät IV Sprach- und Literaturwissenschaften Institut für Germanistik Die Institutsleitung K O M M E N T A R E zu den Lehrveranstaltungen Sommersemester 2003 Deutsche Sprachwissenschaft Ältere deutsche Literaturwissenschaft Neuere deutsche Literaturwissenschaft Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Deutsch als Fremdsprachenphilologie INHALT Seite 1. TERMINE ......................................................................................................... 3 2. SPRECHSTUNDEN ........................................................................................ 5 3. GESCHÄFTSZEITEN DER SEKRETARIATE .......................................... 5 4. PRÜFUNGSORDNUNGEN ............................................................................ 6 5. INSTITUT FÜR GERMANISTIK: TEILFÄCHER I–V ......................................................................................... 6 6. DIE STUDIENGÄNGE ................................................................................... 6 (1) Deutsch für das Lehramt an Gymnasien (vertieft studiert) ................... 6 (2) Deutsche Philologie im Magisterstudiengang (vertieft studiert) ........... 8 (3) Deutsch für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen (nicht vertieft studiert) ............................................................................... 10 (4) Deutsch im Rahmen der Fächergruppe der Hauptschule ...................... 11 (5) Deutsch im Rahmen der Didaktik der Grundschule .............................. 11 7. LEHRVERANSTALTUNGEN -
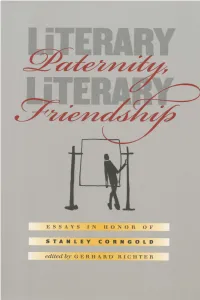
9781469658254 WEB.Pdf
Literary Paternity, Literary Friendship From 1949 to 2004, UNC Press and the UNC Department of Germanic & Slavic Languages and Literatures published the UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures series. Monographs, anthologies, and critical editions in the series covered an array of topics including medieval and modern literature, theater, linguistics, philology, onomastics, and the history of ideas. Through the generous support of the National Endowment for the Humanities and the Andrew W. Mellon Foundation, books in the series have been reissued in new paperback and open access digital editions. For a complete list of books visit www.uncpress.org. Literary Paternity, Literary Friendship Essays in Honor of Stanley Corngold edited by gerhard richter UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures Number 125 Copyright © 2002 This work is licensed under a Creative Commons cc by-nc-nd license. To view a copy of the license, visit http://creativecommons. org/licenses. Suggested citation: Richter, Gerhard. Literary Paternity, Liter- ary Friendship: Essays in Honor of Stanley Corngold. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002. doi: https://doi.org/ 10.5149/9780807861417_Richter Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Richter, Gerhard, editor. Title: Literary paternity, literary friendship : essays in honor of Stanley Corngold / edited by Gerhard Richter. Other titles: University of North Carolina studies in the Germanic languages and literatures ; no. 125. Description: Chapel Hill : University of North Carolina Press, [2002] Series: University of North Carolina studies in the Germanic languages and literatures | Includes bibliographical references. Identifiers: lccn 2001057825 | isbn 978-1-4696-5824-7 (pbk: alk. paper) | isbn 978-1-4696-5825-4 (ebook) Subjects: German literature — History and criticism. -

Tanze, Wie Du Bist!
Alexander Priebe „Tanze, wie du bist!“ 100 Jahre Tanzpädagogik an der Odenwaldschule Abstract Rhythmische Gymnastik, Jazz-, Gesellschafts- oder Moderner Tanz sind heute Inhalte des Sportunterrichts und auch der praktischen Abiturprüfung geworden. So steht es in den reformierten Lehrplänen nahezu aller deutschen Bundesländer. Sich körperlich ausdrücken und eine Bewegung tänzerisch gestalten zu können, sind pädagogisch wertvolle sportliche Aktivitäten. Der Weg zur pädagogischen Wertschätzung von Gymnastik und Tanz in der Schule war aber ein lang dauernder Prozess, zu dominant waren das deutsche Turnen und der moderne Sport zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dass Gymnastik und Tanz ein Teil schulischer Leibeserziehung wurden, ist auch der Lebensreform- und Kunsterziehungsbewegung und den Schulen der Reformpädagogik zu verdanken. Mit ihrem Anspruch, den einzelnen Heranwachsenden in seiner Kreativität und Individualität zu fördern, gewannen auch die Körper- und Bewegungskonzepte von Gymnastik und Tanz an Bedeutung. Im Folgenden soll dies an der Rezeption der Gymnastik- und Tanzbewegung seit dem ausgehenden Kaiserreich bis in die Gegenwart an der Odenwaldschule nachvollzogen werden. Rhythmische Gymnastik, Jazz-, Gesellschafts- oder Moderner Tanz sind heute Inhalte des Sportunterrichts und auch der praktischen Abiturprüfung geworden. So steht es in den reformierten Lehrplänen nahezu aller deutschen Bundesländer. Sich körperlich ausdrücken und eine Bewegung tänzerisch gestalten zu können, sind pädagogisch wertvolle sportliche Aktivitäten. Der Weg zur pädagogischen Wertschätzung von Gymnastik und Tanz in der Schule war aber ein lang dauernder Prozess, zu dominant waren das deutsche Turnen und der moderne Sport zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dass Gymnastik und Tanz ein Teil schulischer Leibeserziehung wurden, ist auch der Lebensreform- und Kunsterziehungsbewegung und den Schulen der Reformpädagogik zu verdanken. -
The White Rose in Cooperation With: Bayerische Landeszentrale Für Politische Bildungsarbeit the White Rose
The White Rose In cooperation with: Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit The White Rose The Student Resistance against Hitler Munich 1942/43 The Name 'White Rose' The Origin of the White Rose The Activities of the White Rose The Third Reich Young People in the Third Reich A City in the Third Reich Munich – Capital of the Movement Munich – Capital of German Art The University of Munich Orientations Willi Graf Professor Kurt Huber Hans Leipelt Christoph Probst Alexander Schmorell Hans Scholl Sophie Scholl Ulm Senior Year Eugen Grimminger Saarbrücken Group Falk Harnack 'Uncle Emil' Group Service at the Front in Russia The Leaflets of the White Rose NS Justice The Trials against the White Rose Epilogue 1 The Name Weiße Rose (White Rose) "To get back to my pamphlet 'Die Weiße Rose', I would like to answer the question 'Why did I give the leaflet this title and no other?' by explaining the following: The name 'Die Weiße Rose' was cho- sen arbitrarily. I proceeded from the assumption that powerful propaganda has to contain certain phrases which do not necessarily mean anything, which sound good, but which still stand for a programme. I may have chosen the name intuitively since at that time I was directly under the influence of the Span- ish romances 'Rosa Blanca' by Brentano. There is no connection with the 'White Rose' in English history." Hans Scholl, interrogation protocol of the Gestapo, 20.2.1943 The Origin of the White Rose The White Rose originated from individual friend- ships growing into circles of friends. Christoph Probst and Alexander Schmorell had been friends since their school days.