Dörr, G. München
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
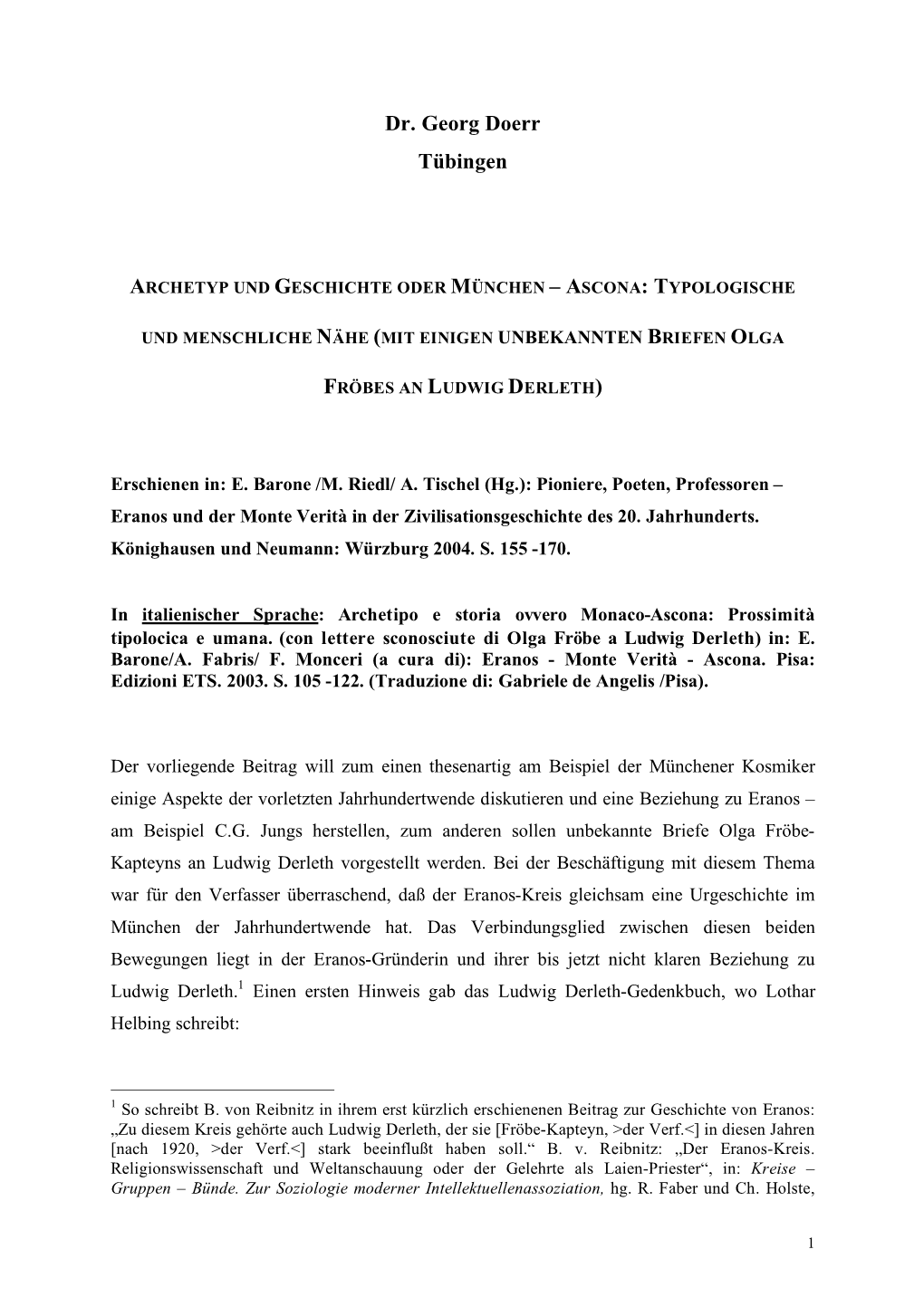
Load more
Recommended publications
-

200 Da-Oz Medal
200 Da-Oz medal. 1933 forbidden to work due to "half-Jewish" status. dir. of Collegium Musicum. Concurr: 1945-58 dir. of orch; 1933 emigr. to U.K. with Jooss-ensemble, with which L.C. 1949 mem. fac. of Middlebury Composers' Conf, Middlebury, toured Eur. and U.S. 1934-37 prima ballerina, Teatro Com- Vt; summers 1952-56(7) fdr. and head, Tanglewood Study munale and Maggio Musicale Fiorentino, Florence. 1937-39 Group, Berkshire Music Cent, Tanglewood, Mass. 1961-62 resid. in Paris. 1937-38 tours of Switz. and It. in Igor Stravin- presented concerts in Fed. Repub. Ger. 1964-67 mus. dir. of sky's L'histoire du saldai, choreographed by — Hermann Scher- Ojai Fests; 1965-68 mem. nat. policy comm, Ford Found. Con- chen and Jean Cocteau. 1940-44 solo dancer, Munic. Theater, temp. Music Proj; guest lect. at major music and acad. cents, Bern. 1945-46 tours in Switz, Neth, and U.S. with Trudy incl. Eastman Sch. of Music, Univs. Hawaii, Indiana. Oregon, Schoop. 1946-47 engagement with Heinz Rosen at Munic. also Stanford Univ. and Tanglewood. I.D.'s early dissonant, Theater, Basel. 1947 to U.S. 1947-48 dance teacher. 1949 re- polyphonic style evolved into style with clear diatonic ele- turned to Fed. Repub. Ger. 1949- mem. G.D.B.A. 1949-51 solo ments. Fel: Guggenheim (1952 and 1960); Huntington Hart- dancer, Munic. Theater, Heidelberg. 1951-56 at opera house, ford (1954-58). Mem: A.S.C.A.P; Am. Musicol. Soc; Intl. Soc. Cologne: Solo dancer, 1952 choreographer for the première of for Contemp. -
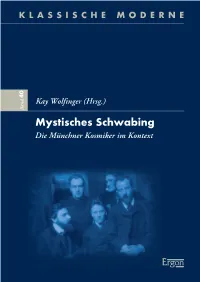
Klassmod 40 Wolfinger 654-3.Indd
KLASSISCHE MODERNE 40 40 ISSN 1863-9585 Kay Wolfinger (Hrsg.) Band Band Mystisches Schwabing Die Münchner Kosmiker im Kontext ISBNISBN 978-3-95650-654-3 978-3-95650-519-5 Kay Wolfinger (Hrsg.) Mystisches Schwabing https://www.nomos-shop.de/titel/mystisches-schwabing-id-87135/ Mystisches Schwabing Die Münchner Kosmiker im Kontext herausgegeben von Kay Wolfinger https://www.nomos-shop.de/titel/mystisches-schwabing-id-87135/ KLASSISCHE MODERNE herausgegeben von Achim Aurnhammer, Werner Frick, Dieter Martin, Mathias Mayer Band 40 ERGON VERLAG https://www.nomos-shop.de/titel/mystisches-schwabing-id-87135/ Mystisches Schwabing Die Münchner Kosmiker im Kontext herausgegeben von Kay Wolfinger ERGON VERLAG https://www.nomos-shop.de/titel/mystisches-schwabing-id-87135/ Gedruckt mit Unterstützung der Fritz Thyssen Stiftung Umschlagabbildung: Unbekannter Fotograf: Karl Wolfskehl, Alfred Schuler, Ludwig Klages, Stefan George und Albert Verwey, 1902. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Ergon – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2020 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb des Urheberrechtsgesetzes bedarf der Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen jeder Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für Einspeicherungen in elektronische Systeme. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier. Gesamtverantwortung für Druck und Herstellung bei der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. Umschlaggestaltung: Jan von Hugo www.ergon-verlag.de ISBN 978-3-95650-654-3 (Print) ISBN 978-3-95650-655-0 (ePDF) ISSN 1863-9585 https://www.nomos-shop.de/titel/mystisches-schwabing-id-87135/ Inhalt Kay Wolfinger Einladung ins mystische Schwabing – Einführung in die Thematik des Bandes .............................................................................. -

Faustus References
THIS DOCUMENT PROVIDES VARIOUS AIDS FOR READERS OF JOHN WOOD’S TRANSLATION OF THOMAS MANN’S DOCTOR FAUSTUS: CHAPTER-BY-CHAPTER SUMMARY 1 CHRONOLOGY OF ADRIAN LEVERKÜHN’S LIFE 5 SOME OF THE REFERENCES IN DOKTOR FAUSTUS 6 VARIOUS ILLUSTRATIONS FROM ALBRECHT DÜRER 20 CONTENTS OF THOMAS MANN’S DR. FAUSTUS Chapter I: The narrator, Serenus Zeitblom (SZ), introduces himself. Begins writing in May of 1943, 2 years after Adrian Leverkühn’s death. He is uncertain about his qualifications for writing AL’s biography. He loved AL, but the latter was surrounded by coldness. Chapter II: SZ continues self-description. He was born in 1883 in Kaisersaschern on the Saale River near Merseburg, where AL later attended school. AL belonged to the Protestant majority; SZ Catholic. AL a humanist, a friend of reason, fine arts, the world of the human spirit. He is retired from teaching classical languages at a Gymnasium. He and his wife, Helene, have two sons and a daughter. Although musical — he plays the viola — he is wary of music’s demonic side. Chapter III: AL’s family descended from farmer’s and craftsmen. His parents Jonathan and Elsbeth have a farm, Buchel, in Weißenfels, near Kaisersaschern. A brother is also a farmer. His sister is Ursel. Jonathan reads the Luther-Bible but is also interested in mystical science. He studies fantastical, ambiguous creatures, such as beautiful but poisonous butterflies and seashells apparently inscribed by nature. One butterfly, Heatera esmeralda, protects itself by looking like a leaf. Another interest is the problematic boundary between organic and inorganic beings. -

Dalla Visione Al Chiodo. Dal Chiodo Alla Visione
Quaderni del «Bollettino Storico della Svizzera Italiana» - 12 A cura di Claudia Lafranchi Cattaneo e Andreas Schwab del «Bollettino Storico Dalla visione al chiodo. Quaderni della Svizzera Italiana» Dal chiodo alla visione 12 Il Fondo Harald Szeemann dell’Archivio Fondazione Monte Verità Nem num esto optas cum debitium, cones reptatur sit voluptasinum que pro tet accatae pre, B volut venis ratiant expliaeped es alic to bea dit unt, quia qui quiam fugition etur? Qui utem A iusdam et quam rereptatum doluptat aboreptat voluptas sin culpa el molore ne conet imoluptas HW C dem esciis iure, vellaut fuga. Ut rem dolectem re et omnihil ius ent. S Optus aut et, asin niminve ndiscillam ab invendaepre coratio te nobitam consequi sequi idiossi – disit repedi voluptas ius, odisseque dent ut mintium nonsed que pa ipsaerum int, consequi cone NEO nosae magnatemqui officaerisi as pro mossi alignatque vendi cullor acepedi ciiscim agnatis A eic to quam que perum nite lam, sin porror sa quam cuptae pro deles alitius aborunt volecus ut TT la coriae pro eaque nobisque nusapis eos pore dolupti rem experum solenda deliquiatum dolut A essin perrorero dit harum et fugias volorro quideni nossunt. HI C Nam iumquis parumen ecusda dolorepero tem nostota eseque nobit quis nestrum nem faccus C rernatin cus molorum faccum, qui ommo verfers perionsed molo eos aut offici nat vendant N excearum et ex et et audit volore simodit iuntio. Bearum, as inullit volut optiae et omnis re, A FR occatatur? A L In copertina: Harald Szeemann nella sua fabbrica a Maggia. © Armin Linke Dalla visione al chiodo. -

The Popular Novels of Ina Seidel and Vicki Baum
DRUDGERY, DREAMLAND AND DIONYSUS: THE POPULAR NOVELS OF INA SEIDEL AND VICKI BAUM Rosemary Anne Sillars Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of PhD Department of European Languages Aberystwyth University 2015 DECLARATION This work has not previously been accepted in substance for any degree and is not being currently submitted in candidature for any degree Signed……………………………………………….. (Rosemary Anne Sillars) Date…………………………………….. STATEMENT 1 This thesis is the result of my own investigations, except where otherwise stated. Other sources are acknowledged by footnotes giving explicit references A bibliography is appended. Signed……………………………………………….. (Rosemary Anne Sillars) Date…………………………………….. STATEMENT 2 I hereby give my consent for my thesis, if accepted, to be available for photocopying and for inter-library loan, and for the tile and summary to be made available to outside organisations. Signed……………………………………………….. (Rosemary Anne Sillars) Date…………………………………….. Abstract The novels, poems and journalism of Ina Seidel and Vicki Baum were part of that everyday popular literature read and enjoyed by an international audience throughout the years of the Weimar Republic, the Third Reich and beyond. Their wide distribution and popular themes ensured that they reached a diverse public, but their publishers aimed their attentions at that female readership whose buying-power and literary tastes were now acknowledged as a significant market-factor. Both authors recognised their powerful position and took upon themselves the responsibilities, with which they believed they were thus endowed, to enlighten, educate and inform. They wrote from a view of themselves as creative artists with particular literary skills but, above all, as women. Understanding ‘womanhood’ as their primeval inheritance, they saw a woman’s physical powers of generation and nurture as part of the order of the natural universe, uniting them with other female beings. -

Ludwig Klages
Reinhard Falter Ludwig Klages klagesbu_neu.indd 1 15.06.2003, 15:43 Die Bäume sausen, doch sie reden nur Reinhard Falter Dem, dessen Seele einst im Sturme fuhr ... Ludwig Klages Ludwig Klages Lebensphilosophie als Zivilisationskritik klagesbu_neu.indd 2-3 15.06.2003, 15:43 Die Abfassung des Buches wurde von der Klages-Gesellschaft Marbach/Neckar Inhaltsverzeichnis unterstützt, wofür Autor und Verlag herzlich danken. Vorwort 7 Einleitung 9 © Telesma-Verlag Karl Heinrich Klein Inh. Carsten Müller e.K. 1. Die Gestaltwerdung des Erlebens 13 1.1. Überblick 13 Juli 2003 1.2. Das Jugenderleben 14 Telesma-Verlag 1.2.1. Dichtung 16 Ainmillerstraße 13 80801 München 1.3. Die Findung 20 Tel.: +49(0)89/33036932, Fax: +49(0)89/33036935 1.3.1. München 20 www.telesma-verlag.de 1.3.2. Die Kosmiker 21 [email protected] 1.3.3. Franziska zu Reventlow 25 1.4. Erste Werkversuche 28 1.5. Die Entwicklung des Gegensatzes von Geist und Seele 31 Umschlaggestaltung und Layout: Katja Wascher ([email protected]) unter Verwendung eines Fotos von Ludwig Klages aus dem Archiv des Verlags 2. Die Einheit des Werkes 37 Lektorat und Textbearbeitung: Baal Müller Herstellung: Books on Demand GmbH, Norderstedt 2.1. Graphologie und Charakterologie 38 2.2. Allgemeine Wissenschaft vom Ausdruck 40 2.3. Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie 42 2.4. Die Wirklichkeit der Bilder 49 Alle Rechte vorbehalten 2.4.1. Allsinnliche Wahrnehmung 50 2.4.2. Elementarseelen 52 2.5. Vergeschichtlichung statt Historisierung 55 2.6. Naturschutz und Kulturerneuerung 60 ISBN 3-8330-0678-1 3. Das Echo 67 klagesbu_neu.indd 4-5 15.06.2003, 15:43 3.1. -

Nell'antimodernismo Tedesco. Ludwig Klages Ei Suoi
UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI E COMUNICAZIONE SIMBOLICA XXV CICLO Anno Accademico 2012-2013 Declinazioni del “femminile” nell’antimodernismo tedesco. Ludwig Klages e i suoi contemporanei (1893-1932) di Chiara Gianni Coordinatore del Dottorato Chiarissimo prof. Claudio Bonvecchio Tutor Chiarissimi professori Claudio Bonvecchio Giampiero Moretti In filigrana: logo dei Blätter für die Kunst, creato da Melchior Lechter nel 1898. Indice Introduzione 1 Parte I: Mito 1. I Cosmici 1.1. Rinascita del mito nella Monaco di fin de siècle 5 1.1.1. Bachofen e l’aspetto materno della storia 12 1.2. “Cosmico” e “molochitico”: implicazioni dell’antisemitismo 15 1.2.1. Schuler e lo “splendore del sangue” 15 1.2.2. Ritorno del paganesimo nella modernità 21 2. Ludwig Klages e la Fuga degli déi 2.1. Mito e immagine. La fenomenologia 27 2.2. Mito e poesia. La scienza dell’anima a completamento dell’estetica 34 2.3. Mito e razza. Espressione dell’anima di un popolo 37 3. Ludwig Klages e il paganesimo 3.1. La morte e il culto degli antenati 41 3.2. Magna Mater e sacrificio 43 Excursus I: Monoteismo e divieto delle immagini 47 La morte come tema culturale in Ludwig Klages e Jan Assmann Parte II: Matriarcato 4. Maschile e femminile. L’essenza della modernità 4.1. Georg Simmel, Lou Andreas-Salomè e Ludwig Klages 55 4.1.1. Il femminile e la differenza di genere nei movimenti femministi tedeschi di 60 fin-de-siécle 4.2. L’(anti)-femminismo di Franziska zu Reventlow 65 4.2.1. -

Olga Fröbe-Kapteyn (1875-1961) in Front of Casa Eranos (Built in 1928) in 1929
ARAS Connections Issue 4, 2020 Figure 1. Olga Fröbe-Kapteyn (1875-1961) in front of Casa Eranos (built in 1928) in 1929. (Photographer unknown. © Eranos Foundation, Ascona. All rights reserved) Olga Fröbe-Kapteyn (1881–1962): A Woman’s Individuation Process through Images at the Origins of the Eranos Conferences Riccardo Bernardini (Eranos Foundation, Scientific Secretary) Fabio Merlini (Eranos Foundation, President) The images in this paper are strictly for educational use and are protected by United States copyright laws. 1 Unauthorized use will result in criminal and civil penalties. ARAS Connections Issue 4, 2020 More than eighty-five years have passed since the founding of the Eranos Conferences (Eranos Tagungen) in 1933. This pioneering endeavor of interdisciplinary gatherings, which has been properly recognized as “one of the most creative cultural experiences in the modern Western world” and “one of the richest centers of intellectual and spiritual interchange known to our century,” was promoted in Ascona (Switzerland) by Olga Fröbe-Kapteyn (1881–1962)1. In the case of Carl Gustav Jung (1875–1961), who was among the main inspirers of Eranos since the early ‘30s, the publication of The Red Book helped to realize all the more the strict connection between his personal and his intellectual paths. Up to now, several of Olga Fröbe-Kapteyn’s allusions have sounded much more hermetic. For example, she stated, “The deepest things in human life … can only be expressed in images.” Or: “I beg your pardon if I am speaking through images! This -
123 Book Reviews
123 BOOK REVIEWS 124 FOCUS ON GERMAN STUDIES 15 125 MAXIM BILLER. Liebe heute. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2007. 197 pp. € 18,90. ie zuvor begegnet uns Liebe zur gleichen Zeit äußerst einfach und kompliziert wie in Maxim Billers NKurzgeschichtensammlung Liebe heute. Einfach – denn Liebe in Billers Kurzgeschichten entsteht und existiert fast ohne jeglichen Grund. Kompliziert – da sie in zahlreichen Gestalten zum Ausdruck kommt und keinen Regeln der Logik und Vernunft folgt. In 27 Skizzen gelingt es Biller, einen vielumfassenden Einblick in das allgegenwärtig faszinierende Phänomen der Liebe in einer modernen Welt zu schaffen. Man trifft in Liebe heute auf erfolgreiche, meistens unglückliche Frauen und Männer, die ständig versuchen miteinander auszukommen, und trotz allem ohne Erfolg und meistens voller Enttäuschung von einander Abschied nehmen. Oft wird dieser Abschied schon am Anfang der Beziehungen antizipiert, während die Beziehungen eher als Generalprobe für die endgültige Trennung erscheinen. Was aus Billers Geschichten aber am häufigsten hervorgeht, ist die Unfähigkeit der Partner sich gegenseitig zu verstehen, ihre Gefühle offen auszudrücken, und letztendlich miteinander glücklich zu sein. Liebe heute könnte fast mit einer einzigen Formel bezeichnet werden: „eine Liebesgeschichte [...] von einer Frau, die nicht kann, obwohl sie will, und von einem Mann, der will, obwohl die Frau nicht kann“ (47). Darüber hinaus nehmen Billers Liebhaber freiwillig entweder die Rolle des Opfers oder des Täters ein, und tauschen diese Rollen ständig untereinander aus. Häufig ist es aber auch der verpasste Augenblick, an dem die Liebe scheitert – wie Biller dies in „Lieber Arthur“ pointiert ausdrückt: „Zuerst wollte ich nicht, dann wollte sie nicht“ (104), aber die Problematik liegt vor allem im Zustand des dauernden Missverstehens begründet. -

Stefan George Und Sein Umfeld
Stefan George und sein Umfeld Eberhard Köstler Autographen & Bücher SONDERKATALOG 156A September 2016 Eberhard Köstler - Autographen & Bücher oHG Eberhard Köstler - Dr. Barbara van Benthem Bockmayrstraße 24 - D - 82327 Tutzing Telefon [0049] (0)8158 - 36 58 Mobil [0049] (0)151 58 88 22 18 Telefax [0049] (0)8158 - 36 66 [email protected] Mitglied im Verband deutscher Antiquare und der International League of Antiquarian Booksellers Die Abbildungen auf der Vorderseite:: Nr. 4: Stefan George um 1914, Nr. 6: Stefan George 1928, Nr. 7: Georges Elternhaus, Nr. 47: Melchior Lechter. - Auf dieser Seite: Nr. 3: Vorzugsausgabe, Nr. 43: Widmugs- exemplar, Nr. 45: Widmungsblatt, Nr. 60: Vorzugsausgabe Stefan George 1 George, Stefan (Übersetzer), Dichter (1868-1933). Dante. Göttliche Komödie. Übertragungen von Stefan George. Berlin, Georg Bondi, 1912. Kl.-4°. Mit Titelvignette von Melchior Lechter. 123 S., 2 Bl. OLwd. mit goldgeprägtem Deckeltitel und Kopfgoldschnitt in Papp-Schuber. 60.- Erste Ausgabe. - Landmann 351. - Druck auf kräftigem Velin. - Vorne und unten unbeschnitten. - Sehr schön erhalten. Seltene Halblederausgabe 2 George, Stefan (Übersetzer), Dichter (1868-1933). Dante. Göttliche Komödie. Übertragungen von Stefan George. Vierte erweiterte Auflage. Berlin, Bondi, 1925. Kl.-4°. 219 S., 2 Bll. Blaues OHldr. mit Rückentitel und Buntpapierbezug sowie Kopfgoldschnitt und Lesebändchen nach Melchior Lechter (Kanten beschabt, Rücken etw. verblasst und fleckig). 300.- Gedruckt im Juni 1925 bei Otto von Holten. - Vorne und unten unbeschnitten. Seltene Vorzugsausgabe 3 George, Stefan, Dichter (1868-1933). Drei Gesänge. An die Toten. Der Dichter in Zeiten der Wirren. Ei- nem Jungen Führer im Ersten Weltkrieg (Deckeltitel). Berlin, Georg Bondi, [Dezember] 1921. 8°. 7 Seiten. Orangeroter Original-Pappband mit goldenem Deckeltitel. -

SWISS REVIEW the Magazine for the Swiss Abroad November 2017
SWISS REVIEW The magazine for the Swiss Abroad November 2017 Modern buildings but no money: Basel has no strategy for its museums The new Federal Councillor Ignazio Cassis: finally Ticino is back! Landslides in the mountains: the climate change in the Alps Connect with Swiss citizens across the planet! Banking, E-Voting, OASI, social health insurance... Which topic is the most important to you? Register now for free on SwissCommunity.org, the platform for the Swiss Abroad, and take part in the discussions. www.swisscommunity.org SwissCommunity.org is a social network set up by the Organisation of the Swiss Abroad (OSA) SwissCommunity-Partner: Contents Editorial 3 Climate change reaches Switzerland 5 Mailbag 6 Focus “Climate change is a reality, even if some people still Climate change in the Alps refuse to believe it.” These were the words used by Swiss ski resorts without snow Swiss President Doris Leuthard when she addressed the media in Bondo in Grisons last August. Three mil- 10 Politics lion cubic metres of rock had just fallen from nearby AHV and food – results of the Piz Cengalo. Huge piles of rubble had thundered referendums of 24 September down the valley, burying parts of the village. Eight Federal Councillor Ignazio Cassis hikers lost their lives but nobody in the village was The vision of the Federal Roads Office hurt thanks to its warning system. There was nevertheless large-scale des- for 2040 truction. In the past, natural disasters happened in far-away places. Switzerland 15 Society found out about such events via newspapers or television: devastation cau- CBD, the legal form of cannabis sed by hurricanes in the Caribbean or flooding after torrential rain in Asia. -

George-Kreis'
13 Geest als macht Stefan George en de `George-Kreis' Frits Boterman Er zou een vuistdikke studie to schrijven zijn over alle intellectuele verenigingen, dichters- en kunstenaarskringen, officiele clubs en geheime genootschappen die in Duitsland vanaf de achttiende eeuw bestaan heb- ben. Deze groepen sloten zich aaneen om zich gezamenlijk, vaak op informele en vriendschappelijke wijze, to wijden aan een hoger ideaal in culturele of politieke zin. Dit hogere ideaal was vaak verbonden met het verlangen naar een ander en beter Duitsland. Dat geldt voor de groep dichters en schrijvers van de Sturm and Drang-beweging aan het einde van de achttiende eeuw, maar bijvoorbeeld ook voor de literaire kring Die Gruppe 47 in het naoorlogse West-Duitsland. De George-Kreis was ook zo'n kring van dichters, geleerden en schrij- vers. Zij maakte onderdeel uit van wat de conservatieve revolutie ge- noemd wordt, een intellectuele beweging die vooral onder invloed van de filosoof Friedrich Nietzsche aan het einde van de negentiende eeuw in Duitsland ontstond. George was een van de belangrijkste inspirators van deze conservatieve revolutie.' De term Konservative Revolution werd in 1927 gemunt door de Oostenrijkse dichter en schrijver Hugo von Hof- mannsthal en ook door de Duitse schrijver Thomas Mann, en heeft be- trekking op de ideeenwereld van een generatie conservatieve intellec- tuelen, schrijvers, dichters die zich met name afzette tegen de burgerlijke samenleving met haar hypocrisie en epigonendom, zoals die in de loop van de negentiende eeuw was ontstaan. Het betrof een heterogene groep intellectuelen (geboren tussen 1880 en 1900, meestal met een gymnasiale opleiding of met een universitaire graad, maar buiten het culturele esta- blishment verkerend en grotendeels afkomstig uit de middengroepen) die 14 Intellectuele kringen in de twintigste eeuw verontrust was over de stand van de cultuur, het lage culturele peil in het wilhelminische, vooroorlogse Duitsland.