So Würde Ich Noch Einmal Leben
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
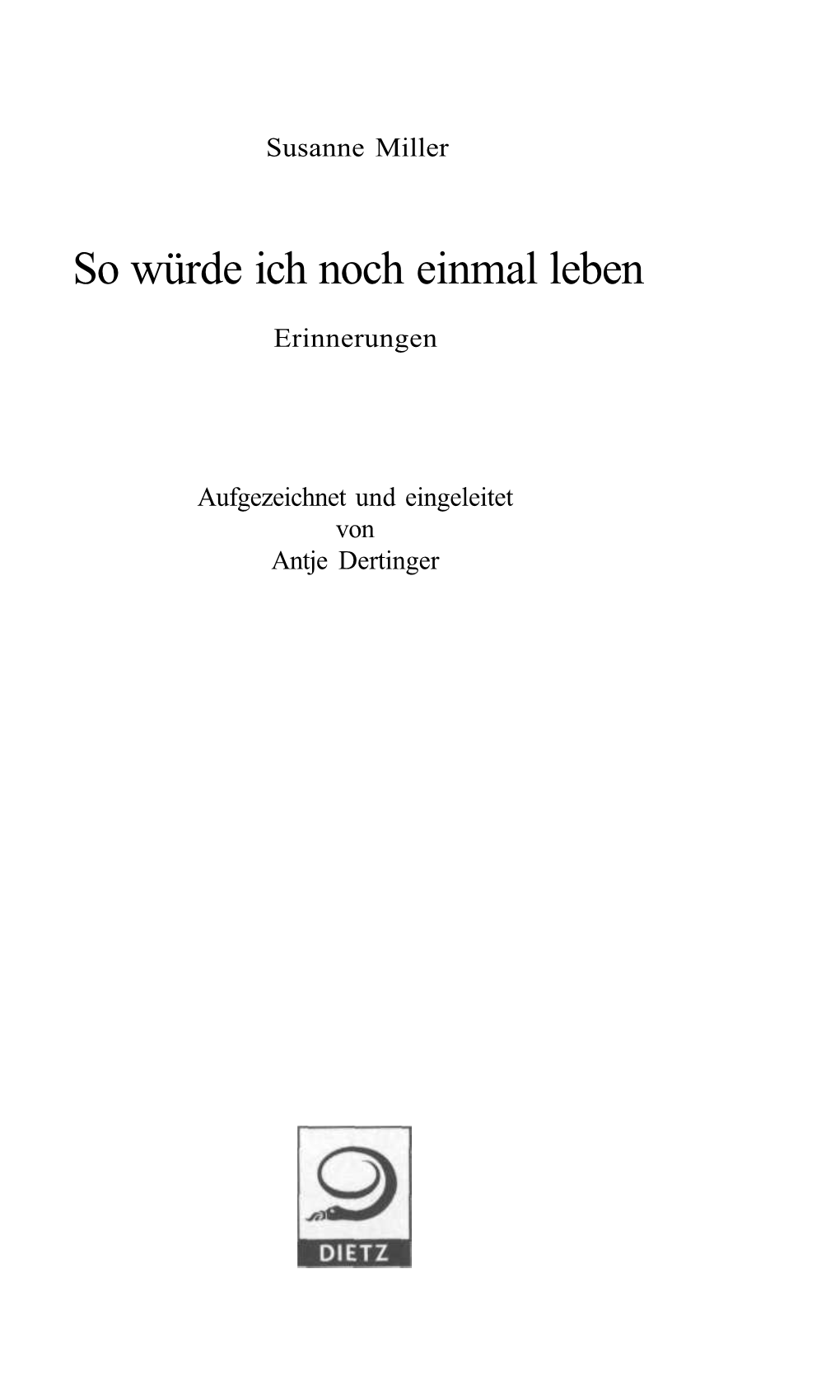
Load more
Recommended publications
-

4. Widerstand Aus Der Arbeiterbewegung A) Gesamtdarstellungen
4. Widerstand aus der Arbeiterbewegung a) Gesamtdarstellungen Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.), Widerstand 1933 - 1945. Sozialdemokraten und Gewerkschafter gegen Hitler. [Katalog zur gleichnamigen Ausstellung], Bonn 1983 (zweite Auflage) Asgodom, Sabine (Hrsg.), "Halt's Maul - sonst kommst nach Dachau!" Männer und Frauen der Arbeiterbewegung berichten über Widerstand und Verfolgung unter dem Nationalsozialismus, Köln 1983 Carsten, Francis L., Widerstand gegen Hitler. Die deutschen Arbeiter und die Nazis, Frankfurt am Main u.a. 1996 Dickhut, Willi, Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg, Düsseldorf 1987 Foitzik, Jan, Zwischen den Fronten. Zur Politik, Organisation und Funktion linker politischer Kleinorganisationen im Widerstand 1933 bis 1939/40, Bonn 1986 Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.), Widerstand und Exil der deutschen Arbeiterbewegung 1933 - 1945. Grundlagen und Materialien und Seminarmodelle für die Erwachsenenbildung, Bonn 1981 Gerhard, Dirk, Antifaschisten. Proletarischer Widerstand 1933 – 1945, Berlin 1976 Gittig, Heinz, Illegale antifaschistische Tarnschriften 1933 bis 1945, Frankfurt am Main 1971 Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.), Die Arbeiterbewegung europäischer Länder im Kampf gegen Faschismus und Kriegsgefahr in den zwanziger und dreißiger Jahren. Internationaler Sammelband, Berlin 1981 Jahnke, Karl Heinz, Schwere Jahre. Arbeiterjugend gegen Faschismus und Krieg 1933 – 1945, Essen 1995 Laschitza, Horst/Vietzke, Siegfried, Deutschland und die deutsche Arbeiterbewegung 1933 – 1945. Mit einem Anhang, Berlin 1964 Mason, Timothy W., Arbeiteropposition im nationalsozialistischen Deutschland, in: Peukert, Detlev J. K./Reulecke, Jürgen (Hrsg.), Die Reihen fast geschlossen. Beiträge zur Geschichte des Alltags unterm Nationalsozialismus, Wuppertal 1981, S. 293-313 Mason, Timothy W., Sozialpolitik im Dritten Reich. Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft, Opladen 1977 Mommsen, Hans, Der 20. Juli 1944 und die deutsche Arbeiterbewegung, Berlin 1989 (zweite Auflage) Morsch, Günter. -

State of Maine Department of Environmental Protection
1 1 STATE OF MAINE DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 2 AND MAINE LAND USE PLANNING COMMISSION 3 4 IN THE MATTER OF CENTRAL MAINE POWER COMPANY'S 5 NEW ENGLAND CLEAN ENERGY CONNECT PROJECT 6 7 NATURAL RESOURCES PROTECTION ACT SITE LOCATION OF DEVELOPMENT ACT 8 SITE LAW CERTIFICATION 9 10 HEARING - DAY 5 FRIDAY, APRIL 5, 2019 11 12 PRESIDING OFFICER: SUSANNE MILLER 13 14 Reported by Robin J. Dostie, a Notary Public and 15 court reporter in and for the State of Maine, on 16 April 5, 2019, at the University of Maine at 17 Farmington Campus, 111 South Street, Farmington, 18 Maine, commencing at 9:00 a.m. 19 20 REPRESENTING DEP: 21 GERALD REID, COMMISSIONER, DEP 22 PEGGY BENSINGER, OFFICE OF THE MAINE ATTORNEY GENERAL 23 JAMES BEYER, REGIONAL LICENSING & COMPLIANCE MGR, DEP 24 MARK BERGERON, DIRECTOR, BUREAU OF LAND RESOURCES 25 Dostie Reporting 7 Morrissette Lane Augusta, ME 04330 (207) 621-2857 2 1 PARTIES 2 Applicant: 3 Central Maine Power Company 4 Matthew D. Manahan, Esq. (Attorney for Applicant) Pierce Atwood 5 Merrill's Wharf 254 Commercial Street 6 Portland, ME 04101 Phone: (207) 791-1189 7 [email protected] 8 Lisa A. Gilbreath, Esq. (Attorney for Applicant) Pierce Atwood 9 Merrill's Wharf 254 Commercial Street 10 Portland, ME 04101 Phone: (207) 791-1189 11 [email protected] 12 Intervenors: 13 Group 1: 14 Friends of Boundary Mountains 15 Maine Wilderness Guides Old Canada Road 16 Designated Spokesperson: 17 Bob Haynes Old Canada Road Scenic Byway 18 27 Elm Street Skowhegan, ME 04976 19 Phone: (207) 399-6330 [email protected] 20 21 22 23 24 25 Dostie Reporting 7 Morrissette Lane Augusta, ME 04330 (207) 621-2857 3 1 PARTIES 2 Intervenors (cont.): 3 Group 2: 4 West Forks Plantation 5 Town of Caratunk Kennebec River Anglers 6 Maine Guide Services Hawk's Nest Lodge 7 Mike Pilsbury 8 Designated Spokesperson: Elizabeth A. -

Between Sorrow and Strength
Between Sorrow and Strength WOMEN REFUGEES OF THE NAZI PERIOD Edited by SIBYLLE QUACK GERMAN HISTORICAL INSTITUTE Washington, D.C. and CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS Contents Preface page vii List of Contributors ix Introduction Sibylle Quack 1 Prologue: Jewish Women in Nazi Germany Before Emigration Marion Kaplan 11 PART ONE: A GLOBAL SEARCH FOR REFUGE 1 Jewish Women Exiled in France After 1933 Rita Thalmann 51 2 Arrival at Camp de Gurs: An Eyewitness Report Elizabeth Marum Lunau 63 3 Women Emigres in England Marion Berghahn 69 4 England: An Eyewitness Report Susanne Miller 81 5 Women Emigres in Palestine: An Eyewitness Report Rachel Cohn 89 6 "Naturally, many things were strange but I could adapt": Women Emigres in the Netherlands Ursula Langkau-Alex 97 7 Refugee Women from Czechoslovakia in Canada: An Eyewitness Report Wilma A. Iggers 121 8 Women in the Shanghai Jewish Refugee Community David Kranzler 129 9 Shanghai: An Eyewitness Report Illo L. Heppner 139 10 German-Jewish Women in Brazil: Autobiography as Cultural History Katherine Morris 147 11 A Year in the Brazilian Interior: An Eyewitness Report Eleanor Alexander 159 vi Contents PART TWO: REFUGE IN THE UNITED STATES A. COMMUNITY AND INSTITUTIONS 12 Women's Role in the German-Jewish Immigrant Community Steven M. Lowenstein 171 13 "Listen sensitively and act spontaneously - but skillfully": Selfhelp: An Eyewitness Report Gabriele Schiff 185 14 "My only hope": The National Council of Jewish Women's Rescue and Aid for German-Jewish Refugees Linda Gordon Kuzmack 191 15 The Genossinen and the Khaveritn: Socialist Women from the German-Speaking Lands and the American Jewish Labor Movement, 1933-1945 Jackjacobs 205 B. -

1 Jack L. Jacobs Personal Information
1 Jack L. Jacobs Personal Information: Office address: Department of Political Science John Jay College The City University of New York 524 West 59th Street New York, New York 10019 Office Telephone: 1-212-237-8191 E-mail: [email protected] Current Position: Professor of Political Science John Jay College and The Graduate Center The City University of New York Education: Columbia University Ph.D. 1983 Columbia University M.Phil. 1978 Columbia University M.A. 1976 S.U.N.Y. Binghamton B.A. 1974 Teaching Experience: Vilnius University Fulbright Fellow 2009 The Graduate Center, C.U.N.Y. Professor 2005- John Jay College, C.U.N.Y. Professor 2000- Associate Professor 1991-1999 Assistant Professor 1986-1990 Tel Aviv University Fulbright Fellow and Visiting Associate Professor 1996-1997 Hunter College, C.U.N.Y. Visiting Associate Professor 1992 Columbia University Adjunct Assistant Professor 1990 Assistant Professor 1983-1986 Preceptor 1979-1983 Marymount College Adjunct Lecturer 1979 Queens College, C.U.N.Y. Adjunct Lecturer 1978 2 Administrative Experience: The Graduate Center, C.U.N.Y. Acting Associate Provost and Dean for Academic Affairs 2008-2009 The Graduate Center, C.U.N.Y. Acting Executive Officer Ph.D./M.A. Program in Political Science 2006-2007 The Graduate Center, C.U.N.Y. Deputy Executive Officer Ph.D./M.A. Program in Political Science 2003-2006 Honors: Visiting Scholar, Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur, Universität Leipzig 1998 United Jewish Appeal-Federation of Jewish Philanthropies, John Jay College -- Special award for contribution to Jewish scholarship 1995 Phi Beta Kappa 1974 Grants, Awards, and Fellowships: Fulbright Award 2009 PSC-CUNY Research Award 2004-2005 Workmen’s Circle/Dr. -

Bulletin of the GHI Washington
Bulletin of the GHI Washington Issue 3 Fall 1988 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. III. New Scholarship Recipients Petra Beckmann Topic: "Die neue Rechte in den USA. Der Einfluss ihrer Political Action Committees auf den amerikanischen Senat". Doctoral Advisor. Professor Hans-Dieter Klingemann, Free University of Berlin. Klaus Buettner Topic: "Konrad Adenauers Wiedervereinigungspolitik von 1953-1955". Doctoral Advisor. Professor Marie-Luise Recker, University of Muenster. Thomas Ettl-Golla Topic: "Das Rapallo-Problem in der amerikanischen Deutschlandpolitik nach dem Zeiten Weltkrieg, 1948-1955". Doctoral Advisor: Professor Hans-Juergen Schroeder, University of Giessen. Jacqueline Giere Topic: "Juedische displaced persons zwischen deutscher Vergangenheit und amerikanischer Besatzung". Doctoral Advisor: Professor Gertrud Beck-Schlegel, University of Frankfurt. Martin Kerkhoff Topic: "Die anglo-amerikanische Haltung zur Saarfrage, 1945-1958". Doctoral Advisor: Professor Klaus Schwabe, Technische Hochschule Aachen. Holger Kersten Topic: "Mark Twain und Deutschland". Doctoral Advisor: Professor K. Gross, University of Kiel. Stefan von Senger u. Etterlin Topic: "Deutsche Kolonien oder ein 'Neu-Deutschland' in Nordamerika". Doctoral Advisor: Professor Willi Paul Adams, Free University of Berlin. Karin Schulz Topic: "Vom Leben in der Fremde. Subjektive Eindruecke von juedischen 41 Auswanderern in die USA, 1881-1914". -

4 England an Eyewitness Report
4 England An Eyewitness Report SUSANNE MILLER Born in 1915 in Sofia, Bulgaria, Susanne Miller was raised in Vienna. In 1935 Miller emigrated to England, where she worked with the Internationaler Sozialistischer Kampf- bund (ISK) and the British Labour Party. After World War II, she went to Germany with her future husband, Willi Eichler. In 1952 she began working for the National Execu- tive Committee of the Social Democratic Party (SPD). She headed the SPD's Historical Commission from its establishment in 1982 until 1990. Miller received her Ph.D. in history in 1963. She subsequently joined the Commission for the History of Parliamentari- anism and Political Parties. Together with Heinrich Potthoff, she wrote A History of Ger- man Social Democracy from 1848 to the Present (1982). She has published widely in the field of German and Austrian labor and political history. This report was written in 1991. Perception is determined not only by its object but also by its subject, by the person who perceives, experiences, judges, and remembers his or her observations, impressions, and feelings. I think, therefore, that I should first introduce this person - myself. I wish to state from the outset that my biography, my motives, and my experiences cannot be regarded as typical for women emigres in England. I was brought up in Vienna in a rather well-to-do and conservative family of Jewish descent but was christened as a small child and learned practically nothing about the Jewish religion. Born in 1915, I went to the University of Vienna in 1932 to study history, English, and philosophy. -

Symposium Am 25. Juni 2015 in Bonn Zum Gedenken an Susanne Miller (1915 – 2008)
Symposium am 25. Juni 2015 in Bonn Zum Gedenken an Susanne Miller (1915 – 2008) ARCHIV DER SOZIALEN DEMOKRATIE DER FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG Glaubwürdigkeit und Verantwortung in der Politik Zum Gedenken an Susanne Miller (1915 – 2008) Für Susanne Miller waren Glaubwürdigkeit und Verantwortung in ihren vielfältigen politischen und wissenschaftlichen Tätigkeiten wichtige Grundsätze, an denen sie gerad linig in allen Situationen ihres Lebens festgehalten hat. Als junges Mitglied des Inter nationalen Sozialistischen Kampfbunds (ISK), im Londoner Exil während der NSDik tatur und nach dem Zweiten Weltkrieg als Mitwirkende bei der Entwicklung des Godes berger Programms der SPD sowie in ihren zahlreichen Publikationen und Akti vitäten als Historikerin der Sozialdemokratie und der deutschen Arbeiterbewegung blieb sie immer diesen Grundsätzen treu. Politisches Handeln war für sie stets einer ethischen Verantwortung verpflichtet und sollte glaubwürdig vertreten werden. Ihr großes Anliegen war, ein historisch kritisches Bewusstsein in der Bevölkerung und in der Politik wachzuhalten, ohne das feste Überzeugungen und Verantwortung sich nicht entwickeln könnten. Anlässlich des 100. Geburtstags von Susanne Miller präsen tieren das Archiv der sozialen Demokratie und die PhilosophischPolitische Akademie ein Symposium zu ihrem Gedenken. Wegbegleiter und Experten werden an ihre Per sönlichkeit und ihr Wirken erinnern und gemeinsam über die Aktualität ihrer Grund sätze aus der gegenwärtigen Perspektive von Politik diskutieren. Ein Symposium der Friedrich-Ebert-Stiftung -
Bulletin of the GHI Washington
Bulletin of the GHI Washington Issue 34 2004 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. THE IDEA OF FREEDOM IN GERMAN HISTORY Comment on the Seventeenth Annual Lecture of the GHI, November 20, 2003 Ju¨rgen Kocka Free University Berlin and Wissenschaftszentrum Berlin Here at the German Historical Institute it may be appropriate to comment on Professor Foner’s lecture by using it as an invitation to reflect on some German parallels and contrasts to this American narrative. I shall not have time to become fully comparative, but I do want to take the American example as a point of departure for a view of the German case which, in turn, might throw some indirect light on the story that was just told so well. In most respects the German case appears as a contrasting case. The German-American differences are overwhelming, certainly up to 1945, less so in the Cold War era, slightly more manifest again in the most recent period. The concept of Freiheit—freedom or liberty—did not play such a fundamental and central role in modern Germany’s self- understanding, politics, and symbolism. -

Bulletin of the GHI Washington
Bulletin of the GHI Washington Issue 9 Fall 1991 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Strauss' antimodern thinking by a philosophical reading of Strauss' writing. He presented Strauss as a conscious objector within modernity whose thinking ignored the traditions of freedom and independence, which he sees as important characteristics in nineteenth- century German philosophy. Some of the questions posed in the discussion dealt with the notion of an inherent authoritarianism in Strauss' educational theories, as pointed out by Robert Pippin and Simone Chambers. In commenting on Pippin's and Söllner's papers, Mansfield suggested that a possible explanation for Strauss' lack of treatment of German philosophy in the nineteenth century can be seen in Strauss' critique of the then prevailing contempt toward Greek authors, particularly Xenophon, and also in the emerging concept of history. He further showed the importance of dialogue in Strauss' thinking, thus refuting claims as to notions of absolute truths and ideology in the Straussian method. Hartmut Lehmann suggested the concept of secularization to describe Strauss' intellectual development as a German emigrant to the United States and criticized the characterization of Strauss as a German mandarin, emphasizing the transformation of his work as a result of emigration. -

Place and Politics at the Frankfurt Paulskirche After 1945
Cleveland State University EngagedScholarship@CSU History Faculty Publications History Department 1-2016 Place and Politics at the Frankfurt Paulskirche after 1945 Shelley Rose Cleveland State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://engagedscholarship.csuohio.edu/clhist_facpub Part of the European History Commons How does access to this work benefit ou?y Let us know! Publisher's Statement (c) 2016 SAGE Publications Repository Citation Rose, Shelley, "Place and Politics at the Frankfurt Paulskirche after 1945" (2016). History Faculty Publications. 87. https://engagedscholarship.csuohio.edu/clhist_facpub/87 This Article is brought to you for free and open access by the History Department at EngagedScholarship@CSU. It has been accepted for inclusion in History Faculty Publications by an authorized administrator of EngagedScholarship@CSU. For more information, please contact [email protected]. JUHXXX10.1177/0096144214566968Journal of Urban HistoryRose 566968research-article2015 Place and Politics at the Frankfurt Paulskirche after 1945 Shelley E. Rose1 Abstract This article investigates the reconstruction of the Frankfurt Paulskirche as a symbol of German democratic identity after World War II. The place memory of the Paulskirche is deeply rooted in the 1848 Parliament which anticipated the formation of a German democratic state. The church provided postwar Germans with a physical anchor for their sense of history and feelings of Heimat. This place identity pervades post-1945 debates about the reconstruction of the church and the appropriate uses of that space in the context of Frankfurt’s devastated urban and political landscape. Despite this, the place identity of the Paulskirche remains understudied in the historiography. Rental agreements and correspondence reveal dynamic exchanges between city leaders, mainly members of the Social Democratic Party, and their constituents. -

Major Field: Modern Germany/Modern Europe – 1789-1989 – 118 Books
Felix Jimenez 1 Major Field: Modern Germany/Modern Europe – 1789-1989 – 118 books I. Overall Histories 1. Hans Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte: Von der “Deutschen Doppelrevolution” bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs, 1849-1914. 2. Hans Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte: Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten, 1914-1949. 3. Heinrich August Winkler, Germany: the long road west. Translated by Alexander J. Sager. Vol. I. 1789-1933. 4. Heinrich August Winkler, Germany: the long road west. Translated by Alexander J. Sager. Vol. I. 1933-1990. 5. Christopher Clark, The Rise and Downfall of Prussia 6. David Blackbourn, History of Germany, 1780-1918: the long nineteenth century. II. Pre-Unification Nationalism, Society and government 7. Sheehan, James, “What is German History? Reflections on the Role of the Nation in German History and Historiography”, Journal of Modern History, Vol. 53, No. 1 (Mar. 1981), 1-23. 8. Levinger, Matthew. Enlightened Nationalism: The Transformation of Prussian Political Culture 1806-1848 (2000). 9. Hagen Schulze, The course of German nationalism: from Frederick the Great to Bismarck, 1763-1867 10. Thomas Nipperdey, German History 1800-1866 III. Bismarck to Wilhelm II, 1870 – 1918 Surveys and the Sonderweg thesis 11. Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918, Band I Arbeitswelt und Bürgergeist. Felix Jimenez 2 12. Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918 Band II Machtstaat vor der Demokratie. 13. Volker Ulrich, Nervöse Grossmacht. Aufstieg und Untergang des deutschen Kaiserreichs 1871–1918. 14. Volker Berghahn, Imperial Germany, 1871-1918: Economy, Society, Culture, and Politics 15. Eley, Geoff and David Blackbourn, The Peculiarities of German History: Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany. -

Internationaler Sozialistischer Kampfbund (ISK)
Internationaler Sozialistischer Kampfbund (ISK) 1.0 ORGANISATIONSGESCHICHTE 1925/26-1945 Internationaler Sozialistischer Kampfbund (ISK) 2.0 LITERATUR (im Bestand der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung) 2.1 PUBLIKATIONEN DER ORGANISATION Les congrégations économiques - voilà l'ennemi! : Propositions pour une adjonction au programme du Front Populaire / François Girard. - London : Soc. d'´Ed. Internat., 1936. - 15 S. Signatur(en): A 88-6025; A 88-6026 . - (Im Geschäftsgang) Deutschland im ersten Nachkriegsjahr : Berichte von Mitgliedern des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes (ISK) aus dem besetzten Deutschland 1945/46 / hrsg. und bearb. von Martin Rüther .... - München : Saur, 1998. - IX, 648 S.. - (Texte und Materialien zur Zeitgeschichte ; 10) ISBN 3-598-11349-8 Signatur(en): C 98-4302; C 02-1507 Dreissig Monate Z / Pierre Robert. - London : Internat. Verl.-Anst., 1937. - 16 S. Signatur(en): AKO 25327 Europe speaks : issues on behalf of the ISK, Internationaler Sozialistischer Kampfbund (Militant Socialist International). - London [u.a.] MF 1626 1942,2.März - 1945,10.Nov.; 1946,20.Jun. [Als Mikrofilm] Der Funke : Tageszeitung für Recht, Freiheit und Kultur / Internationaler Sozialistischer Kampf-Bund. - Berlin : Internat. Verl.-Anst. GmbH XX 158 1.1932 - 2.1933,17.2. = NR. 1-325 Der Generalstab der Antifaschisten : Verhandlungsgrundlage für die Bildung einer zentralen Kampf-Leitung gegen Faschismus und jede Ausbeutung ; für Recht, Freiheit und Kultur!. - Sonderdr.. - Paris, [1935]. - 12 S. Signatur(en): AKO 3703 Gesinnungswandel : die Erziehung der deutschen Jugend nach dem Weltkrieg / von Minna Specht. - S.l. : ISK, [1943]. - 40 Bl. Signatur(en): C 03-2290 . - (Im Geschäftsgang) Gesinnungswandel : Die Erziehung der deutschen Jugend nach dem Weltkrieg / Hrsg.: Internationaler Sozialistischer Kampf-Bund. - [London], [1943].