Sachlicher Teilregionalplan „Windenergienutzung“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
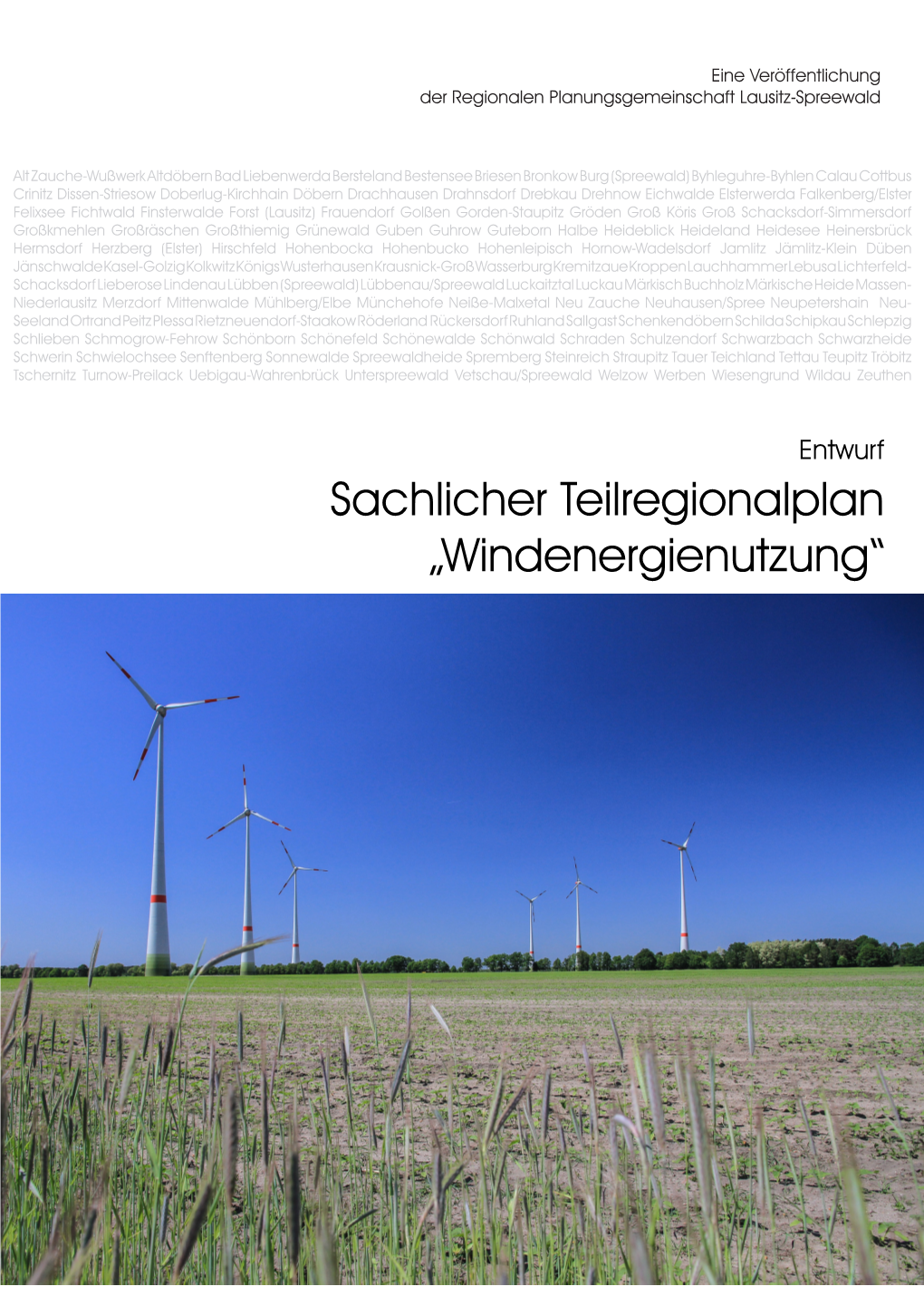
Load more
Recommended publications
-
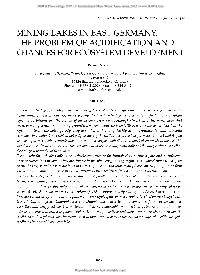
Mining Lakes in East Germany – the Problem of Acidification and Chances for Ecosystem Development
IMWA Proceedings 1999 | © International Mine Water Association 2012 | www.IMWA.info MINE, WATER & ENVIRONMENT. 1999 IMWA Congress. Sevilla, Spain MINING LAKES IN EAST GERMANY. THE PROBLEM OF ACIDIFICATION AND CHANCES FOR ECOSYSTEM DEVELOPMENT Brigitte Nixdorf Environmental Sciences. Water Conservation. Brandenburg Technical University Cottbus Seestrase 45 15526 Bad saarow-Pieskow, Germany Phone: + 49 336 312028, Fax: + 49 336 315200 e-mail: [email protected] ABSTRACT Several hundred geogenically acidified mining lakes of different age and maturity have formed in the lignite mining areas in East Germany during the last hundred years. The water deficit in the Lusatian 3 region is 13 billions m , the volume of all German reservoirs. Although almost all of the mines have shut 3 down, pumping continues, draining groundwater from about 2500 km . To overcome the water deficit in the region and to fill the holes quickly, they are filled with rising, highly acidic groundwater and also with eutrophic river water. One problem not only because of the further use of the lake for recreation is: What do you get when you mix acidic groundwater with polluted surface water? A limnological approach to answer this question is to estimate and evaluate the development of water quality with different flooding regimes as well as the ecological potential of these lakes. These newly formed lakes offer a remarkable opportunity for limnologists to investigate and to influence primary successions in lakes. They are diverse in morphometry, mixing regime and hydrochemistry. They are among the largest and most acidic lakes in Germany. The pH and total acidity (base capacity K84) range from 2.6-4 and 0-35 mmol I-1, respectively. -
Reiten Zwischen Spree Und Neiße Piktogramme Allgemeine Hinweise
Kolumnentitel 1 Landkreis Spree-Neiße Reiten zwischen Spree und Neiße Piktogramme Allgemeine Hinweise Touristischer Reiterhof Der Landesbetrieb Forst Branden- burg gibt folgende Hinweise zum e . V. Reiten im Wald: Reitverein Gesetzliche Regelungen zum Rei- ten im Wald sind im Waldgesetz Wanderreitstation des Landes Brandenburg veran- kert. So ist das Reiten im Wald aus- schließlich auf Waldwegen und Pensionspferdestall zusätzlich auf Waldbrandschutz- streifen möglich, sofern diese nicht Kremser- durch ein Verbotsschild für Reiter und Kutschfahrten gekennzeichnet sind. Ein „Quer-Feld-ein“-Reiten durch Geführte Ausritte den Wald ist per Waldgesetz unter- sagt. Reitunterricht Grundsätzlich sollte für jeden Waldbesucher eine „Wohlverhal- tensklausel“ gelten, d.h. alle soll- Therapeutisches Reiten ten sich so verhalten, dass andere Waldbesucher und -nutzer nicht beeinträchtigt werden. Kinderreitferien Die Untere Naturschutzbehörde Privater des Landkreises Spree-Neiße weist Landwirtschaftshof hin auf: Gastronomieangebot § 22 Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG) Übernachtungs- möglichkeit In der freien Lan dschaft darf jede Person auf Wegen, die von zwei- oder mehrspurigen Fahrzeugen Tour ist ausgeschildert befahren werden können, reiten oder mit bespannten Fahrzeugen fahren. Tour ist auf selbst erstellten Karten erfasst Tour ist mit GPS-Koordinaten erfasst Inhalt 5 Vorwort des Landrats Harald Altekrüger 6 Reiten und Br auchtum 10 Cattlemans Ranch 12 Minipony Ranch 14 Übersichtskarte 16 Polizeisportverein 1893 Forst e.V. 18 Reit- und Fahrverein Spremberg e.V. 20 Südhof Döbbrick 22 Spreepferde 24 Reiterhof AMOS 25 Bio-Landhof Kutzeburger Mühle GbR 26 Touristinformation Impressum Herausgeber: Landkreis Spree-Neiße Gesamtherstellung: Verlag Reinhard Semmler GmbH, www.verlag-semmler.de Fotos: R. Weisflog S. 1, 3, 4, 7, 8, 22, 23, 26, 27, 28; Medienzentrum LK SPN S. -

Konzessionsgemeinden Spree-Niederlausitz
Stand: 01.01.2018 Konzessionsgemeinden im Netzgebiet der NBB - Teilnetz Spree-Niederlausitz - Lfd. Nr. Stadt/Gemeinde Gemeindeschlüssel Ortsteil 1 Altdöbern 12066008 Ortsteil Altdöbern 2 Annaburg 15091010 3 Bad Liebenwerda 12062024 Ortsteil Prieschka 4 Bad Liebenwerda 12062024 5 Bernsdorf/O.L. 14625030 Ortsteil Straßgräbchen 6 Bernsdorf/O.L. 14625030 7 Boxberg/O.L. 14626060 Ortsteil Boxberg/O.L. 8 Boxberg/O.L. 14626060 Ortsteil Kringelsdorf 9 Boxberg/O.L. 14626060 Ortsteil Nochten 10 Briesen 12071028 11 Burg (Spreewald) 12071032 12 Calau 12066052 Ortsteil Werchow 13 Calau 12066052 14 Cottbus 12052000 Ortsteil Gallinchen 15 Cottbus 12052000 Ortsteil Groß Gaglow 16 Crinitz 12062088 17 Crinitz 12062088 Ortsteil Gahro 18 Dissen-Striesow 12071041 Ortsteil Dissen 19 Dissen-Striesow 12071041 Ortsteil Striesow 20 Döbern 12071044 21 Drebkau 12071057 Ortsteil Drebkau 22 Drebkau 12071057 Ortsteil Leuthen 23 Drebkau 12071057 Ortsteil Schorbus/ Wohngebiet Klein Oßnig 24 Drebkau 12071057 Ortsteil Schorbus/ Wohngebiet Oelsnig 25 Elsterwerda 12062124 26 Falkenberg/Elster 12062128 27 Felixsee 12071074 Ortsteil Friedrichshain 28 Frauendorf 12066064 29 Gablenz 14626100 Ortsteil Gablenz 30 Groß Düben 14626120 Ortsteil Groß Düben 31 Groß Naundorf 15091125 32 Groß Schacksdorf-Simmersdorf 12071153 Ortsteil Groß Schacksdorf 33 Groß Schacksdorf-Simmersdorf 12071153 Ortsteil Simmersdorf 34 Großkmehlen 12066104 Ortsteil Frauwalde 35 Großkmehlen 12066104 Ortsteil Großkmehlen 36 Großkmehlen 12066104 Ortsteil Kleinkmehlen 37 Großräschen 12066112 38 Großthiemig 12062208 -

16-03-03 Anlage Waldbrandalarmplan 2016
Forst Anlage zum Waldbrandalarmplan 2016 Landesbetrieb Forst Brandenburg Oberförsterei Cottbus Oberförsterei Drebkau Waldbrandzentrale Peitz Landeswaldoberförsterei Peitz Waldbrandgefahrenstufe 1 sehr geringe Gefahr 2 geringe Gefahr 3 mittlere Gefahr 4 hohe Gefahr 5 sehr hohe Gefahr Stand: 03.03.2016 2 Oberförsterei Cottbus August-Bebel-Straße 27 03185 Peitz Waldbranddiensthandy: 0173/ 99 76 429 Telefon: 035601/ 37130 Fax: 035601/ 37133 e-mail: [email protected] [email protected] Oberförsterei Drebkau Drebkauer Hauptstraße 12 03116 Drebkau Waldbranddiensthandy: 0173/ 99 76 430 Telefon: 035602/ 5191823 Fax: 035602/ 5191820 e-mail: [email protected] Landeswaldoberförsterei Peitz August-Bebel-Straße 27 03185 Peitz Diensthandy: 0172/ 30 64 218 Telefon: 035601/ 37132 Fax: 035601/37113 e-mail: [email protected] 3 Waldbrandzentrale Peitz Arbeitsplätze Kamera 035601 / 371-19 Diensthandy: 0173/ 99 76 433 FAX Waldbrandzentrale: 035601 / 371-25 Dienstzeiten: Besetzung der Waldbrandzentrale vom 01. März bis 30. September Montag bis Sonntag MEZ MESZ Waldbrandgefahrenstufe 3 9 - 17 Uhr 10 - 18 Uhr 4 9 - 18 Uhr 10 - 19 Uhr 5 9 - 19 Uhr 10 - 20 Uhr Bei Gefahrenstufe 1 und 2 erfolgt keine Besetzung. Notruf: 112 Telefon Fax Leitstelle Lausitz 0355/6320 0355/632-138 Dresdener Straße 46 03050 Cottbus [email protected] Zuständig für: Stadt Cottbus, Landkreis Spree-Neiße, Landkreis Oberspreewald- Lausitz, Landkreis Dahme-Spreewald, Landkreis Elbe-Elster 4 Dienstzeiten: Diensthabender je Oberförsterei vom 01. März bis 30. September Montag bis Sonntag MEZ MESZ Waldbrandgefahrenstufe 2 und 3 9 - 17 Uhr 10 - 18 Uhr 4 9 - 18 Uhr 10 - 19 Uhr 5 9 - 19 Uhr 10 - 20 Uhr Bei Gefahrenstufe 1 erfolgt kein Dienst. -

UK Lülau2019 Mit Regio-A3.Pdf
Neubrück Ahrensdorf Buckow Mellensee Wilhelminenhof Möllendorf Beeskow Zossen Töpchin Bornow Siedlung Premsdorf Groß Kehrigk Limsdorf Töpchin Köris Hermsdorfer Klein Köris Groß Eichholz Falkenberg Kohlsdorf Rankenheim Mühle Hermsdorf Tauche Spree Görsdorf Waldeck 4 Schwerin Forsthaus Wulfersdorf Kummerow Wünsdorf Tschinka Schwenow Klausdorf Münchehöfe Funkermühle Löpten Giesendorf Stremmen Neuhof Egsdorf Teupitz Alt Schadow Lindenbrück Werder Ranzig Mittelmühle Birkholz Kossenblatt 5a Märkisch Briescht Buchholz Neuendorf Leißnitz Tornow Waldsiedlg. am See Zesch Plattkow Glowe 179 Neu Schadow Halbe Sarkow Pretschen Wittmannsdorf Trebatsch Teurow Unterspreewald Leibsch Niewisch Neu Lübbenau Sawall Horstwalde Mückendorf Freidorf Köthen Märkische Heide Schuhlen-Wiese Pieskow 96 Massow Oderin Kuschkow Bernhardsruh 5b Mittweide Radeland Groß Gröditsch Paplitz Briesen Wasserburg Schwieloch- Schobendorf 87 Zaue see Spree Groß Leuthen Lynow Ressen Baruth/Mark Dornswalde Klein Ziescht Krausnick Leibchel Speichrow Schlepzig Märkische Jessern Staakow Brand Krugau Heide Dürrenhofe Dollgen Guhlen Goyatz Klasdorf Glashütte 6 Birkenhainchen 179 Schwieloch- see Kernlitz Dahme Rietzneuendorf Siegadel 13 Lamsfeld Biebersdorf Groß Leine Merzdorf Mochow Groß Ziescht Region Lübben Waldow/Brand Schönwalde Hartmannsdorf Klein Leine Groß Mahlsdorf Golßen Lubolz Liebitz Sacrow-Waldow Freiwalde Damsdorf Altgolßen 115 Lochnow Sellendorf Briesensee Steinreich Spreewaldheide Zützen Gersdorf 7 Schenkendorf Reichwalde Caminchen Laasow Liepe Buckow Hohendorf Schiebsdorf -

Amtsblatt Jahrgang 1 | Nummer 10 | Golßen, Den 6
Amt UnterSpreewald Amtsblatt Jahrgang 1 | Nummer 10 | Golßen, den 6. september 2013 mit den Gemeinden Bersteland, Drahnsdorf, Kasel-Golzig, Krausnick-Groß Wasserburg, Rietzneuendorf-Staakow, Schlepzig, Schönwald, Steinreich, Unterspreewald und Stadt Golßen Inhaltsverzeichnis der amtlichen Bekanntmachungen Amt Unterspreewald - Gefasste Beschlüsse des Amtsausschusses vom 06.08.2013 Seite 2 - 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Amtes Unterspreewald Seite 2 Gemeinde Drahnsdorf - Gefasste Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 12.08.2013 Seite 2 - 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Drahndorf Seite 2 Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg - Gefasste Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 20.08.2013 Seite 3 Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow - Gefasste Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 12.08.2013 Seite 3 Gemeinde Schlepzig - Gefasste Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 19.08.2013 Seite 3 Gemeinde Schönwald - Bekanntmachung der Ersatzperson für die Gemeindevertretung der Gemeinde Schönwald Seite 4 Gemeinde Steinreich - Gefasste Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 01.08.2013 Seite 4 Gemeinde Unterspreewald - Gefasste Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 24.07.2013 Seite 4 Stadt Golßen - Gefasste Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 26.08.2013 Seite 5 Sonstige amtliche Bekanntmachungen Amt Unterspreewald - Wahlbekanntmachung für die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013 Seite 6 Gemeinde Schlepzig - Öffentliche Ausschreibung hier: Verkauf Grundstück; Gemarkung Schlepzig, Flur 3, Flurstück 72/5 -

District Heating in Lusatia
Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg District Heating in Lusatia Status Quo and Prospects for Climate Neutrality Fernwärme in der Lausitz Status quo und Perspektiven für Klimaneutralität Thesis for the degree of Master of Science in Environmental and Resource Management submitted by Jan Christian Bahnsen 1st Examiner: Prof. Dr. Bernd Hirschl 2nd Examiner: Katharina Heinbach Submitted: 29th May 2020 Statement of Authentication I hereby declare that I am the sole author of this master thesis and that I have not used any other sources other than those listed in the bibliography and identified as references. I further declare that I have not submitted this thesis at any other institution in order to obtain a degree. The content, either in full or in part, has not been previously submitted for grading at this or any other academic institution. ________________________________ _____________________________________ (Place, Date) (Signature) Abstract The master thesis at hand examines the potential of district heating in Lusatia. The thesis follows the approach of first identifying technical and economic potentials in general and then transferring them to the study region. For the quantitative determination of district heating potential in Lusatia, the status quo is determined and a GIS-based analysis is carried out with regard to minimum heat demand densities. The extent to which district heating is suitable for climate-neutral heat supply will be investigated using the potential of renewable and waste heat energy sources. Furthermore, the regional economic effects of developing these potentials are examined. The results show that despite an overall decline in heat demand, there is potential to increase the relative share of district heating in Lusatia. -

90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Heinersbrück Richtfest Für Den
Beilage: Amtsblatt für das Amt Peitz/Amtske Ωopjeno za amt Picnjo mit seinen Gemeinden Drachhausen, Drehnow, Heinersbrück, Jänschwalde, Tauer, Teichland, Turnow-Preilack und der Stadt Peitz 4. Jahrgang · Nr. 8 · Amt Peitz, 12.06.2013 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Heinersbrück Es ist allen noch in guter Erinnerung, das 85. Jubiläum der Ortswehr Heinersbrück. Denn am 14. Juni 2008 konnten die Kameraden das dringend benötigte neue Feuerwehrgebäude in Besitz nehmen. Gleichzeitig wurde die Einweihung des neuen Gemeindezentrums gefeiert und so gab es ein Fest mit allen Einwohnern und vielen Gästen. Seither ist die umgebaute ehemalige Schule mit dem gestalteten Außengelände ein wichtiges Zentrum für die Einwohner der Gemeinde. Deshalb wird die Ortswehr am Standort auch das 90. Jubiläum feiern. 90 Jahre FF Heinersbrück am 16. Juni 2013 Die Kameraden der Ortswehr und die Gemeinde laden herzlich ein. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 20 Foto: Archiv FF/Kliche Richtfest für den neuen 11. Reitertag am 16. Juni in Maust Kinder- und Jugendtreff Drewitz Der Reit- und Fahrverein „Pferdefreunde Maust“ lädt ein Julia Clemens auf Latino Am 15. Mai fand in Drewitz das Richtfest für den Ersatzneubau des zukünftigen Kinder- und Jugendtreffs statt. Am Sonntag zeigt sich der Reiternachwuchs ab 8 Uhr in den Beste Wünsche zum Richtfest überbrachten die bauausführen- Wettbewerben der Führzügelklasse, des Reiterwettbewerbes den Firmen und der Bürgermeister Heinz Schwietzer. und der Dressur, erstmals mit einer etwas anspruchsvolleren Dressurprüfung - L-Niveau. Baubeginn für den Treff in Nähe des Sportplatzes in der Dorfstr. Der Reitertag wird ca. 13 Uhr mit der Einmarschparade der 7a war der 08.04.2013 und bereits im September soll die Einwei- Reiter-Pferd-Paare offiziell eröffnet. -

Sixth Periodical Report Presented to the Secretary General of the Council of Europe in Accordance with Article 15 of the Charter
Strasbourg, 19 February 2018 MIN-LANG (2018) PR 1 EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES Sixth periodical report presented to the Secretary General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter GERMANY Sixth Report of the Federal Republic of Germany pursuant to Article 15 (1) of the European Charter for Regional or Minority Languages 2017 3 Table of contents A. PRELIMINARY REMARKS ................................................................................................................8 B. UPDATED GEOGRAPHIC AND DEMOGRAPHIC INFORMATION ...............................................9 C. GENERAL TRENDS..........................................................................................................................10 I. CHANGED FRAMEWORK CONDITIONS......................................................................................................10 II. LANGUAGE CONFERENCE, NOVEMBER 2014 .........................................................................................14 III. DEBATE ON THE CHARTER LANGUAGES IN THE GERMAN BUNDESTAG, JUNE 2017..............................14 IV. ANNUAL IMPLEMENTATION CONFERENCE ...............................................................................................15 V. INSTITUTE FOR THE LOW GERMAN LANGUAGE, FEDERAL COUNCIL FOR LOW GERMAN ......................15 VI. BROCHURE OF THE FEDERAL MINISTRY OF THE INTERIOR ....................................................................19 VII. LOW GERMAN IN BRANDENBURG.......................................................................................................19 -

Landkreis Dahme-Spreewald
438810 441310 Legende: Betroffene Einwohner Gefährdete Objekte Gefahrenquelle pro Gemeinde < 100 IED-Anlagen UNESCO-Weltkulturerbe 100 - 1000 Bodendenkmäler > 1000 Museums- oder Archivsammlungen Bau- oder Gartendenkmäler mit Anzahl 88 Badegewässer Flächennutzung im Überflutungsgebiet Schutzgebiete Wohnbauflächen, Flächen gemischter Nutzung FFH-Gebiet Industrie u. Gewerbeflächen, Flächen mit funktionaler Prägung Vogelschutzgebiet (SPA) Verkehrsflächen Trinkwasserschutzgebiet (TWSG) Landwirtschaftlich genutzte Flächen, Wald, Forst Wasserschutzgebiet (WSG) Gewässer Sonstige Vegetations- und Freiflächen Neu Zauche Hochwasserschutzeinrichtungen Sonstiges Deiche, Wände Fließgewässer 2 7 4 Landesgrenze 4 Flutpolder / Hochwasserrückhaltebecken 5 2 is 7 7 Landkre 5 4 Landkreisgrenze 4 5 7 5 e-Spreewald Neu Zauche Dahm Gemeindegrenze WSG Spreewaldheide Gewässerstationierung Untere Spree Pegel Blattschnitt 1 : 10.000 (gültiger Kartenbereich) 0 200 400 600 800 1.000 m Lagebezugssystem: ETRS89 UTM 6° Zone 33 Datengrundlagen: Neu Zauche Überschwemmte Flächen, Ergebnisse hydronumerischer Berechnungen (1D/2D-Modellierung) HKV Hydrokontor GmbH, Kurbrunnenstr. 24, 52066 Aachen, Stand: 11/2013 Franz Fischer Ingenieurbüro GmbH, Holzdamm 8, 50374 Erftstadt, Stand: 10/2013 Einwohner je Gemeinde 10 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 10/2012 Gewässerstationierung der Bundeswasserstraßen (weißer Kreis mit schwarzem Punkt) © Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, 5/2010 Kulturerbe Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, -

Publications Office
L 180/114 EN Offi cial Jour nal of the European Union 21.5.2021 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/811 of 20 May 2021 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (1), and in particular Article 71(3) thereof, Whereas: (1) African swine fever is an infectious viral disease affecting kept and wild porcine animals and can have a severe impact on the concerned animal population and the profitability of farming causing disturbance to movements of consignments of those animals and products thereof within the Union and exports to third countries. (2) Commission Implementing Regulation (EU) 2021/605 (2) was adopted within the framework of Regulation (EU) 2016/429, and it lays down special disease control measures regarding African swine fever to be applied for a limited period of time by the Member States listed in Annex I thereto, in the restricted zones listed in that Annex. The areas listed as restricted zones I, II and III in Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/605 are based on the epidemiological situation of African swine fever in the Union. Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/605 was amended by Commission Implementing Regulation (EU) 2021/687 (3), to ensure the continuity and consistency of special disease control measures regarding African swine fever in the Union following the expiry of Commission Implementing Decision 2014/709/EU (4), and the commencement of application of Implementing Regulation (EU) 2021/605 on 21 April 2021. -
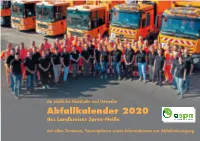
Abfallkalender 2020
An sämtliche Haushalte und Gewerbe Abfallkalender 2020 des Landkreises Spree-Neiße mit allen Terminen, Tourenplänen sowie Informationen zur Abfallentsorgung Inhaltsverzeichnis Wir sind Titelblatt „Teamfoto aspn“ ......................................................................... 1 Zum 1. Januar 2019 ist die Abfallentsorgungsgesellschaft Neiße-Spree im Eigen- Wichtige Termine für 2020 ....................................................................... 2 betrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Spree-Neiße verschmolzen. Alle 56 Mitar- Wir sind aspn ......................................................................................... 2 beiter und Mitarbeiterinnen wurden zum 16.05.2019 übergeleitet, so dass sich der Ansprechpartner im Eigenbetrieb Abfallwirtschaft ........................................ 3 Personalbestand des Eigenbetrieb Abfallwirtschaft von 20 auf 76 Mitarbeiter / -innen Hinweise zur Nutzung der Biotonne erhöht hat. Allein 52 Mitarbeiter verrichten im operativen Bereich, also direkt in der Probleme bei der Abfallentsorgung ............................................................ 4 Müllentsorgung ihre tägliche Arbeit. Abfallströme 2018 nach Sammelsystemen und Entsorgungsvarianten ............. 5 Der aspn ist damit im operativen Bereich zuständig für Tourenpläne Restmüll, Papier / Pappe / Kartonagen, • die Leerung der Restmüllbehälter Leichtstoffverpackung (LVP) und Biotonne ............................................. .6 – 13 • die Leerung der Papierbehälter (Blaue Tonne) Folgetermine „Blaue und Gelbe Tonne“