Apuz 2018 34-35
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
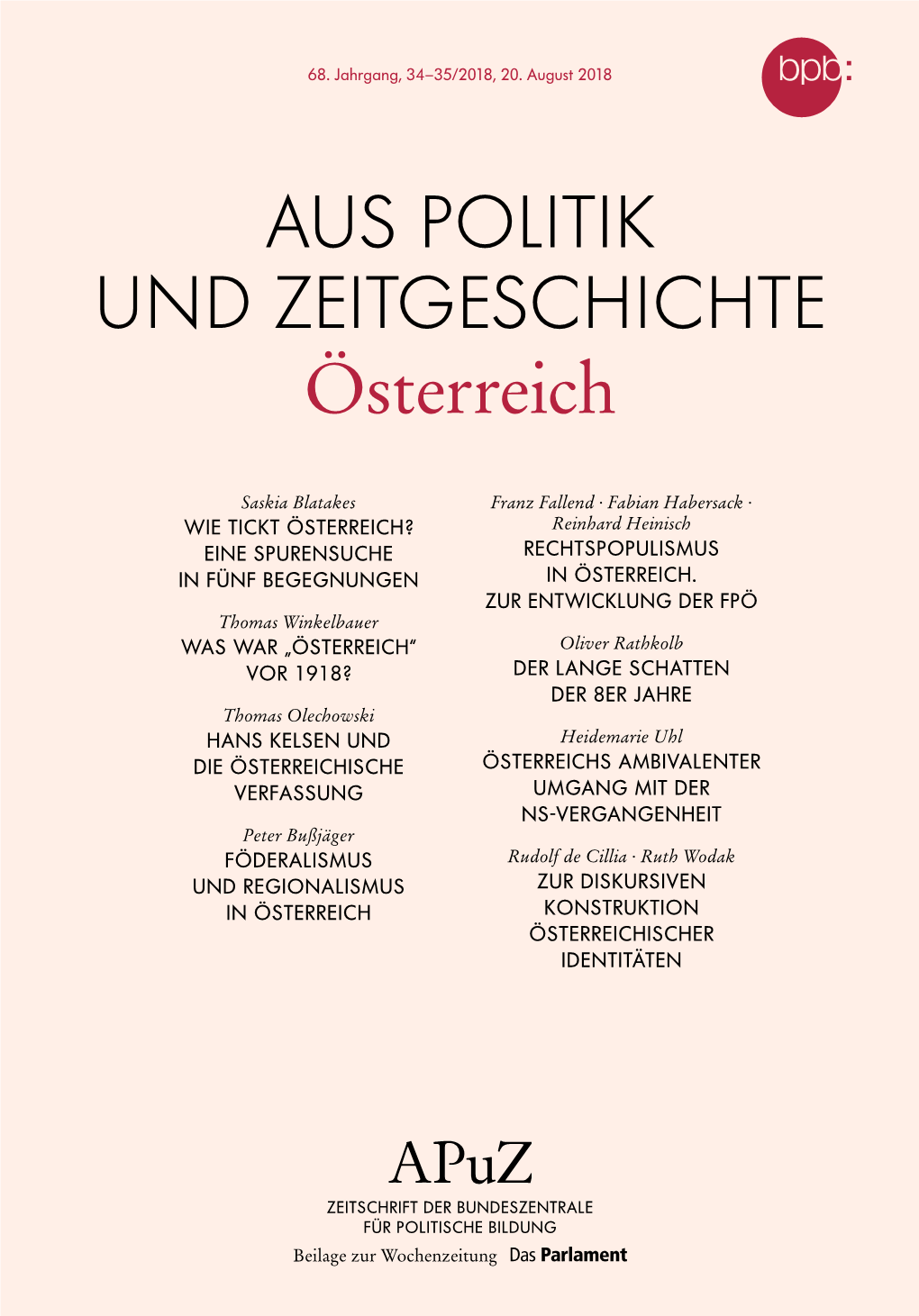
Load more
Recommended publications
-

Universite De Paris Viii-Vincennes Departement D'allemand a Saint-Denis L
UNIVERSITE DE PARIS VIII-VINCENNES DEPARTEMENT D'ALLEMAND A SAINT-DENIS L ' E V 0 L U T I 0 N I D E 0 L 0 G I Q U E D U P A R T I C H R E T I E N - S 0 C I A L A U P A R T I P 0 P U L I S T E A U T R I C H I E N par Gérard GRELLE Doctorat de 3e cycle 2 INTRODUCTION L'histoire politique de l'Autriche républicaine se divise en deux grandes périodes séparées l'une de l'autre par une troisième qui correspond à celle de l'austrofascisme et de l'occupation nazie. Cette dernière s'étend sur douze années (mars 1933-avril 1945) au cours desquelles l'ordre démocratique est démantelé et baillonné. Cet état de choses n'arrive pas du jour au lendemain; il est l'aboutissement de conflits qui opposent, sous la Première République, le camp conservateur au camp social- démocrate. Le résultat de ces conflits, c'est l'élimination par étapes de la démocratie par le parti chrétien-social et ses alliés fascistes, en particulier les "Heimwehren". Celle-ci s'effectue principalement par le fait qu'en 1933 le Parlement est mis hors d'état d'agir et qu'en 1934 tous les partis politiques sont interdits. On peut au contraire définir les deux grandes périodes démocratiques mentionnées auparavant comme jeu de rapports de force entre les partis politiques, jeu qui se déroule essentiellement dans le cadre des institutions parlementaires. -

Xerox University Microfilms 300 North Zeeb Road Ann Arbo', Michigan 48106 74-3188
INFORMATION TO USERS This material was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction. 1. The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent pages to insure you complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that the photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. You will find a good image of the page in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., was part of the material being photographed the photographer followed a definite method in "sectioning" the material. It is customary to begin photoing at the upper left hand corner of a large sheet and to continue photoing from left to right in equal sections with a small overlap. If necessary, sectioning is continued again — beginning below the first row and continuing on until complete. 4. The majority of users indicate that the textual content is of greatest value, however, a somewhat higher quality reproduction could be made from "photographs" if essential to the understanding of the dissertation. -

Österreich (PDF, 342KB)
Österreich Bitte beachten Sie, dass zu den ab Seite 48 genannten Filmtiteln im Bundesarchiv kein benutzbares Material vorliegt. Gern können Sie unter [email protected] erfragen, ob eine Nutzung mittlerweile möglich ist. - Bleriot‘s Flug in Wien (1909) - Aus alten Wochenberichten (1910/15) ...Stadtbilder von Wien. Blick auf die Hofburg. Großer Platz. Paradeaufstellung. Kaiser Franz Josef und Gefolge schreiten die Front ab. - Die Hochzeit in Schwarzau (1911) Hochzeit des Erzherzogs Karl Franz Joseph mit der Prinzessin Zita von Bourbon-Parma auf Schloß Parma in Schwarzau/Niederösterreich am 21.11.1911. - Eine Fahrt durch Wien (ca. 1912/13) Straßenbahnfahrt über die Ringstraße (Burgtheater, Oper) - Gaumont-Woche – Einzelsujets (1913) ...Wien: Reitertruppe kommt aus der Hofburg. - Gaumont-Woche – Einzelsujet: Militärfeier anläßlich des 100. Jahrestages der Schlacht bei Leipzig (1913) (aus Gaumont-Woche 44/1913) ...angetretene Militärformationen, Kavallerie-Formamation. Marsch durch die Straßen der Stadt Wien, am Straßenrand Uniformierte mit auf die Straße. Gesenkten Standarten. Kaiser Franz Joseph und ein ihn begleitender Offizier grüßen die angetretenen Forma- tionen. Beide besteigen eine Kutsche und fahren ab. ( 65 m) - 25 Jahre Zeppelin-Luftschiffahrt (ca. 1925) - Himmelstürmer (1941) ...Luftschiff „Sachsen“ auf der Fahrt nach Wien 1913. Landung auf dem Flugplatz Aspern - Der eiserne Hindenburg in Krieg und Frieden ...Extraausgabe des „Wiener Montag“ mit der Schlagzeile: Der Thronfolger ermordet - Eiko-Woche (1914) ...Erzherzog -

The First Bailout : the Financial Reconstruction of Aus- Tria 1922-1926
ORBIT-OnlineRepository ofBirkbeckInstitutionalTheses Enabling Open Access to Birkbeck’s Research Degree output The first bailout : the financial reconstruction of Aus- tria 1922-1926 https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/40237/ Version: Full Version Citation: Warnock, Barbara Susan (2016) The first bailout : the financial reconstruction of Austria 1922-1926. [Thesis] (Unpublished) c 2020 The Author(s) All material available through ORBIT is protected by intellectual property law, including copy- right law. Any use made of the contents should comply with the relevant law. Deposit Guide Contact: email The First Bailout – The Financial Reconstruction of Austria 1922 – 1926 Submitted for the degree of Ph.D By Barbara Susan Warnock Birkbeck College University of London 2015 1 I declare that this thesis is all my own work ……………………………………………………………………………. 2 Abstract This thesis examines the League of Nations’ project for Austrian financial reconstruction 1922- 1926. By 1922, the First Austrian Republic (1918-1938) was experiencing enormous problems, including hyperinflation. Little confidence existed that the country could survive as a unified and independent entity. In this context, the Economic and Financial Organisation (EFO) of the League designed a financial reconstruction scheme for Austria. The scheme was the first such project carried out by an international institution and this thesis explores its genesis, attributes and impacts. This thesis argues that this programme came into existence less, as is sometimes argued, because of the work of idealistic internationalists at the League of Nations, and more because the governments, diplomats and officials of certain powers, particularly France, but also Britain and others, wished to see Austria survive because they regarded its continued existence to be an important part of upholding post-war European order, and furthering their interests and diplomatic strategies. -

Confidential: for Review Only
BMJ Confidential: For Review Only Does the stress of politics kill? An observational study comparing premature mortality of elected leaders to runner-ups in national elections of 8 countries Journal: BMJ Manuscript ID BMJ.2015.029691 Article Type: Christmas BMJ Journal: BMJ Date Submitted by the Author: 02-Oct-2015 Complete List of Authors: Abola, Matthew; Case Western Reserve University School of Medicine, Olenski, Andrew; Harvard Medical School, Health Care Policy Jena, Anupam; Harvard Medical School, Health Care Policy Keywords: premature mortality, politics https://mc.manuscriptcentral.com/bmj Page 1 of 46 BMJ 1 2 3 Does the stress of politics kill? An observational study comparing accelerated 4 5 6 mortality of elected leaders to runners-up in national elections of 17 countries 7 8 Confidential: For Review Only 9 10 1 2 3 11 Andrew R. Olenski, B.A., Matthew V. Abola, B.A., , Anupam B. Jena, M.D, Ph.D. 12 13 14 15 1 Research assistant, Department of Health Care Policy, Harvard Medical School, 180 16 Longwood Avenue, Boston, MA 02115. Email: [email protected] . 17 18 2 19 Medical student, Case Western Reserve University School of Medicine, 2109 Adelbert 20 Rd., Cleveland, OH 44106. Phone: 216-286-4923; Email: [email protected]. 21 22 3 Associate Professor, Department of Health Care Policy, Harvard Medical School, 180 23 24 Longwood Avenue, Boston, MA 02115; Tel: 617-432-8322; Department of Medicine, 25 Massachusetts General Hospital, Boston, MA; and National Bureau of Economic 26 Research, Cambridge, MA. Email: [email protected]. 27 28 29 30 31 Corresponding author from which reprints should be requested: 32 33 Anupam Jena, M.D., Ph.D. -

Historicalmaterialism Bookseries
Otto Bauer (1881–1938) Historical Materialism Book Series Editorial Board Sébastien Budgen (Paris) David Broder (Rome) Steve Edwards (London) Juan Grigera (London) Marcel van der Linden (Amsterdam) Peter Thomas (London) volume 121 The titles published in this series are listed at brill.com/hm Otto Bauer in 1931 Otto Bauer (1881–1938) Thinker and Politician By Ewa Czerwińska-Schupp Translated by Maciej Zurowski leiden | boston This is an open access title distributed under the terms of the cc-by-nc License, which permits any non-commercial use, and distribution, provided no alterations are made and the original author(s) and source are credited. Published with the support of Austrian Science Fund (fwf) First published in German by Peter Lang as Otto Bauer: Studien zur social-politischen Philosophie. © by Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2005. The Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available online at http://catalog.loc.gov LC record available at http://lccn.loc.gov/2016031159 Typeface for the Latin, Greek, and Cyrillic scripts: “Brill”. See and download: brill.com/brill-typeface. issn 1570-1522 isbn 978-90-04-31573-0 (hardback) isbn 978-90-04-32583-8 (e-book) Copyright 2017 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands. This work is published by Koninklijke Brill NV. Koninklijke Brill nv incorporates the imprints Brill, Brill Hes & De Graaf, Brill Nijhoff, Brill Rodopi and Hotei Publishing. Koninklijke Brill nv reserves the right to protect the publication against unauthorized use and to authorize dissemination by means of offprints, legitimate photocopies, microform editions, reprints, translations, and secondary information sources, such as abstracting and indexing services including databases. -

Austrian Lives
Austrian Lives Günter Bischof, Fritz Plasser, Eva Maltschnig (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 21 innsbruck university press Copyright ©2012 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Book and cover design: Lauren Capone Cover photo credits given on the following pages: 33, 72, 119, 148, 191, 311, 336, 370, 397 Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010929 ISBN: 9783902811615 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lauren Capone University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver -

Historic Trail
VIENNA, AUSTRIA HISTORIC TRAIL VIENNA, AUSTRIA HISTORIC TRANSATLANTICTRAIL COUNCIL How to Use This Guide This Field Guide contains information on the Vienna Historical Trail designed by a members of Troop 427 of Vienna. The guide is intended to be a starting point in your endeavor to learn about the history of the sites on the trail. Remember, this may be the only time your Scouts visit Vienna in their life so make it a great time! While TAC tries to update these Field Guides when possible, it may be several years before the next revision. If you have comments or suggestions, please send them to [email protected] or post them on the TAC Nation Facebook Group Page at https://www.facebook.com/groups/27951084309/. This guide can be printed as a 5½ x 4¼ inch pamphlet or read on a tablet or smart phone. VIENNA, AUSTRIA 2 HISTORIC TRAIL Table of Contents Getting Prepared……………………… 4 What is the Historic Trail…………5 Historic Trail Route……………. 6-15 Trail Map…………………….………..16-17 Quick Quiz…………………………………18 B.S.A. Requirements…………..…… 19 Notes……………………………..……20-23 VIENNA, AUSTRIA HISTORIC TRAIL 3 Getting Prepared Just like with any hike (or any activity in Scouting), the Historic Trail program starts with Being Prepared. 1. Review this Field Guide in detail. 2. Check local conditions and weather. 3. Study and Practice with the map and compass. 4. Pack rain gear and other weather-appropriate gear. 5. Take plenty of water. 6. Make sure socks and hiking shoes or boots fit correctly and are broken in. 7. -

The Financial Reconstruction of Austria 1922 – 1926
The First Bailout – The Financial Reconstruction of Austria 1922 – 1926 Submitted for the degree of Ph.D By Barbara Susan Warnock Birkbeck College University of London 2015 1 I declare that this thesis is all my own work ……………………………………………………………………………. 2 Abstract This thesis examines the League of Nations’ project for Austrian financial reconstruction 1922- 1926. By 1922, the First Austrian Republic (1918-1938) was experiencing enormous problems, including hyperinflation. Little confidence existed that the country could survive as a unified and independent entity. In this context, the Economic and Financial Organisation (EFO) of the League designed a financial reconstruction scheme for Austria. The scheme was the first such project carried out by an international institution and this thesis explores its genesis, attributes and impacts. This thesis argues that this programme came into existence less, as is sometimes argued, because of the work of idealistic internationalists at the League of Nations, and more because the governments, diplomats and officials of certain powers, particularly France, but also Britain and others, wished to see Austria survive because they regarded its continued existence to be an important part of upholding post-war European order, and furthering their interests and diplomatic strategies. Furthermore, the support of financial elites was crucial in successfully launching the scheme, and representatives of these groups were centrally involved in the design and implementation of the programme via the EFO’s Financial Committee. The programme reflected their beliefs about the proper operation of finance and economics, and introduced to Austria orthodox financial measures that had a mixed, in many ways negative, effect on the Austrian economy and on Austrian prospects for stability. -

Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Einblick in die politischen und ökonomischen Einflussfaktoren auf die Wiener Krankenanstaltenlandschaft. Ein historischer Rückblick vom 12. bis zum 21. Jahrhundert“ Verfasserin Edith Toifl-Wimmer Angestrebter akademischer Grad Magistra der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Mag. rer. soc. oec.) Wien, 31. August 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: 157 Studienrichtung lt. Studienblatt: Internationale Betriebswirtschaft Betreuer/Betreuerin: ao.Univ.-Prof. Dr. Marion S. Rauner Vorwort Die Motivation, dieses Thema im Rahmen meiner Diplomarbeit zu behandeln, entstand in der Kernfachkombination Innovations- und Technologiemanagement am Lehrstuhl für Innovations- und Technologiemanagement an der Universität Wien. Ao.Univ.-Prof. Dr. Rauner Marion bot im Rahmen dieser Kernfachkombination den Schwerpunkt „Innovations- und Technologiemanagement im Gesundheitswesen“ an, für den ich mich entschieden habe. In den zahlreichen dazugehörenden Lehrveranstaltungen ist mein Interesse am österreichischen Gesundheitssystem gestiegen und nach einigen Gesprächen mit ao.Univ.-Prof. Dr. Rauner Marion kristallisierte sich das Thema meiner Arbeit heraus. Meinen Dank möchte ich an dieser Stelle meinen Eltern, Karl und Walpurga Toifl, meinem Ehemann Roman, meiner guten Freundin Marlies sowie meiner Betreuerin ao.Univ.-Prof. Dr. Marion S. Rauner aussprechen. Sie alle haben mich während meines Studiums und ganz besonders beim Schreiben meiner Diplomarbeit unterstützt. Toifl-Wimmer Edith I Inhaltsverzeichnis 1. Einführung........................................................................................................................1 -

Ein Partner Fürs Leben
Ein verlässlicher Partner für’s Leben Guenther Steiner Ein verlässlicher Partner für’s Leben Soziale Sicherheit von der industriellen Revolution bis ins digitale Zeitalter Alle Angaben in diesem Buch sind vom Autor und Verlag sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors bzw. des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Ver- mögensschäden ist ausgeschlossen. Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GesmbH Johann-Böhm-Platz 1 1020 Wien Tel. Nr.: 01/662 32 96-0 Fax Nr.: 01/662 32 96-39793 E-Mail: [email protected] Web: www.oegbverlag.at Umschlaggestaltung: Thomas Jarmer/Natalia Nowakowska Rechtsstand: 1. Juni 2018 Medieninhaber: Verlag des ÖGB GmbH, Wien © 2018 by Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH, Wien Hersteller: Verlag des ÖGB GmbH, Wien Verlags- und Herstellungsort: Wien Printed in Austria ISBN 978-3-99046-261-4 4 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis Vorwort 7 Einleitung 9 Abkürzungsverzeichnis 15 1. Kapitel Was ist Sozialversicherung? 26 2. Kapitel Von den Anfängen bis 1918 36 3. Kapitel Sozialversicherung in der Ersten Republik 1918–1933 136 4. Kapitel Sozialversicherung im autoritären System 234 5. Kapitel Die Entwicklung in der Zeit des Nationalsozialismus 256 6. Kapitel Die Entwicklung in der Zweiten Republik 272 7. Anhang Schlussbetrachtungen 438 Die geplante Reform der Sozialversicherung 447 Meilensteine in der Sozialversicherung 453 Währungsrechner 457 Literaturverzeichnis 458 Abbildungsverzeichnis 473 Der Autor 475 5 VORWORT Vorwort Zukunft hat Herkunft. Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherung hat in den letzten Jah ren seine eigene Geschichte sowie die Historie unserer Sozialversicherung in Buch form dokumentiert. Verwoben mit dem politischen und wirtschaftlichen Lauf der Geschichte gab es Höhen und Tiefen. -

Staging the Nation, Staging Democracy: the Politics of Commemoration in Germany and Austria, 1918-1933/34
STAGING THE NATION, STAGING DEMOCRACY: THE POLITICS OF COMMEMORATION IN GERMANY AND AUSTRIA, 1918-1933/34 By Erin Regina Hochman A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Department of History University of Toronto © Copyright by Erin Regina Hochman 2010 Staging the Nation, Staging Democracy: The Politics of Commemoration in Germany and Austria 1918-1933/34 Erin Regina Hochman Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto 2010 Between 1914 and 1919, Germans and Austrians experienced previously unimaginable sociopolitical transformations: four years of war, military defeat, the collapse of the Hohenzollern and Habsburg monarchies, the creation of democratic republics, and the redrawing of the map of Central Europe. Through an analysis of new state symbols and the staging of political and cultural celebrations, this dissertation explores the multiple and conflicting ways in which Germans and Austrians sought to reconceptualize the relationships between nation, state and politics in the wake of the First World War. Whereas the political right argued that democracy was a foreign imposition, supporters of democracy in both countries went to great lengths to refute these claims. In particular, German and Austrian republicans endeavored to link their fledgling democracies to the established tradition of großdeutsch nationalism – the idea that a German nation-state should include Austria – in an attempt to legitimize their embattled republics. By using nineteenth-century großdeutsch symbols and showing continued support for an Anschluss (political union) even after the Entente forbade it, republicans hoped to create a transborder German national community that would be compatible with a democratic body politic.