Der Münchner Odeonsplatz Als Ort Der Geschichte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
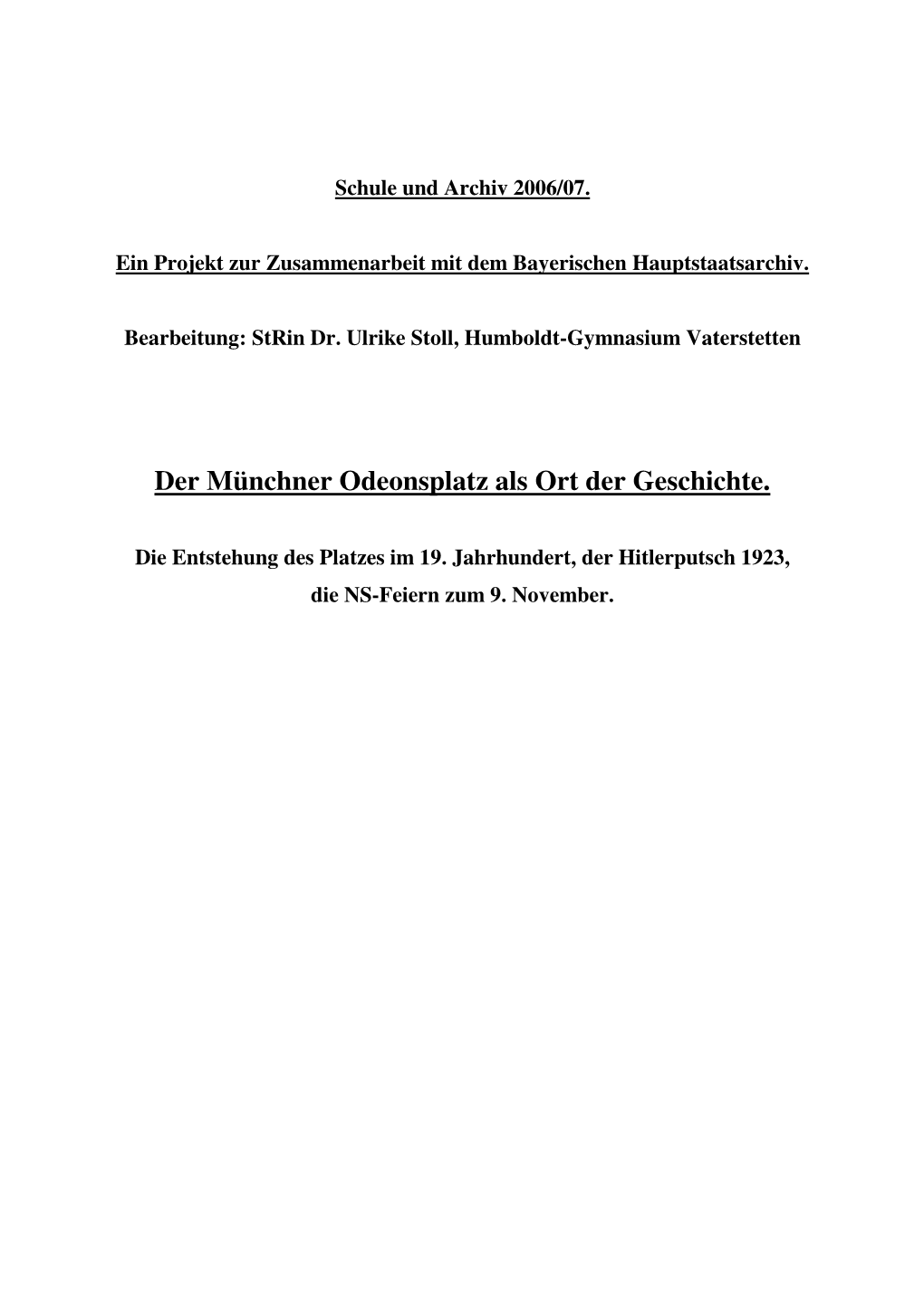
Load more
Recommended publications
-
Praktischer Teil
Bahnhöfe. — Gepäckbeförderung. — Dienstmänner. IX Praktischer Teil. Von der Angabe von Preisen wurde in den nachfolgenden Ab- schnitten grundsätzlich Abstand genommen, da diese sich in der heutigen Zeit zu häufig ändern. — Die Zahlen und Buchstaben in den eckigen Klammern bezeichnen die Quadrate des Stadtplans, auf welchen sich die erwähnten Straßen, Gebäude usw. befinden. — Ein alphabetisches Verzeichnis der Straßen befindet sich auf der Rückseite des beiliegenden Stadtplans. Bahnhöfe. Alle Straßenbahnen, deren Wagen an der Stirnseite mit einem roten Querstrich versehene Schilder haben, berühren den Haupt- bahnhof, an den sich der Starnberger und der Holzkirchner Bahnhof anschließen. Zum Isartalbahnhof führen die Straßen- bahnlinien 10 und 30. Hauptbahnhof [E5] S. 123; Kopfstation, die ausschließlich dem großen Fernverkehr dient. — Starnberger Bahnhof [E 5], S. 123, Arnulfstr., an der Nordseite des Hauptbahnhofs, für die Züge nach Starnberg, Murnau, Partenkirchen, Ober- ammergau, Kochel, sowie für den Nahverkehr über Pasing nach Gauting, Grafrath. —Holzkirchner Bahnhof [E 5], Bayerstr., an der Südseite des Hauptbahnhofs, für die Züge nach Holz- kirchen, Bad Tölz, Tegernsee und für den Nahverkehr nach Solln und Großhesselohe. — f sartal-Bahnhof [E 9], Schäftlarnstr., für die Bahn durch das fsartal nach Ebenhausen, Wolfratshausen, Bichl und für den Nahverkehr nach Prinz-Ludwigshöhe, Pullach, Höllriegelsgreuth-Grünwald. — Südbahnhof [Dg] und Ost- bahnhof [L 8], Nebenbahnhöfe für die Rosenheimer und Mühl- dorfer Strecke, gleichzeitig Güterbahnhöfe. Gepäckbeförderung. Zustellung des Reisegepäcks (Expreßdienst) sowie Abfertigung desselben durch das Amtliche Bayerische Reisebureau vorm. Schenker & Co. im Hauptbahnhof, Mittelbau (8—6, So. 9—12 Uhr) und Promenadeplatz 16 [G 5] (8%—6, So. 10—12 Uhr). Dienstmänner und Eilboten. Dienstmannbestellung am Bahnhofplatz 1 (Telegraphenamt), (tägl. -

The Fate of National Socialist Visual Culture: Iconoclasm, Censorship, and Preservation in Germany, 1945–2020
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works School of Arts & Sciences Theses Hunter College Fall 1-5-2021 The Fate of National Socialist Visual Culture: Iconoclasm, Censorship, and Preservation in Germany, 1945–2020 Denali Elizabeth Kemper CUNY Hunter College How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/hc_sas_etds/661 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] The Fate of National Socialist Visual Culture: Iconoclasm, Censorship, and Preservation in Germany, 1945–2020 By Denali Elizabeth Kemper Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Art History, Hunter College The City University of New York 2020 Thesis sponsor: January 5, 2021____ Emily Braun_________________________ Date Signature January 5, 2021____ Joachim Pissarro______________________ Date Signature Table of Contents Acronyms i List of Illustrations ii Introduction 1 Chapter 1: Points of Reckoning 14 Chapter 2: The Generational Shift 41 Chapter 3: The Return of the Repressed 63 Chapter 4: The Power of Nazi Images 74 Bibliography 93 Illustrations 101 i Acronyms CCP = Central Collecting Points FRG = Federal Republic of Germany, West Germany GDK = Grosse Deutsche Kunstaustellung (Great German Art Exhibitions) GDR = German Democratic Republic, East Germany HDK = Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) MFAA = Monuments, Fine Arts, and Archives Program NSDAP = Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (National Socialist German Worker’s or Nazi Party) SS = Schutzstaffel, a former paramilitary organization in Nazi Germany ii List of Illustrations Figure 1: Anonymous photographer. -

Orientierung Deutsch
DIE PINAKOTHEKEN IM KUNSTAREAL MÜNCHEN Schelling- ORIENTIERUNG straße Bus 154 Bus 154 U H H Universität Arcisstraße H 7/28 2 6 DEUTSCH m U a / 3 NEUE Tr Heßstraße PINAKOTHEK U e ß e MUSEUM REICH a U2 ß r a t e DER KRISTALLE Bus 100 r s t ß n s a e Theresienstraße g i U H H H i l w a sstr i Pinakotheken MUSEUM d m c u A BRANDHORST L Ar TÜRKENTOR e ALTE ß ra PINAKOTHEK PINAKOTHEK t DER MODERNE Gabelsbergerstraße r S re H a e B Bus 100 ß 00 1 ra ÄGYPTISCHES s st LENBACH- n MUSEUM Karolinen- Bu e HAUS platz k H r ü GLYPTOTHEK T NS-DOKU- U U Königsplatz ZENTRUM Brienner S traße H KUNSTBAU STAATL. GRAPH. Odeonsplatz SAMMLUNG 00 STAATLICHE 1 s ANTIKEN- Bu SAMMLUNGEN U4/U5 6 U / 3 U Alter B otanischer 7/28 ALTE PINAKOTHEK Garten 2 m a Täglich außer MO 10.00–18.00 | DI 10.00–20.00 www.pinakothek.de/alte-pinakothek Tr NEUE PINAKOTHEK H S U S U S1–S8 Täglich außer DI 10.00–18.00S U H | MI 10.00–20.00Karlsplatz (Stachus) Marienplatz www.pinakothek.de/neue-pinakothekS1–S8 Hauptbahnhof DB PINAKOTHEK DER MODERNEU2 Täglich außer MO 10.00–18.00 | DO 10.00–20.00 www.pinakothek.de/pinakothek-der-moderne MUSEUM BRANDHORST Täglich außer MO 10.00–18.00 | DO 10.00–20.00 www.museum-brandhorst.de SAMMLUNG SCHACK MI–SO 10.00–18.00 | Jeden 1. und 3. -

Aubrey Cox Professor Marcuse Hist 133A November 14, 2018 Source
Aubrey Cox Professor Marcuse Hist 133A November 14, 2018 Source exploration "Mass Rally in Front of Feldherrnhalle [Field Marshal's Hall] in Munich - Adolf Hitler in the Crowd (August 2, 1914)." GHDI - Image. Accessed November 01, 2018. http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_image.cfm?image_id=3736. This source exploration investigates the photograph that supposedly shows Adolf Hitler among a crowd to hear the declaration of war against Russia that sparked the beginning of World War I. Mass Rally in Front of Feldherrnhalle [Field Marshals’ Hall] in Munich – Adolf Hitler in the Crowd. (August 2, 1914). The photograph of a large crowd gathered on the Odeonsplatz, taken 2 by Heinrich Hoffmann, shows Hitler celebrating the start of World War I. The photo is copyrighted Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz/ Heinrich Hoffmann. "Heinrich Hoffmann (photographer)." Wikipedia. September 26, 2018. Accessed November 01, 2018. https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hoffmann_(photographer). The Photographer to capture such a historic photograph was a man by the name of Heinrich Hoffmann. Hoffmann (b. 12 Sept. 1885- 15 Dec. 1957) was a photographer and a publicist who published his works in the Nazi party’s weekly magazine the illustrierter Beobachter. Hoffmann trained for years under various photographers learning many aspects of the trade. He met Adolf Hitler in 1919. Hoffmann would later become Hitler’s personal photographer, the only photographer allowed to photograph him and thus a major player in Nazi propaganda. This famous photograph was published on March 12, 1932; just before Hitler’s election to Reich President according to the welt.de article cited further below Google scholar search with terms “Heinrich Hoffmann”, “Odeonsplatz”, and “Hitler” returned the result of the book titled “Germans into Nazis”. -

Orientation English
ALL PINAKOTHEK MUSEUMS IN THE KUNSTAREAL MÜNCHEN ORIENTATION Schelling- straße Bus 154 Bus 154 U H H Universität Arcisstraße H 7/28 2 ENGLISH 6 m U a / 3 NEUE Tr Heßstraße PINAKOKTHE U e ß e a U2 ß r a Pinakotheken t Bus 100 r s t n s e Theresienstraße g i U H H H i l w a MUSEUM d ALTE m u A PINAKOTHEK BRANDHORST L TÜRKENTOR e ß e a ß PINAKOTHEK DER r a t r S t MODERNE s r s e Gabelsbergerstraße i H r e c a ß 100 B Ar Bus a 0 r t 10 s PALAIS en LENBACH- s s Karolinen- k PINAKOTHEK Bu r HAUS platz ü GLYPTOTHEK H T U U Königsplatz Brienner Straße H KUNSTBAU STAATLICHE Odeonsplatz ANTIKENSAMMLUNGEN 6 U ALTE PINAKOTHEK / 3 Daily except MON 10.00–18.00 | TUE 10.00–20.00 8 U /2 www.pinakothek.de/en/alte-pinakothekAlter B otanischer 7 Garten 2 m a NEUE PINAKOTHEK Tr 8 U Daily except TUE 10.00–18.00 | WED 10.00–20.00 S1–S S Marienplatz www.pinakothek.de/en/neue-pinakothek H S S U H PINAKOTHEK DER MODERNE Karlsplatz (Stachus) S1–S8 Hauptbahnhof DB Daily except MON 10.00–18.00 | THU 10.00–20.00 www.pinakothek.de/en/pinakothek-der-moderne U2 MUSEUM BRANDHORST Daily except MON 10.00–18.00 | THU 10.00–20.00 www.museum-brandhorst.de/en SAMMLUNG SCHACK WED–SUN 10.00–18.00 | Every 1st und 3rd WED in a month 10.00–20.00 www.pinakothek.de/en/sammlung-schack DEAR VISITORS, ALTE PINAKOTHEK We wish you a pleasant visit to the Alte Pinakothek. -

Travelling from the Airport Travelling from the Main Train Station in Munich
Travelling from the airport Towards MPQ in Garching (from the airport): Take the S1 directed to Ostbahnhof and exit at Neufahrn. There you can take Bus No. 690 to Garching Forschungszentrum. (For this option please buy the “outer district” ticket) You could also take the S1 or S8 (big green/white S sign) = direction “Central Station/Marienplatz” to go to Munich. (The S8 is quicker, S1 has more stops; they run every 5- 10 min). At Marienplatz you have to change to the U6 towards Garching Forschungszentrum and exit at the last stop Garching Forschungszentrum. (You’ll have to buy an entire Network ticket for this option.) (If you want to go to the Hotel in Garching see option below) Towards Munich from the airport Take the S1 or S8 (big green/white S sign) = direction “Central Station/Marienplatz”. (The S8 is quicker, S1 has more stops; they run every 5-10 min). Travelling from the main train station in Munich To travel to the MPQ, take the subway U2 (towards Messestadt) to Sendlinger Tor. From there you take the U6 directed to Garching Forschungszentrum to the final destination Garching Forschungszentrum. To travel to the Hotel Hauser from the Main station please take the S1 (direction: München Ost) towards Marienplatz. At Marienplatz change to U6 (direction: Garching Forschungszentrum) and exit at Universität. Ticket Options: If you arrive at the airport and travel to Garching or Munich, please buy a single trip ticket unless you need to go somewhere else on the day of your arrival (LMU and/or MPQ). Then you can purchase a day ticket. -

MUSEEN UND AUSSTELLUNGSHÄUSER 01 Alte
26 Schellingstraße 15 Augustenstraße Luisenstraße Theresienstraße Schellingstraße Arcisstraße 20 8 Augustenstraße Barer Straße Gabelsbergerstraße Universität U3, U6 31 Luisenstraße Türkenstraße > Theresienstraße 31 1 Arcisstraße 27 6 7 Gabelsbergerstraße 30 30 Stiglmaierplatz 10 2 17 U1, U7 31 Barer Straße 13 11 Brienner Straße 14 Luisenstraße 3 4 28 Türkenstraße Brienner Straße Gabelsbergerstraße 27 19 24 23 Amalienstraße Königsplatz 31 U2 Arcisstraße Oskar-von-Miller-Ring 9 Barer Straße Augustenstraße Königsplatz Brienner Straße 4 12 5 Türkenstraße 16 Karolinenplatz Karlstraße 18 Luisenstraße 21 25 Brienner Straße Max-Joseph-Straße Oskar-von-Miller-Ring Katharina-von-Bora-Straße Hauptbahnhof Karlstraße U1, U2, U4, U5, U7 29 Brienner Straße � Barer Straße Ottostraße Karlsplatz (Stachus) Odeonsplatz U4, U5 22 Maximiliansplatz U3, U4, U5, U6 � > Elisenstraße Maximiliansplatz Einbahnstraße Deutsche Bahn U-Bahn-Station S-Bahn-Station Trambahnhaltestellen der Linien 27 und 28 Bushaltestellen der Linien 100 und 154 MUSEEN UND AUSSTELLUNGSHÄUSER KULTURELLE EINRICHTUNGEN HOCHSCHULEN KUNST � KULTUR � WISSEN = ERLEBNIS3 01 Alte Pinakothek 15 AkademieGalerie 26 Akademie der Bildenden Künste München Was ist das Kunstareal München? Barer Straße 27, 80333 München Zwischengeschoss der U-Bahn-Station Universität Akademiestraße 2–4, 80799 München (Ausgang Akademiestraße) Das Kunstareal München liegt direkt im Herzen von München und ist 02 Geologisches Museum München 27 Hochschule für Musik und Theater München mit seinen Museen und Hochschulen einer der wichtigsten Kultur- Luisenstraße 37, 80333 München 16 Amerikahaus München Arcisstraße 12, 80333 München (Hauptgebäude) standorte Europas. Auf einer Fläche von 500 � 500 Metern – mitten Karolinenplatz 3, 80333 München Standort Luisenstraße 37a, 80333 München im lebendigen Stadtbezirk Maxvorstadt – trifft der Besucher auf eine 03 Glyptothek einmalige Verbindung von Kunst, Kultur und Wissen. -

Orientation English
thE PiNAKOTHEk MUSEUMS iN THE kUNSTAREaL MÜNChEN oRiENtatioN Schelling- straße Bus 154 Bus 154 U H H Universität Arcisstraße H 7/28 2 ENGLiSh 6 m U a / 3 NEUE Tr Heßstraße PINAKOTHEK U e ß e MUSEUM REICH a U2 ß r a t e DER KRISTALLE Bus 100 r s t ß n s a e Theresienstraße g i U H H H i l w a sstr i Pinakotheken MUSEUM d m c u A BRANDHORST L Ar TÜRKENTOR e ALTE ß ra PINAKOTHEK PINAKOTHEK t DER MODERNE Gabelsbergerstraße r S re H a e B Bus 100 ß a 0 10 r ÄGYPTISCHES s LENBACH- st MUSEUM Karolinen- Bu en HAUS platz k H r ü GLYPTOTHEK T NS-DOKU- U U Königsplatz ZENTRUM Brienner Straße H KUNSTBAU STAATL. GRAPH. Odeonsplatz SAMMLUNG STAATLICHE ANTIKEN- SAMMLUNGEN 5 aLtE PiNakothEk Daily except MON 10am–6pm | TUE 10am–8pm www.pinakothek.de/en/alte-pinakothek NEUE PiNakothEk Daily except TUE 10am–6pm | WED 10am–8pm www.pinakothek.de/en/neue-pinakothek PiNakothEk DER MoDERNE Daily except MON 10am–6pm | THURS 10am–8pm www.pinakothek.de/en/pinakothek-der-moderne MUSEUM BRaNDhoRSt Daily except MON 10am–6pm | THURS 10am–8pm www.museum-brandhorst.de/en Sammlung SChaCk WED–SUN 10am–6pm | Every 1st and 3rd WED in the month 10am–8pm www.pinakothek.de/en/sammlung-schack DEaR viSitoRS, NEUE PiNakothEk We hope you have an exciting visit and request that you please do not Barer Straße 29 touch the artworks. Please put umbrellas, large bags (bigger than A4) D 80799 Munich and backpacks in the lockers or check them into the cloakroom located T +49.(0)89.2 38 05-195 in the basement. -

How to Reach Us Munich Office Directions
Munich Office Directions Theresienhof Theresienstraße 1 80333 Munich Germany Tel: +49 89 244 459800 Fax: +49 89 244 459801 How to reach us We are based at Contora Office Solutions in the Theresienhof e ß a r t building on Theresienstraße 1 in the Maxvorstadt area of Munich. s T g h i ere sie w nst d The office and reception are located on the first floor. raß u e Entrance L BSB There are two nearby underground stations: Odeonsplatz (lines Bayerische Staatsbibliothek U3/U6 or U4/U5) and Universität (lines U3/U6). Both stations are F approximately five minutes’ walk from the office. ü r s t e Franz Josef Strauss International Airport is located 30 km (19 miles) n Rh s einb t er r ge a rstra north east of the city centre. The airport is connected to the city by ß ße e Mewburn Ellis LLP Munich suburban railway (S-Bahn) lines S1 and S8. Take line S1 (50 Deutsche e ß Theresienhof a Os Bundesbank r kar- t minutes) or S8 (38 minutes) to Marienplatz. At Marienplatz take von s Theresienstraße 1 -M g il i ler-R 80333 Munich skar-von-M ing w underground lines U3/U6 to Odeonsplatz. Alternatively, the journey O iller- d Ring u Germany from the airport by car or taxi takes approximately 30 minutes. L M S Universität che l e L Th Neue ling U3 U6 inp er str ß ru e e aß a n si Pinakothek ß e r s D e t n a t ra s r e ß ac tr s e e aß t ß ß e s a g r i a h n t r e t a s w k s n u Technische r d e e d ü i e l u n T ß r Universität a L a a r S S m München t t A Ludwigskirche s r TUM h . -

Rundgang Tour
HERZLICH WILLKOMMEN IN DER IHR WEG DURCH DIE PINAKOTHEK Bus 154 Bus 154 U Schellingstraße H H Universität PINAKOTHEK DER MODERNE DER MODERNE Arcisstraße H RUNDGANG Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern einen Vier bedeutende Museen für Kunst, Graphik, NEUE 27/28 Tram Heßstraße 6 3/U U rundum gelungenen, anregenden Aufenthalt. Lassen Sie sich PINAKOTHEK Archi tektur und Design unter einem Dach – die MUSEUM REICH überraschen, inspirieren, begeistern! Und besuchen Sie uns U 2 TOUR DER KRISTALLE Bus 100 U Theresienstraße H H H gerne immer wieder. Pinakothek der Moderne ist eines der weltweit l Theresien- Pinakotheken MUSEUM straße Amalienstraße BRANDHORST Ludwigstraße größten Häuser für die Kunst des 20. und 21. Jahr- Arcisstraße EINIGE HINWEISE FÜR IHREN BESUCH TÜRKENTOR hunderts. Das offene und großzügige Gebäude von ALTE PINAKOTHEK Helfen Sie uns, die Kunstwerke in unseren Ausstellungen best- PINAKOTHEK DER MODERNE Gabelsbergerstraße H Stephan Braunfels lädt ein, Zusammenhänge zu Barer Straße Bus 100 möglich zu schützen: 00 1 ÄGYPTISCHES LENBACH- us Geben Sie sperrige Gegenstände wie Schirme, Stöcke, Foto- entdecken und neue, überraschende Einblicke zu MUSEUM Karolinen- B HAUS H platz stative, Taschen über 30 x 20 x 20 cm und vor allem Rucksäcke GLYPTOTHEK Türkenstraße gewinnen. Temporäre Ausstellungen und beglei- NS-DOKU- U an der Garderobe ab. Oder nutzen Sie ein Schließfach. Das ist U Königsplatz ZENTRUM Brienner Straße tende Veranstaltungen sowie ein umfangreiches H kostenlos und bequem. Wenn Sie uns mit Kindern besuchen, KUNSTBAU STAATLICHE GRAPHISCHE Odeonsplatz haben Sie ein Auge darauf, dass sie die Kunstwerke nicht be- SAMMLUNG Kunstvermittlungsprogramm vervollständigen das STAATLICHE U 4/U 5 6 3/U U 00 ANTIKEN- rühren – egal, wie verlockend das sein mag. -

Nymphenburg P Alace and P Ark Munich
I wish you a MUNICH RESIDENCE fascinating visit to OPENING TIMES OF THE RESIDENCE MUSEUM AND TREASURY Munich’s palaces! Apr. – 18 Oct.: 9am – 6pm · 19 Oct. – Mar.: 10am – 5pm S Museum rooms only accessible via a number of steps or a staircase Free audio guide available (German, English, Italian, French, Spanish). Albert Füracker, MdL The Königsbau (King’s Tract) is partly closed for restoration. Bavarian Minister of State OPENING TIMES OF THE CUVILLIÉS THEATRE of Finance and Regional Identity Apr. – 26 Jul.: Mon. – Sat. 2pm – 6pm · Sun./public holidays 9am – 6pm 27 Jul. – 7 Sept.: daily 9am – 6pm 8 Sept. – 18 Oct.: Mon. – Sat. 2pm – 6pm INFORMATION The Antiquarium in the Munich Residence The façade facing the park The Hall of Mirrors in the Amalienburg Sun./public holidays 10am – 6pm 19 Oct. – Mar.: Mon. – Sat. 2pm – 5pm Sun./public holidays 10am – 5pm Residence Museum the Nibelungenlied. In addition to the rich accumulation of valuable Nymphenburg Palace Marstallmuseum S accessible MUNICH RESIDENCE furniture, paintings, sculptures, bronze work, clocks and tapestries, TRANSPORTATION The history of the Munich court began when Duke Ludwig the museum rooms also contain numerous special collections. With its unique combination of architecture and garden de- The well-known Marstallmuseum has state coaches, sleighs and riding Train to the main station, then S1 – 8 to Marienplatz or the Severe moved his court here from Landshut after the sign, Nymphenburg is one of the best examples in Europe equipment used by the Bavarian rulers. The coaches are works of U3 – 6 to Odeonsplatz partition of Bavaria in 1255. As dukes, electors and finally Treasury of a synthesis of the arts. -

National Socialism in Munich“ in Socialism National – Remembrance P
TGP_4_plan_engl:TGP_2_plan_engl 14.10.2010 10:41 Uhr Seite 1 37 41 ቕ Informa tion board ቕ 45 46 43 47 21 ቕ 44 Tram 20 16 47 ቕ 22 40 24 ቕ 39 42 23 15 ቕ 29 Memorial to the victims ቕ 25 35 30 of National 13 ቕ 14 34 Socialism Memorial 38 to the 33 27 resistance to 32 National 28 Socialism ቕ 19 18 31 ቕ ቕ 36 17 26 ቕ 12 Tram 11 5 10 ቕ 4 9 6 ቕ 48 Tram Tram Tram 7 49 Pre-1933 Church organisations 8 “City of art” Party organisations 1 ቕ 3 Nazi cult Reich central offices 2 Persecution Branch offices ThemenGeschichtsPfad Professional Local/regional associations government Main route ቕ Audio point National Socialism Detour in Munich Source: Amtlicher Stadtplan der Landes haupt stadt München, © 2005 Landeshauptstadt München Munich City Kommunalreferat Vermessungsamt 50 Museum List of places mentioned in the ThemenGeschichtsPfad Square brackets denote pre-1945 adresses 1 New Town Hall; Marienplatz 8 p. 9 16 Widening of Von-der-Tann-Straße to lead up 26 Chamber of Commerce and Industry; 39 Bavarian Protestant Church; to the Haus der Deutschen Kunst p. 39 Max-Joseph-Straße 2 [Maximiliansplatz 8] p. 58 Katharina-von-Bora-Straße 13 [Arcisstraße 13] p. 72 2 Old Town Hall; Marienplatz 15 p. 11 Memorial to the resistance to 27 Reich leadership of the National Socialist Association 40 Former Papal nunciature (until 1934); staff of Hitler’s 3 Marienplatz p. 9 National Socialism (1996); Hofgarten of German Lecturers; Max-Joseph-Straße 4 [6] p.