1999/2000 Hyosong Gu KAMPF UND BEWEGUNG
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

(Pdf) Download
Copyright © 2015 Paul J. Cote & Troy J. Price Chinese Internal Martial Arts All Rights Reserved. Tai Ji Quan Xing-Yi Quan Ba Gua Zhang Okinawa/Japan Yang Luchan Li Luoneng Dong Haichuan Karate/Kobudo/Judo Yang Banhou Liu Qilan Yin Fu Wu Quanyu Che Yizhai Cheng Tinghua Shuri-te/Naha-te Systems Yang Chengfu Guo Yunshen Liu Dekuan Konishi Yasuhiro Li Cunyi XY/BG Gima Makoto Okinawan Zhang Zhaodong XY/BG Shito-ryu/Shotokan Karate & Kobudo Sun Lutang XY/BG Yamaguchi Gogen 1st / 2nd / 3rd Japan Generation Keng Jishan XY/BG Oshiro Roy Chotoku Kyan (Shorin) Goju-ryu Jujutsu/Karate Motobu Choki (Shorin) Wang Maozhai TJ Gao Yisheng BG (3rd) Chinese Internal Hoy Yuan Ping Takashi Uechi Miyagi Chojun (Goju) Yang Yuting TJ Wu Mengxia XY/BG Martial Art/Karate Tenshi Shinjo Kempo Jutsu Shinto Yoshin-Ryu Jujutsu Taira Shinken (Kobudo) Ma Gui BG Liu Fengcai BG Tung Gee Hsing Yamada Yajui Otsuka Hironori Gao Kexing BG Zhang Junfeng XY/BG XY/Motobu Shuri-te Kodokan Judo Wado Karate Isshin-Ryu Style Han Muxia XY/BG Chen Panling XY/BG Shimabuku Tatsuo Zhao Runting XY Wang Shujin XY/BG Robert Trias Douglas Grose Father of Karate in USA Shinto Yoshin-Ryu Jujutsu Shuri-Ryu Karatedo Shin Mei Shorin-Ryu Karate Shimabuku Kichiro Wang Peisheng Hong Yixiang XY/BG Uezu Angi Yin Cheng Gong Fa Hong Yimian XY/BG John Pachivas Stuart Dorow/Carol Liskai YCGF Wu TJ/XY/BG/QG Guo Fengchih XY/BG Shuri-Ryu Karatedo Tsuyoshi Uechi Goju-Ryu Karatedo Okinawan Kobudo Robert W. Smith Jujutsu/Judo Kodokan Judo Steven Roensch Pioneer of Chinese Ridgely Abele Dane Sutton Zhang Yun Shuri-Ryu Karatedo Shinto Yoshin Kai Jujutsu Internal Martial Arts in USA Shuri-Ryu Karatedo Isshinryu Karate/Kobudo Beijing YCGF TJ/XY/BG/QG Taiwan XY/BG Shuri-Te & US Jujutsu Other Influences [PJC] Paul J. -

Karate, Shiai Kumite
REVISTA BIMESTRAL DE ARTES MARCIALES Nº10 año II Entrevista exclusiva SYLVAIN GUINTARD Yamabushi Shogoin El camino del Shugendo y la herencia de Yumio Nawa, Fujita Seiko y Tanaka Fumon Feng Zhiqiang, in memoriam. Cuerpo Humano, 2ª parte Entrevista a Rubén Varona, 2ª parte El Yomogi y su esencia Cultivando el espíritu del Aikido Salud, ¡que no falte! 2ª parte Karate, Shiai Kumite QiQong, el trabajo interno, por Victor Fernández Sumario [email protected] 4 Noticias www.elbudoka.es 6 Entrevista a Sylvain Guintard. Por Xavier Teixidó Dirección, redacción, administración y publicidad: 14 Feng Zhiqiang (1928-2012). El último dragón. Por Jordi Vilà 22 El Yomogi y su esencia. Por Felip Caudet El Aikido de cerca… por Rubén Varona (2ª pte) 24 Editorial “Alas” C/ Villarroel, 124 Shiai Kumite. Pedagogía en el entrenamiento del Kumite. Por Jordi Sala 32 08011 Barcelona Telf y Fax: 93 453 75 06 Sesión de entrenamiento de “Aikido por la Vida” en Zaragoza. Por Alberto Marco Arcalá 40 [email protected] www.editorial-alas.com 44 Judo. Conchi Bellorín: “Soy lo que el Judo me ha hecho ser”. Por Ferrán Piqué Judo. Raquel Hernández: “El Judo es una brújula en mi vida”. Por Montse Coque 50 La dirección no se responsabiliza de las opiniones de sus colaboradores, ni siquiera las comparte. Cultivado un espíritu marcial. Por Stanley Pranin 54 La publicidad insertada en “El Budoka 2.0” es re- sponsabilidad única y exclusiva de los anunciantes. Qigong, el trabajo interno. Por Víctor Fernández 60 No se devuelven originales remitidos espontáneamente, ni se mantiene correspondencia Cuerpo humano (2). -

Evaluation of a Tai Chi Intervention to Promote Well-Being in Healthcare Staff: a Pilot Study
religions Article Evaluation of a Tai Chi Intervention to Promote Well-Being in Healthcare Staff: A Pilot Study David Marshall 1, Grainne Donohue 2,*, Jean Morrissey 3 and Brendan Power 1 1 Ballyfermot Mental Health Centre, Dublin 10, Ireland; [email protected] (D.M.); [email protected] (B.P.) 2 Trinity Centre for Practice and Healthcare Innovation, School of Nursing and Midwifery, Trinity College, University of Dublin, College Green, Dublin 2, Ireland 3 School of Nursing and Midwifery, Trinity College, University of Dublin, College Green, Dublin 2, Ireland; [email protected] * Correspondence: [email protected] Received: 1 November 2017; Accepted: 16 January 2018; Published: 24 January 2018 Abstract: Whilst healthcare professions are already considered one of the most stressful occupations, workplaces are becoming busier, and the potential for workplace absenteeism and burnout has intensified. There is growing evidence that the mind–body practice of Tai Chi, which originated in China as a martial art, has value in treating or preventing many health-related problems, such as stress and anxiety, and that regular practice helps to significantly improve wellbeing, attention, focus, and resilience. This intervention provided 12 sessions of Tai Chi for a group of 12 multidisciplinary healthcare workers and was general wellbeing was measured pre- and post-intervention. Using a mixed methods research design, it was discovered that there were statistically significant gains in well-being during this timeframe with results indicating a strong case for further roll out of the program to a larger pool and more extensive study. Keywords: Tai Chi; spirituality; healthcare workers; well-being 1. -

Wie Taijiquan Nach Peking Verbreitet Wurde (Ma Yueliang Teil 1)
Ma Yueliang erzählt Wie Taijiquan nach Beijing wagte es nicht ihn als Sohn [Yang] Banhou als euren Lehrer an. den Helden des Widerstands gegen die Schüler anzunehmen, Ausländer rechnen. Aber er hatte später verbreitet wurde denn zum einen hatte Die drei respektierten ihren Lehrer und niemanden, der seine Kampfkunst weiter- er einen Status als seine Anweisungen - sie taten wie die Leh- führte. Die anderen, die mal zwei oder drei Redigiert von Zhang Yaozhong Zhuangyuan aus den rer sie es hieß. Und so erkannten sie Yang Techniken erlernt hatten, hatten erst recht Militärprüfungen und Banhou als ihren Lehrer an, aber in Wirk- keine Nachfolger mehr. Ma Yueliang zum anderen war er lichkeit übten sie nach wie vor mit Yang Gehört und gesehen: Ma Yueliang (1901-98), ältester Schwiegersohn des Großmeisters des Wu-Familienstils ein General. Er war Luchan die Kampfkunst. Die übrigen: Wan Chun - ob er später einen des Taijiquan Wu Jianquan, und seine Frau Wu Yinghua waren beide berühmte Taijiquan-Adepten des Wu-Fa- somit eine Persön- Das Gongfu [hier i. S. v. das Können] der Nachfolger hatte? Ich habe bei meinen Be- milienstils. Was die Geschichte des Wushu in früheren Zeiten anbetrifft, so mangelt es schon immer an schriftli- lichkeit, die auf glei- drei war jeweils unterschiedlich: Wan Chun suchen keinen vorgefunden, der von ihm chen Materialien, die mündliche Überlieferung überwiegt. Zwar kann man diese‚ mündlich überlieferte Ge- cher Höhe mit den erlangte die harte Kraft, Ling Shan war gut die Kampfkunst erlernt hätte. Und auch schichte nicht abschließend als verlässliche Geschichte beurteilen, aber darin erhalten geblieben sind die An- kaiserlichen Prinzen darin Leute wegzuschleudern. -
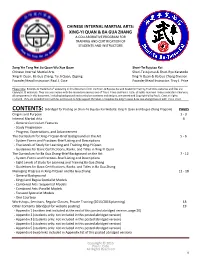
Xing-Yi Quan & Ba Gua Zhang
CHINESE INTERNAL MARTIAL ARTS: XING-YI QUAN & BA GUA ZHANG A COLLABORATIVE PROGRAM FOR TRAINING AND CERTIFICATION OF STUDENTS AND INSTRUCTORS Zong Yin Tang Nei Jia Quan Wu Xue Guan Shuri-Te Bujutsu Kai Chinese Internal Martial Arts Shuri-Te Jujutsu & Shuri-Ryu Karatedo Xing-Yi Quan, Ba Gua Zhang, Tai Ji Quan, Qigong Xing-Yi Quan & Ba Gua Zhang Division Founder/Head Instructor: Paul J. Cote Founder/Head Instructor: Troy J. Price __________________________________________________________________________________________________ Please note: Excerpts & Trademarks® appearing in this document from the Shuri-te Bujutsu Kai and Academic Training Traditions websites and files are Copyright © materials. They are used herein with the respective permissions of Troy J. Price and Paul J. Cote, all rights reserved. Unless indicated otherwise, all components in this document, including background and curriculum contents and designs, are owned and Copyright © by Paul J. Cote, all rights reserved. They are provided here with his permission to help support the Shuri-Te Bujutsu Kai Xing-Yi Quan & Ba Gua Zhang Division with Troy J. Price._____ CONTENTS: (Abridged for Posting on Shuri-Te Bujutsu Kai Website: Xing-Yi Quan and Ba gua Zhang Program) PAGES Origins and Purpose 1 - 3 Internal Martial Arts 4 - General Curriculum Features - Study Progression - Progress, Expectations, and Advancement The Curriculum for Xing-Yi Quan-Brief Background on the Art 5 - 6 - System Forms and Practices-Brief Listing and Descriptions - Five Levels of Study for Learning and Training -

WODCON XIX CHINA Beijing 9 ——14 Sep.2010 PROGRAMME and REGISTRATION INFORMATION
World Organization of Dredging Associations The second announcement WORLD DREDGING CONGRESS WODCON XIX CHINA Beijing 9 ——14 Sep.2010 PROGRAMME AND REGISTRATION INFORMATION “Dredging Makes The World A Better Place” Sponsored by Eastern Dredging Association China Dredging Association www.chida.org Table of Contents Welcome to Beijing Social activities ……………………………………………………………… 16 The date and venue of congress Registration information………………………………………………… 18 The programme of the congress……………………………………01 1. Registration Fees 2. Payment …………………………… ……02 The organization of the congress 3. Cancellation of Participation 1. The congress committee 4. Acknowledgement 2. The organizing committee 5. Registration 3. Technical committee Accommodation ……………………………………………………………… 18 The technical sessions……………………………………………………04 Transport ………………………………………………………………………… 19 1. The listing of accepted papers Climate …………………………………………………………………………… 19 2. The arrangement of papers 3. The language of congress Passport and Visa ………………………………………………………… 19 4. The presentation paper 5. The poster papers The Secretariat of the congress…………………………………… 19 6. The congress proceedings Insurance ………………………………………………………………………… 19 The exhibition………………………………………………………………… 12 Revise …………………………………………………………………………… 19 The technical visit ………………………………………………………… 13 Attachment……………………………………………………………………… 21 1. Tianjin Bin hai Area 2. Tianjin Museum 1. Registration form ………………………………………………………… 21 3. Tianjin Artificial Island 2. The ichnography of the exhibition ………………………………… 24 The post congress -

Magul Din Java
Despre cartea lui Kosta Danaos- Magul din Java About the book written by Kosta Danaos-The Magus of Java A propos du livre ecrit par Kosta Danaos -Le Mage de Java A proposito del libro scritto da Kosta Danaos-Il Mago di Giava Sobre el libro escrito por Kosta Danaos- El Mago de Java Magul din Java- Invataturile unui autentic nemuritor taoist de Kosta Danaos The Magus of Java-Teachings of an Authentic Taoist Immortal by Kosta Danaos Le Mage de Java : Enseignements d'un Immortel Taoïste Il mago di Giava. Risvegliare i nostri poteri latenti sotto la guida di un taoista immortale Traducere si comentarii de Dan Mirahorian Translation and commentary by Dan Mirahorian Traduction et commentaires par Dan Mirahorian Traduzione e commenti di Dan Mirahorian Traducción y comentarios por Dan Mirahorian Cuvant inainte Foreword Introducere Introduction Capitolul I -Privind prin oglinda -Primul contact Looking through the Mirror Taoismul practic Capitolul al II-lea Forta vitala -O calatorie cu masina Lifeforce Artele martiale si chi-ul Capitolul al III-Iea Inceputuri Beginnings Ucenicul Capitolul al IV-Iea Nemuritorii Povestea Maestrului The Immortals Hsien Revelatii Capitolul al V-Iea Povestea lui Liao Sifu The Story of Liao Sifu Duelul Nemuritorilor Capitolul al VI-lea Lectii de invatat . examenul Lessons to Be Learned Capitolul al VII-lea Yin si Yang Yin and Yang Capitolul al VIII-lea -Vola Cerului The Will of Heaven Capitolul al IX-lea Keris The Keris Printul Capitolul al X-lea Natura realitatii The Nature of Reality Epilog- Zabovesc vreme de o respiratie Epilogue Anexa intai Note Appendix One Anexa a doua Observatii si speculatii Appendix Two Conexiuni Legaturi Filme Cuvant inainte Cartea "Magul din Java" este povestea uceniciei lui Kosta Danaos/ Kostas Dervenis alături de John Chang – şi, în acelaşi timp, o dezvaluire a disciplinei interne nei kung(nei gong) de chi kung(qi gong) a scolii Mo-Pai, care, în ultimii 2000 de ani, şi-a ţinut secrete învăţăturile. -

Wang Peisheng Erzählt Über Das Taiji-Push-Hands: Auflösen, Hereinführen, Nehmen, Herausschleudern
1 Wang Peisheng erzählt über das Taiji-Push-Hands: Auflösen, Hereinführen, Nehmen, Herausschleudern Redigiert von Zhang Yaozhong Anmerkung des Redakteurs: Mitte Oktober 1985 gab Wang Peisheng 1 seinen Schülern im Areal des Fallschirmspringturms der städtischen Sportkommission Beijings am Longtan-See Unterricht im Taijiquan. Zwei Fragen, die damals die Mehrheit der Teilnehmer am meisten beschäftigten, waren zum einen das Auflösen, Hereinführen, Nehmen und Herausschleudern und zum andern der Zusammenhang zwischen Taijiquan und Qigong. Bei seinem Unterricht bezog sich der Meister keineswegs auf ein Manuskript, sondern beantwortete Fragen ad hoc. Im Folgenden werden die Erklärungen des Meisters zu der ersten Frage wiedergegeben. (Zusätzliche Anmerkung der Wuhun-Redaktion: Dieser Beitrag geht sehr ins Detail. Dabei handelt sich um Inhalte, die man ansonsten in einem gewöhnlichen Artikel auf keinen Fall zu zu Gesicht bekommt. Der Beitrag wurde auf Basis der damals gemachten Tonaufnahme redigiert, so dass das Live-Gefühl sehr stark herüber kommt. Da es sich um mündliche Rede handelt, kann dies beim Lesen etwas ausschweifend wirken. Aber um möglichst hohe Authentizität zu gewährleisten, haben wir beim Abdurck keine Veränderungen vorgenommen.) Die acht grundlegenden Methoden [bzw. Kräfte] des Taijiquan, ⇜ Peng [Schwellen], Lü [Streichen], Ji [Pressen], 㙬 Zhou [Ellbogen], 䴴 Kao [Anlehnen], ᣝ An [Drücken], ආ Cai [Pflücken] und ᣦ Lie [Spalten] beruhen alle auf den vier Zeichen [bzw. Begriffen] ࣪ Hua [Auflösen], ᓩ Yin [Hereinführen], ᣓ Na [in die Hand Nehmen], থ Fa [Herausschleudern]. Die vier Zeichen sind nichts anderes als vier Kräfte, nämlich auflösende Kraft [huajin], hereinführende Kraft [yinjin], in die Hand nehmende Kraft [najin] und herausschleudernde Kraft [fajin]. Früher sprach man gewöhnlich vom Hereinführen, Nehmen und Herausschleudern œ um den Gegner wegzuschleudern, muss es zunächst ein Hereinführen und Nehmen geben, dann erst kann es zum Herausschleudern kommen. -
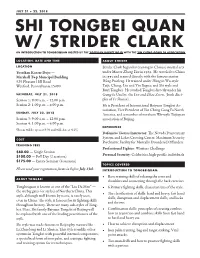
Strider Clark an Introduction to Tongbeiquan Hosted by the Yoseikan Karate Dojo with the Yin Cheng Gong Fa Association
JULY 21 + 22, 2018 SHI TONGBEI QUAN W/ STRIDER CLARK AN INTRODUCTION TO TONGBEIQUAN HOSTED BY THE YOSEIKAN KARATE DOJO WITH THE YIN CHENG GONG FA ASSOCIATION LOCATION, DATE AND TIME ABOUT STRIDER LOCATION Strider Clark began his training in Chinese martial arts Yoseikan Karate Dojo — under Master Zhang Yun in 1989. He traveled to China Marshall Twp Muncipal Building in 1993 and trained directly with the famous master 525 Pleasant Hill Road Wang Peisheng. He trained under Wa n g in Wu-style Wexford, Pennsylvania 15090 Taiji; Cheng, Liu and Yin Bagua; and Shi style and Ruyi Tongbei. He studied Tongbei directly under his SATURDAY, JULY 21, 2018 Gong-fu Uncles: Gu Yun and Zhao Zeren, (both disci- Session 1: 9:00 a.m. – 12:00 p.m. ples of Li Shusen). Session 2: 1:00 p.m. – 4:00 p.m. He is President of International Baiyuan Tongbei As- sociation, Vice President of Yin Cheng Gong Fa North SUNDAY, JULY 22, 2018 America, and a member of northern Wu-style Taijiquan Session 3: 9:00 a.m. – 12:00 p.m. association of Beijing. Session 4: 1:00 p.m. – 4:00 p.m. EXPERIENCE (Room will be open at 8:30 and will close at 4:15) Defensive Tactics Instructor: The Nevada Penitentiary COST System, and Lakes Crossing Center, Maximum Security Psychiatric Facility for Mentally Disordered Offenders TRAINING FEES Professional Fighter: Warriors Challenge $60.00 — Single Session Personal Security: Celebrities, high-profile individuals $100.00 — Full Day (2 sessions) $175.00 — Entire Seminar (4 sessions) TOPICS COVERED Please send your registration forms in before July 13th. -
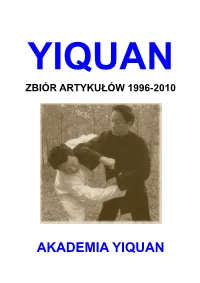
Zbiór Artykułów 1996-2010
YIQUAN ZBIÓR ARTYKUŁÓW 1996-2010 AKADEMIA YIQUAN SPIS TREŚCI AUTOR TYTUŁ STRONA Andrzej Kalisz Andegdoty yiquan 4 Chengbao zhuang 12 Dingbabu pingtui shili 15 Dingbu mocabu 17 Historia yiquan 19 Hunyuan zhuang 26 Hunyuan zhuang - kaihe mojin 29 Hunyuan zhuang – shang xia mojin 32 Ilustrowana oferta Akademii Yiquan 34 Koordynacyjne zdolności motoryczne i trening 36 mentalny Metody treningowe yiquan 43 Metoda zdrowotna zhan zhuang 52 Pekińscy mistrzowie yiquan 55 Pekińska szkoła Zongxun Wuguan 57 Pekińskie Towarzystwo Badawcze Yiquan 58 Pingbu pingtui shi li 60 Podstawowe zasady praktyki zhan zhuang dla 63 zdrowia Podstawy rozluźnienia 66 Podstawy yiquan –1 70 Podstawy yiquan – 2 71 Podstawy yiquan – 3 73 Podstawy yiquan – 4 75 Podstawy yiquan – 5 77 Podstawy yiquan – 6 78 Podstawy yiquan – 7 79 Podstawy yiquan – 8 80 Podstawy yiquan – 9 82 Podstawy yiquan – 10 84 Podstawy yiquan – 11 86 Pokazy mistrza Cui Ruibin 88 Pozycje leżące 90 Pozycje siedzące 93 Regulamin tui shou – 1 95 Regulamin tui shou – 2 96 Rozluźnienie w walce 98 Skuteczność zhan zhuang dla zdrowia – 1 100 Skuteczność zhan zhuang dla zdrowia – 2 103 Tai Chi i Yiquan – podobieństwa i różnice 105 Tui shou, a sparing 109 Tui shou w yiquan 111 W poszukiwaniu harmonii 114 Wątpliwości i pytania 115 Yao Chengguang 118 Yao Zongxun 122 2 Yiquan 126 Yiquan, a medycyna chińska 130 Yiquan, a tai chi, chi kung, joga 132 Yiquan, a filozofia wschodu 137 Yiquan, a skuteczność w walce 139 Yiquan – aktywność mentalna 149 Yiquan – boks mentalny 152 Yiquan (dachengquan) 156 Yiquan – dotrzeć do esencji sztuki walki 158 Yiquan – esencja kung-fu 162 Yiquan F.A.Q. -

Ta'i Chi Ch'uan
TAIJIQUAN (TA’I CHI CH’UAN) ZBIÓR ARTYKUŁÓW 1995-2010 AKADEMIA YIQUAN SPIS TREŚCI AUTOR TYTUŁ STRONA Andrzej Kalisz Chen Fake 3 Chen Gu’an 8 Chen Xiaowang 10 Chen Zhenglei 12 Feng Zhiqiang 14 Formy ręczne taijiquan 17 Niski poziom filozofii w „Taj Czi“ 21 Szybkość w taijiquan 28 Taoistyczne taijiquan 33 Taijiquan mistrza Feng Zhiqiang 35 Taijiquan – sztuka walki 40 Zhan Zhuang w taijiquan 46 Taijiquan i Yiquan – podobieństwa i różnice 49 Tui shou, a sparing 53 Podstawy rozluźnienia 55 Rozluźnienie w walce 59 Wang Xiangzhai O taijiquan 61 Yang Chengfu 10 zasad praktyki taijiquan 65 Opowieść o Yang Luchanie 68 2 ANDRZEJ KALISZ CHEN FAKE Najsłynniejszym w XX wieku mistrzem stylu Chen taijiquan był niewątpliwie Chen Fake (1887-1957). Gdy Chen Fake się urodził, jego ojciec Chen Yanxi dochodził już do sześćdziesiątki. Ponieważ dwóch z jego starszych braci młodo zmarło, młody Fake był przez rodziców traktowany jak oczko w głowie i bardzo rozpieszczany. Początkowo był bardzo chorowity. Chociaż uczył się taijiquan od ojca, niezbyt się do tego przykładał i jego umiejętności były przez kilka lat mizerne. Pewnego roku Chen Yanxi wyjechał, by nauczać taijiquan w innej miejscowości. Bez nadzoru ojca Fake jeszcze bardziej zaniedbał trening. Aż do momentu, gdy usłyszał rozmowę krewnych, wyrażających żal, że w tej linii rodu Chen do której należał jego ojciec, wszyscy przedstawiciele każdego pokolenia byli wybitnymi mistrzami; niestety Chen Fake nie rokuje żadnych nadziei. Poczuł ogromny wstyd i podjął decyzję, że musi stać się godnym kontynuatorem swych przodków. Przyjął wówczas regułę, by wykonywać co najmniej 30 powtórzeń formy dziennie (biorąc pod uwagę długość form taijiquan, można mieć wyobrażenie, jak wiele czasu musiał na to poświęcać). -

Brucebruce Kumkum
BruceBruce KumKum You’ve been practising Internal Arts for almost There are sixteen components to Qigong. 40 years and have gone through a range of Qigong is a modern term but if we go back different disciplines, could you tell me a little more than 50 years ago the term Neigong was about what you are teaching now? always used. If we talk about that, the whole thing about it is that the meridian lines are one What I primarily teach now is a six-part Taoist of the components. Breath work is another, as Qigong system that contains within it all the is working with the core channels of the body, building blocks. This Taoist Neigong seems to working with the secondary energies of the P1 be the root from which all other qigong systems body, working with the opening and closing of Bruce Kumar Frantzis, in China have obtained some, or the bulk of, the joints, the opening and closing of the spine, their information and capacities. I also teach working with the movement of the internal author and lineage Taiji & Bagua and I teach them two in ways. I organs…. all these are very distinct pieces. To master in the Taoist arts, teach the Short Form for the vast majority of try and learn all of them while you’re doing has been working since people, because that’s about as much as they either Taiji or Bagua is a virtually impossible 1961 in Eastern healing can do, and I also teach the Long Form. When task.