Vorwort Zur 3
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
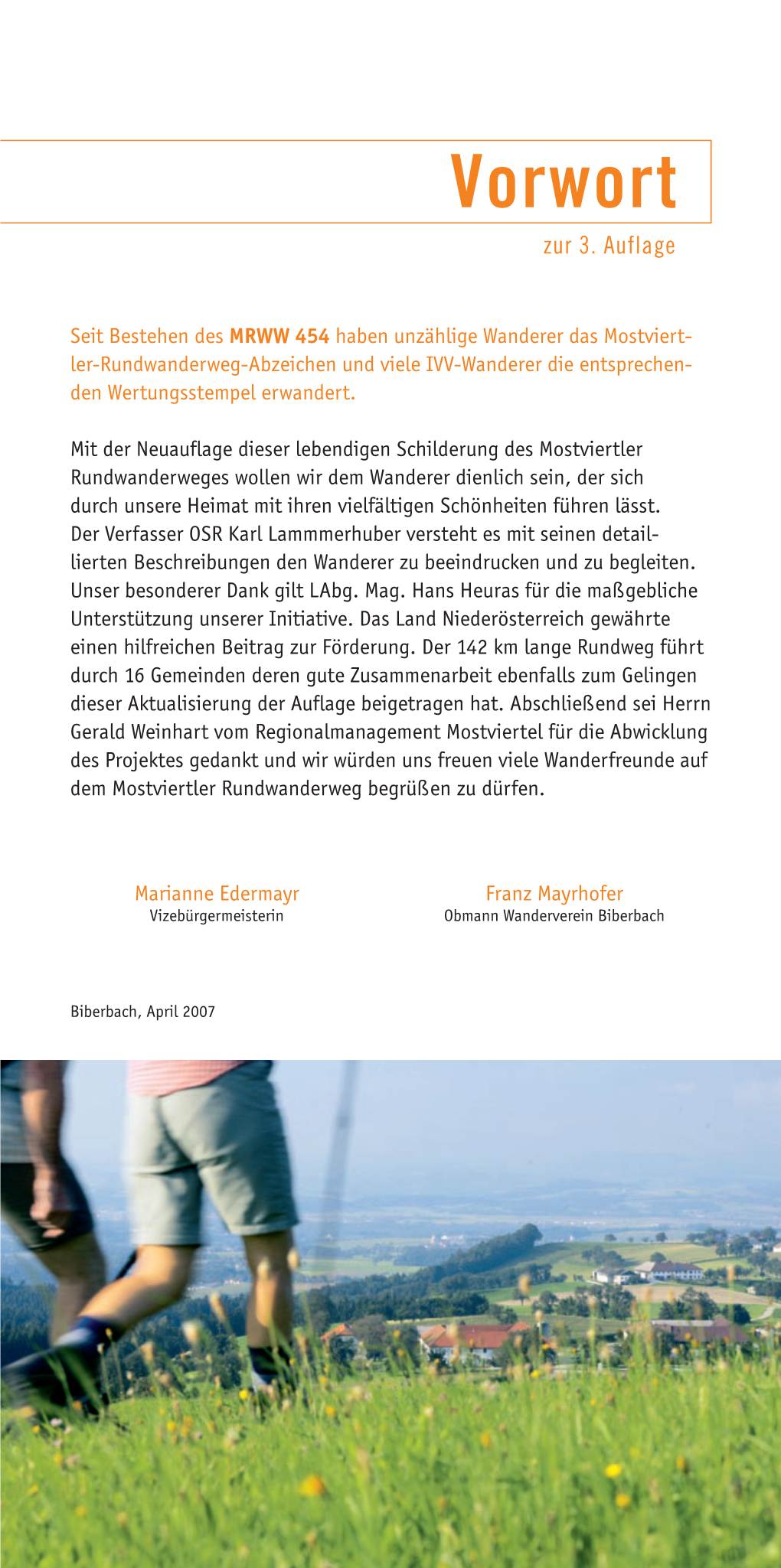
Load more
Recommended publications
-

Aufteilung Gemeinden Niederösterreich
Gemeinde Förderbetrag Krems an der Donau 499.005 St. Pölten 1.192.215 Waidhofen an der Ybbs 232.626 Wiener Neustadt 898.459 Allhartsberg 38.965 Amstetten 480.555 Ardagger 64.011 Aschbach-Markt 69.268 Behamberg 60.494 Biberbach 41.613 Ennsdorf 54.996 Ernsthofen 39.780 Ertl 23.342 Euratsfeld 48.110 Ferschnitz 31.765 Haag 101.903 Haidershofen 66.584 Hollenstein an der Ybbs 31.061 Kematen an der Ybbs 47.906 Neuhofen an der Ybbs 53.959 Neustadtl an der Donau 39.761 Oed-Oehling 35.097 Opponitz 18.048 St. Georgen am Reith 10.958 St. Georgen am Ybbsfelde 51.812 St. Pantaleon-Erla 47.703 St. Peter in der Au 94.276 St. Valentin 171.373 Seitenstetten 61.882 Sonntagberg 71.063 Strengberg 37.540 Viehdorf 25.230 Wallsee-Sindelburg 40.446 Weistrach 40.557 Winklarn 29.488 Wolfsbach 36.226 Ybbsitz 64.862 Zeillern 33.838 Alland 47.740 Altenmarkt an der Triesting 41.057 Bad Vöslau 219.013 Baden 525.579 Berndorf 167.262 Ebreichsdorf 199.686 Enzesfeld-Lindabrunn 78.579 Furth an der Triesting 15.660 Günselsdorf 32.320 Heiligenkreuz 28.766 Hernstein 28.192 Hirtenberg 47.036 Klausen-Leopoldsdorf 30.525 Kottingbrunn 137.092 Leobersdorf 91.055 Mitterndorf an der Fischa 45.259 Oberwaltersdorf 79.449 Pfaffstätten 64.825 Pottendorf 125.152 Pottenstein 54.330 Reisenberg 30.525 Schönau an der Triesting 38.799 Seibersdorf 26.619 Sooß 19.511 Tattendorf 26.674 Teesdorf 32.727 Traiskirchen 392.653 Trumau 67.509 Weissenbach an der Triesting 32.005 Blumau-Neurißhof 33.690 Au am Leithaberge 17.474 Bad Deutsch-Altenburg 29.599 Berg 15.938 Bruck an der Leitha 145.163 Enzersdorf an der Fischa 57.236 Göttlesbrunn-Arbesthal 25.915 Götzendorf an der Leitha 39.040 Hainburg a.d. -
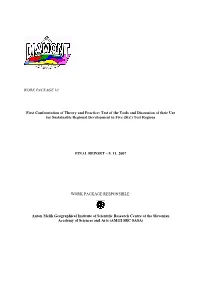
Part Report for Each Region Was Prepared
WORK PACKAGE 10 First Confrontation of Theory and Practice: Test of the Tools and Discussion of their Use for Sustainable Regional Development in Five (Six!) Test Regions FINAL REPORT – 9. 11. 2007 WORK PACKAGE RESPONSIBLE: Anton Melik Geographical Institute of Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (AMGI SRC SASA) CONTENT I. Introduction II. Methodology III. Searching for sustainable regional development in the Alps: Bottom-up approach IV. Workshops in selected test regions 1. Austria - Waidhofen/Ybbs 1.1. Context analysis of the test region 1.2. Preparation of the workshop 1.2.1. The organizational aspects of the workshop 1.3. List of selected instruments 1.4. List of stakeholders 1.5. The structure of the workshop 1.5.1. Information on the selection of respected thematic fields/focuses 1.6. Questions for each part of the workshop/ for each instrument 1.7. Revised answers 1.8. Confrontation of the context analysis results with the workshop results 1.9. Starting points for the second workshop 1.10. Conclusion 2. France – Gap 2.1. Context analysis of the test region 2.2. Preparation of the workshop 2.2.1. The organizational aspects of the workshop 2.3. List of selected instruments 2.4. List of stakeholders 2.5. The structure of the workshop 2.5.1. Information on the selection of respected thematic fields/focuses 2.6. Questions for each part of the workshop/ for each instrument 2.7. Revised answers 2.8. Confrontation of the context analysis results with the workshop results 2.9. Starting points for the second workshop 2.10. -

Amstetten 34.188 Stk
Amstetten 20.11.2019 / KW 47 / www.tips.at FF-Übung 50 Jugendliche und 20 Betreuer waren bei einer um- fangreichen Feuerwehr-Übung in Amstetten mit großem Engagement Unterwegs Die Amstettner Ulla Obereigner und Georg Grüßenberger reisten fünf Monate lang durch Afrika und Asi- im Einsatz. Seite 7 / Foto: Wolfgang Zarl en. In einem Vortrag berichten sie von faszinierenden Landschaften und spannenden Begegnungen. Seite 24 / Foto: Stefan Schimanko 34.188 Stk. | NÖ 174.869 Stk. | Gesamt 865.213 Stk. | Redaktion +43 72 (0)74 / 662 86 Aus Schulhaus wird Bildungscampus Nach mehrjähriger Bau- und Pla- Freitag: 9 – 18 Uhr Samstag: 9 – 16 Uhr nungsphase konnte das Bundes- Integrationspreis Energiegemeinden schulzentrum Amstetten, im Bei- Der Verein LEILA erhielt den 2. 32 Gemeinden erhielten eine sein von zahlreichen Ehren- und Integrationspreis. >> Seite 4 Energie-Auszeichnung. >> Seite 13 Österreichische Post AG | RM 09A038038K | 4010 Linz | Auflage Amstetten Festgästen, mit einem vielfältigen Christbaum aus Ertl ORF-Star zu Gast Programm eröffnet werden. Seit Der Christbaum fürs Landhaus St. Lou Lorenz-Dittlbacher infor- Beginn des Schuljahres 2019/2020 Pölten kommt aus Ertl. >> Seite 6 miert in Seitenstetten. >> Seite 24 sind etwa 800 Schüler sowie 90 29. & 30. November Fr und Sa, 14 Uhr : Mühlenführung (Freier Eintritt ) Lehrer von HAK/HAS und HLW ÖAAB-Wechsel Oratorium Verkostung unserer Spezialitäten: frisch gebackenes Brot aus unseren Backmisch- im neuen Gebäudekomplex bes- Lukas Michlmayr wird neuer Der Chor Amstetten Vokal lädt zu ungen mit Aufstrichen,Tee und Glühwein tens aufgehoben. Seite 8 Obmann im Bezirk. >> Seite 10 einem Konzert ein. >> Seite 26 2 Land & Leute Amstetten 47. Woche 2019 FOtOKunSt Drei Generationen der Fotografi e Stadt HaaG. -

Feuerwehr Aktuell
Freiwillige Feuerwehr Euratsfeld Wassergasse 27 71. Ausgabe 3324 Euratsfeld 23. Februar 2012 FEUERWEHR AKTUELL Einteilungen Termine Impfaktion Ausbildungsplan Kdt. Rudolf Katzengruber 1. Kdt. Stv. Leopold Winkler 2. Kdt. Stv. Maximilian Pruckner 1. Zkdt 2. Zkdt 3. Zkdt Gottfried Distelberger Helmut Mille Anton Wagner 1. Gkdt 2. Gkdt 3. Gkdt 4. Gkdt 5. Gkdt 6. Gkdt Koblinger J. Demel Al. Zeilhofer M. Steindl R. Lueger M. Distelberger M. Leiter des Verwaltungsdienst: Stadlbauer Bruno SB-AS: Mille Helmut Stv. LdV. Gassner Christian SB-Funk: Wagner Anton Gehilfe des LdV: Lautzky Johann SB-EDV: Steindl Rene Ausbilder: Hochholzer Gerald SB-Wasserdienst: Zeilhofer Martin FW. Arzt: Dr. Franz Josef Gabler SB-FMD: Groiss Peter Fahrmeister: Krammer Herbert SB-Schadstoff: Zehetgruber Roland Fahrmeister Gehilfe: Krammer Stefan Ordnerdienst: Wieser Josef Zeugmeister: Demel Anton Hausmeister: Mittergeber Roman Zeugmeister Gehilfe: Schlemmer Alfred 1. Zugtruppkdt.: Zeilinger Ch. FJ: Dr. Franz Alois Gabler, Katzengruber Michael, Prigl Reinhard, Vanek Christian Festobmann: Zeilinger Ch, Gassner Ch, Pruckner M Einsatzleiter • BR Rudolf Katzengruber • OBI Leopold Winkler • OBI Maximilian Pruckner • 1 Zkdt. OBM Gottfried Distelberger • 2 Zkdt. OBM Helmut Mille • Ausbildner OBM Gerald Hochholzer • 3 Zkdt. BM Anton Wagner • FA Dr. Franz Alois Gabler • ELFA Stv. Dr. Franz Josef Gabler • OLM Christian Zeilinger • ASB Johann Koblinger • V Christian Gassner • HVM Johann Lautzky • OLM Matthias Lueger • OLM Rene Steindl • OLM Alfred Demel • BM Anton Demel • BM Herbert Krammer • LM Martin Zeilhofer • LM Matthias Distelberger Wenn von allen angeführten Personen, keiner anwesend ist, ist immer derjenige Einsatzleiter, der den höheren Dienstgrad hat. Bei gleichem Dienstgrad, ist entscheidend, wer diesen schon länger trägt. Euratsfeld im Jänner 2012 Termine 2012 Jänner 06.01. -

Amstetten 33.334 Stk
Amstetten 04.01.2018 / KW 01 / www.tips.at „Last Call“ Vor der Neu- übernahme lud das Team des Cafés Zum Kuckuck noch einmal alle Stammgäste ein. Es spielten Hochzeitswelt Brautpaaren aus dem Bezirk Amstetten gelingt das Heiraten bei einem Besuch der „Hochzeitswelt“ die Wladigeroff-Brothers. Seite 2 am 6. und 7. Jänner im Palais Kaufmännischer Verein in Linz. www.hochzeitswelt.at Foto: Hochzeitswelt / Anzeige 33.334 Stk. | NÖ 347.064 Stk. | Gesamt 1.021.906 Stk. | RedaktionMarketing-lmpuls +43 (0)74 72 / 662 86 für Amstetten Auf ein Jahr voller Aktivitäten kann die Amstetten Marketing Trauer GmbH zurückblicken. Diese be- Große Trauer herrscht nach dem inhalteten unter anderem den Tod Andreas Steiners. >> Seite 3 Österreichische Post AG | RM 09A038038K | 4010 Linz ageitalienischen |Amstetten Aufl Markt, die Ein- Verantwortung kaufsnacht, den Mostviertler HAK-Schüler präsentierten das Advent im Schulpark, die Stille „Projekt Verantwortung“. >> Seite 5 Weihnacht im Schloss Ulmerfeld, den Stadtfl ohmarkt, den Street- Philharmonie foot-Market oder den Amstettner Philharmonie Oberes Mostvier- Weihnachtswald. Seite 7 tel lädt zum Konzert. >> Seite 21 Amstetten Land & Leute anzeigen / 01. WOCHe 2018 2 CAFÉ ZUM KUCKUCK „Last Call“ AMSTETTEN. Unter dem Motto „Last Call“ rief das Café Zum Kuckuck noch einmal alle Freun- de des Lokals auf zusammenzu- kommen, bevor es bis Frühjahr 2018 wegen eines Besitzerwech- sels geschlossen bleibt. Ingrid Mayerhofer, die bisherige Wirtin des Cafés Zum Kuckuck wechselte das Metier und das Café bekommt eine neue Besitzerin. Am 30. Dezember war das Café das letzte Mal in seiner alten Form geöffnet. An dem Tag waren alle Krumenacker Thomas Foto: Gäste eingeladen. -

Ybbstal- Radweg
Kulinarischer Abstecher In der Altstadt laden zahlreiche Kaffeehäuser höchster Qualität, bodenständige Wirtshäuser, Restaurants und Lokale mit über 20 gemütlichen Schanigärten zum Verweilen ein. Für das Picknick zwischendurch bieten die Bäckereien und Lebensmittel-Geschäfte allerlei Snacks. ... leben voller Möglichkeiten ... leben voller Möglichkeiten Ybbstaler Alpen Infobüro Waidhofen Schlossweg 2 Ybbstal- 3340 Waidhofen a/d Ybbs T +43 7442 930 49 [email protected] www.ybbstaler-alpen.at radweg Ybbs a. d. Ausfahrt Donau Gastgeber mit Herz Linz Amstetten West Wien Waidhofen Stadt Ob Pension, Privatzimmer oder Sterne-Hotel – direkt A1 an der Route gibt es garantiert die passende Unterkunft Route, Angebot und Linz Wien Amstetten Wieselburg für müde Radler. Die aktuelle Zimmerliste ist im Neuhofen Purgstall Infobüro oder unter www.waidhofen.at/unterkuenfte Seitenstetten Service Rosenau am erhältlich. Sonntagberg Scheibbs Ybbsitz Service für Radler Die Altstadt bietet genug Radl-Ständer und kostenloseGraz Großraming E-Bike-Ladestationen (E). Weyer Lunz am See Legende Bahn Straße Ybbstalradweg Radverleih, Service, Sportmode Kleinreifling Radsport Ginner (A), Ybbstorgasse 5, T+43 7442 553 43 Sportmode Sport Harreither (B), Unterer Stadtplatz 9, Herausgeber & Verleger: Verein Stadtmarketing I Fotos: Josef Herfert | Fehler & Änderungen T+43 7442 526 78 vorbehalten | ©2017 alle Rechte vorbehalten www.waidhofen.at www.waidhofen.at 121 Raifberg Kläranlage Schilchermühle u W a iten iener h Sieghartsberg el s S t tr e r a R r e ß a e ß m e ö Sonnleitner-Siedlung R Himbrechtsöd Das Herzstück Nußbaum Schilchermühle Als Start, Ziel oder Etappe eignet sich Waidhofen besweg - ben Ybbs ra Südtiroler tens. Beim Hauptbahnhof beginnt das Herzstückrg des de Pl. -

Das Benediktinerstift Seitenstetten in Den Jahren 1602
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich Jahr/Year: 1913 Band/Volume: 12 Autor(en)/Author(s): Riesenhuber Martin Artikel/Article: Das Benediktinerstift Seitenstetten in den Jahren 1602-1648 1-78 ©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html Das Benediktinerstift Seitenstetten in den Jahren 1602—1648. Von F. Martin Kiesenhuber. 0. S. B. Nachstehende Abhandlung wurde veranlaßt durch die Voll endung des VIII. Jahrhunderts von seiten des Benediktinerklosters Seitenstetten, das 1112 gegründet und 1114 zur Abtei erhoben ward. Die Arbeit behandelt die Tätigkeit der Äbte Bernhard Schilling (1602—1610), Kaspar von Plautz (1610—1627) und Plazidus Bern hard (1627—1648), macht uns also bekannt mit dem Zustande und den Geschicken des Trefflingklosters vor 300 Jahren. — Bezüglich der Quellen bot das Stiftsarchiv die reichste Ausbeute. Viele für diesen Zeitraum sehr wichtige Schriftstücke birgt das stiftliche Archiv von Kremsmünster; die dortige Archiv-Vorstehung hat sie mir in zuvorkommendster Weise zur Verfügung gestellt. Mit ebenso dankenswerter Freundlichkeit wurde mir von der Vorstehung der Melker Stiftsbibliothek die Handschrift Nr. 1000, in der die Annalen des Wolfgang Lindner enthalten sind, überlassen. Diese Annalen hat K. Schiffmann, freilich nur mit Wiedergabe des auf Oberöster reich bezüglichen Textes, veröffentlicht (vgl. Anmerkung unten). Was sich darin über Seitenstetten findet, wurde nach Schiffmann zitiert, da diese Angabe den Interessenten leichter und bequemlicher er reichbar ist als die umfangreiche, plumpe Handschrift zu Melk. Für jene auf Seitenstetten bezüglichen Daten, die jedoch nur im er wähnten Manuskripte enthalten sind, wurde aber die Handschrift zitiert. -

Networked Thinking Renewable Energy and Supply Security
EVN Full Report 2013/14 EVN Full Networked thinking Renewable energy and supply security EVN Full Report 2013/14 58122P_EVN.GB_E.14_Umschlag_einzelseiten.indd 1 01.12.14 17:29 When you think of renewable energy Renewable energy will shape the energy future. But to use it efficiently and effectively, we need intelligent networks that can meet the added technical challenges. EVN has addressed these challenges for many years with massive investments in renewable energy generation plants and the expansion of its smart grids. 58122P_EVN.GB_E.14_Umschlag_einzelseiten.indd 2 27.11.14 22:3401.12.14 17:29 Key figures Change 1) 2013/14 2012/13 nominal in % Employees Sales volumes Number of employees Electricity generation volumes GWh 4,395 3,701 694 18.7 thereof Austria thereof from renewable energy GWh 1,868 1,954 –86 –4.4 thereof abroad Electricity sales volumes to end customers GWh 19,317 20,209 –891 –4.4 Employee fluctuation Natural gas sales volumes to end customers GWh 5,383 6,333 –950 –15.0 Proportion of women Heat sales volumes to end customers GWh 1,991 2,062 –71 –3.4 Training hours per employee Consolidated statement of operations Number of occupational accidents Revenue EURm 1,974.8 2,105.9 –131.0 –6.2 EBITDA EURm 184.1 540.0 –356.0 –65.9 Environment EBITDA margin2) % 9.3 25.6 –16.3 – Quantity of CO Results from operating activities (EBIT) EURm –341.4 242.2 –583.6 – NOX EBIT margin2) % –17.3 11.5 –28.8 – Hazardous waste Result before income tax EURm –373.3 170.7 –544.0 – Water consumption (drinking and process water) EURm Group net result -

Flood Action Plan for Austrian Danube
!£¥©ØÆ 0 °≠ • /¶ ®• )• °©°¨ # ©≥≥© ¶ ®• 0 •£© ¶ ®• $°• 2©• ¶ 3≥°©°¨• &¨§ 0 •£© 4®• $°• 3°≥© ¶ ®• !≥ ©° $°• !£¥© 0≤Øß≤°≠≠• /¶ ®• )• °©°¨ # ©≥≥© ¶ ®• 0 •£© ¶ ®• $°• 2©• ¶ 3≥°©°¨• &¨§ 0 •£© 32• ®• $°• 3°≥© !≥ ©° $°• 2 4°¨• ¶ #•≥ 1 Introduction.................................................................................................................... 5 1.1 Reason for the study ........................................................................................ 5 1.2 Aims and Measures of the Action Programme................................................ 6 1.3 Aim of the “Austrian Danube” Sub-Report ..................................................... 7 2 Characterisation of the Current Situation .................................................................... 8 3 Target Settings..............................................................................................................12 3.1 Long-Term Flood Protection Strategy............................................................12 3.2 Regulations on Land Use and Spatial Planning............................................16 3.3 Reactivation of former, and creation of new, retention and detention capacities.........................................................................................................24 3.4 Technical Flood Protection .............................................................................27 3.5 Preventive Actions – Optimising Flood Forecasting and the Flood Warning System.............................................................................................................42 -

Bezirk Amstetten
Bei den folgenden öffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen handelt es sich um ganztägige Schulformen, die von der Bildungsdirektion für Niederösterreich bewilligt wurden. Ob im laufenden Schuljahr eine bzw. mehrere Gruppen in der Nachmittagsbetreuung tatsächlich geführt werden, ist bei der jeweiligen Schulleitung zu erfragen. Bezirk Amstetten VS Allhartsberg schulübergreifend mit NÖMS Allhartsberg VS Amstetten, Allersdorferstraße VS Amstetten, Elsa Brandström-Straße VS Amstetten, Hausmening VS Amstetten, Preinsbacherstraße VS Ardagger schulübergreifend mit NÖMS Ardagger VS Aschbach-Markt schulübergreifend mit NÖMS Aschbach-Markt VS Behamberg VS Biberbach VS Ernsthofen VS Euratsfeld schulübergreifend mit NÖMS Euratsfeld VS Haag VS Haidershofen VS Hollenstein an der Ybbs schulübergreifend mit NÖMS Hollenstein an der Ybbs VS Kematen an der Ybbs VS Neuhofen an der Ybbs schulübergreifend mit NÖMS Neuhofen an der Ybbs VS Neustadtl an der Donau VS Oed-Öhling, Oed VS Oed-Öhling, Öhling VS St. Georgen am Ybbsfelde VS St. Pantaleon-Erla VS St. Peter in der Au VS Seitenstetten VS Sonntagberg, Rosenau schulübergreifend mit NÖMS Sonntagberg, Rosenau VS Strengberg VS Viehdorf VS Wallsee-Sindelburg VS Weistrach VS Wolfsbach schulübergreifend mit NÖMS Wolfsbach VS Winklarn VS Zeillern NÖMS Amstetten, Hausmening NÖMS Amstetten, Mauer NÖMS Amstetten, Pestalozzistraße NÖMS St. Valentin, Langenhart NÖMS St. Valentin, Schubertviertel NÖMS Seitenstetten NÖMS Strengberg NÖMS Wallsee-Sindelburg ASO Haag schulübergreifend mit NÖMS Haag ASO St. Valentin -

Strengberg Broschüre I Stand: 25.06.2021
Willkommen in Strengberg Broschüre I Stand: 25.06.2021 Vereine: Chor Strengberg FF Strengberg FF Thürnbuch/Au Trachtenkapelle Goldhauben u. Hammerherren Imkerverein Jagdhornbläser Kameradschaftsbund mostviertel.com Katholische Frauenbewegung Landjugend Kulturkreis Strengberg MGV Strengberg Pfarrbücherei Pensionistenverband Seniorenbund Motorsportclub Sektion Kampfsport Sektion Stocksport Sektion Tennis FCU Traktorfreunde Westwinkel Freizeitangebot: Sportplätze Campingplatz Gauning Wanderwege Drahteselmuseum Reitstall Prexl FEBS Gastronomie: GH Pambalk-Blumauer Buon Gusto Hotel Vösenhuber Mostheuriger Mayr z‘ Grub Wolf’s Revier Raststätte Landzeit Mostheuriger Schoder Wirt z‘ Thürnbuch Gasthaus Zeilinger Schulwesen: Mittelschule Volksschule Kindergarten und TBE Pfarre: Messe Jungschar Ministranten Direktvermarkter: Übersicht Direktvermarkter Unternehmen: Unternehmensliste (A-Z) Marktgemeinde Strengberg I Markt 10, 3314 Strengberg, 07432/2214, Fax DW 8, [email protected] www.strengberg.gv.at Das bietet Strengberg Vorwort der Gemeinde Sehr geehrte Damen und Herren! Schön, dass Sie sich für Strengberg entschieden haben. In Strengberg stellen Vereine eine wichtige ge- sellschaftliche Stütze und einen unersetzbaren Faktor der Lebensqualität in einer Gemeinde dar. Diese Lebensqualität wird durch das Ausrücken bei Unfällen oder Bränden, die Organisation von Veranstaltun- gen, die Durchführung von wohltätigen Aktionen, die Bereitstellung von sportlichen oder freizeitlichen An- geboten oder auch die Umrahmung und Mitgestaltung von besonderen -

PDF-Dokument
Bundesland Niederösterreich Kurztitel 1. NÖ Gemeindeverbändeverordnung Kundmachungsorgan LGBl. 1600/2-57 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 96/2020 Typ V §/Artikel/Anlage § 33 Inkrafttretensdatum 08.12.2020 Index 16 Verwaltungsgemeinschaften und Gemeindeverbände Text § 33 Gemeindedienstleistungsverband Region Amstetten für Umweltschutz und Abgaben (1) Die von den Gemeinden Allhartsberg, Amstetten, Ardagger, Aschbach-Markt, Behamberg, Biberbach, Ennsdorf, Ernsthofen, Ertl, Euratsfeld, Ferschnitz, Haag, Haidershofen, Hollenstein an der Ybbs, Kematen an der Ybbs, Neuhofen an der Ybbs, Neustadtl an der Donau, Oed-Öhling, Opponitz, St. Georgen am Reith, St. Georgen am Ybbsfeld, St. Pantaleon-Erla, St. Peter in der Au, St. Valentin, Seitenstetten, Sonntagberg, Strengberg, Viehdorf, Wallsee-Sindelburg, Weistrach, Winklarn, Wolfsbach, Ybbsitz, Zeillern und der Stadt mit eigenem Statut Waidhofen an der Ybbs beschlossene Bildung des Gemeindeverbandes “Gemeindeverband für Abfallbehandlung Amstetten” wird genehmigt. Die Verbandsbildung wurde am 1. Jänner 1989 wirksam. (2) Die von der Verbandsversammlung am 3. Juli 1989 beschlossene Änderung der Satzung (§ 6 Abs. 1 und 6) wird genehmigt. Die Satzungsänderung wird am 1. Jänner 1990 wirksam. (3) Die von allen verbandsangehörigen Gemeinden sowie von der Verbandsversammlung am 27. November 1989 beschlossene Änderung der Satzung (§ 1, § 3, § 13 und § 14 Abs. 1) werden genehmigt. Die Satzungsänderung wird am 1. Jänner 1991 wirksam. (4) Die von den Gemeinden Allhartsberg, Ardagger, Ernsthofen, Ertl, Ferschnitz, Haag, Kematen an der Ybbs, St. Pantaleon-Erla, St. Peter in der Au, Strengberg, Wallsee-Sindelburg, Weistrach, Wolfsbach und Viehdorf sowie die von der Verbandsversammlung am 21. April 1992 beschlossene Änderung der Satzung (§ 3) wird genehmigt. Die Satzungsänderung wurde am 1. Juli 1992 wirksam. (5) Die Übertragung der Vollziehung des NÖ Abfallwirtschaftsgesetzes durch die Gemeinden Behamberg, Biberbach, Haidershofen, Hollenstein an der Ybbs, Neustadtl an der Donau, Oed-Öhling, Opponitz, St.