Alting, Menso
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Approach to Early School Leaving
1 The approach to Early School Leaving Policy in the Netherlands and the fi gures of the 2011-2012 performance agreements This is a publication of the Ministry of Education, Culture and Science The Netherlands Production: Directie MBO, kwaliteitsafspraak VSV www.aanvalopschooluitval.nl www.vsvverkenner.nl Design: Balyon, www.balyon.com December 2013 No rights can be derived from this publication. www.aanvalopschooluitval.nl vsv-percentage 2011-2012 minder dan 2,6% 2,7 - 3,1% 3,2 - 3,6% meer dan 3,6% 2 2 4 3 RMC regions with contact municipalities Source: DUO 1 RMC region Contact municipalities 5 6 7 1 Oost-Groningen Veendam 23 9 8 2 Noord-Groningen-Eemsmond Delfzijl 22 3 Centraal en Westelijk Groningen 24 Groningen 10 4 Friesland Noord Leeuwarden 18 25 21 5 Zuid-West Friesland Súdwest Fryslân 17 12 6 Friesland-Oost Smallingerland 20 26 11 7 Noord- en Midden Drenthe Assen 16 28 27 19 8 Zuid-Oost Drenthe Emmen 13 9 Zuid-West Drenthe Hoogeveen 14 29 15 10 IJssel-vecht Zwolle 30 11 Stedendriehoek Apeldoorn 36 12 Twente Enschede 34 35 32 31 13 Achterhoek Doetinchem 37 14 Arnhem/Nijmegen Nijmegen 38 33 15 Rivierenland Tiel 16 Eem en Vallei Amersfoort 17 Noordwest-Veluwe Harderwijk 18 Flevoland Lelystad Overview of RMC regions in the Netherlands 39 19 Utrecht Utrecht Source: DUO 20 Gooi en Vechtstreek Hilversum 21 Agglomeratie Amsterdam Amsterdam 22 West-Friesland Hoorn This booklet comprises maps for national and regional level . The above map serves 23 Kop van Noord-Holland Den Helder as a navigation aid (together with the list of RMC regions) when using the booklet . -

Megalithic Research in the Netherlands, 1547-1911
J.A. B A KKER Megalithic Research in the Netherlands The impressive megalithic tombs in the northeastern Netherlands are called ‘hunebedden’, meaning ‘Giants’ graves’. These enigmatic Neolithic structures date to around 3000 BC and were built by the Funnelbeaker, or TRB, people. The current interpretation of these monuments, however, is the result of over 400 years of megalithic research, the history of which is recorded in this book. The medieval idea that only giants could have put the huge boulders of which they were made into position was still defended in 1660. Others did not venture to MEG explain how hunebeds could have been constructed, but ascribed them to the most I ancient, normally sized inhabitants. 16th-century writings speculated that Tacitus was N THE NETHE referring to hunebeds when he wrote about the ‘Pillars of Hercules’ in Germania. A Titia Brongersma is the first person recorded to do excavations in a hunebed, in LITHIC RESE 1685. The human bones she excavated were from normally sized men and suggested that such men, not giants, had constructed the hunebeds. Other haphazard diggings followed, but much worse was the invention of stone covered dikes which required large amounts of stone. This launched a widespread collection of erratic boulders, which included the hunebeds. Boundary stones were stolen and several hunebeds R were seriously damaged or they vanished completely. Such actions were forbidden in L an 1734, by one of the earliest laws protecting prehistoric monuments in the world. ar DS From the mid 18th century onwards a variety of eminent but relatively unknown CH researchers studied the hunebeds, including Van Lier (1760), Camper and son (1768- 1808), Westendorp (1815), Lukis and Dryden (1878) and Pleyte (1877-1902). -

2006 Fall Journal 9.2.Qxd
Journal of Markets & Morality Volume 9, Number 2 (Fall 2006): 399–483 Copyright © 2006 Selections from Johannes Althusius Translation by Jeffrey J. Veenstra the Dicaeologicae Introduction by Stephen J. Grabill 399 Selections from the Dicaeologicae Contents Introduction by Stephen J. Grabill iii Title Page 1 Preface 3 On Common Law (Book 1, Chapter 13) 7 On the Individual, Principal Law (Book 1, Chapter 14) 19 On Public Power in General (Book 1, Chapter 32) 29 On Limited Public Power (Book 1, Chapter 33) 39 i 401 Selections from the Dicaeologicae Introduction Biographical Sketch Johannes Althusius, whose surname appears variously as Althus, Althusen, or Althaus, was born in 1557 at Diedenshausen, a village in the countship of Witgenstein-Berleburg.1 Very little is known for certain of his parents, his youth, or his early course of studies. He appeared at Cologne in 1581, where he apparently studied the writings of Aristotle. At some point prior to obtain- ing his doctorate, Althusius also studied law at Geneva with Denis Godefroy (1549–1622), the renowned legal scholar who published the first complete edi- tion of Roman Civil Law in 1583.2 He received his doctorate in both civil and canon law at Basel in 1586. Astonishingly, he published his first book Jurisprudentiae Romanae, which was a systematic treatise on Roman law based on the Godefroy edition, during the same year. While at Basel, he lived for a time in the home of Johannes Grynaeus (1540–1617), with whom he studied Reformed theology and thereafter maintained a lifelong correspon- dence. In 1586, he accepted a call to teach in the newly founded law faculty in the Reformed Academy at Herborn. -

Sixteenth Century Society and Conference S Thursday, 17 October to Sunday, 20 October 2019
Sixteenth Century Society and Conference S Thursday, 17 October to Sunday, 20 October 2019 Cover Picture: Hans Burgkmair, Portrait of the Holy Roman Emperor Maximilian I (1459–1519) (1518). Rijksmuseum, Amsterdam. Sixteenth Century Society & Conference 17–20 October 2019 2019 OFFICERS President: Walter S. Melion Vice-President: Andrew Spicer Past-President: Kathleen M. Comerford Executive Director: Bruce Janacek Financialo Officer: Eric Nelson COUNCIL Class of 2019: Brian Sandberg, Daniel T. Lochman, Suzanne Magnanini, Thomas L. Herron Class of 2020: David C. Mayes, Charles H. Parker, Carin Franzén, Scott C. Lucas Class of 2021: Sara Beam, Jasono Powell, Ayesha Ramachandran, Michael Sherberg ACLS REPRESENTATIVE oKathryn Edwards PROGRAM COMMITTEE Chair: Andrew Spicer Art History: James Clifton Digital Humanities: Suzanne Sutherland English Literature: Scott C. Lucas French Literature: Scott M. Francis German Studies: Jennifer Welsh History: Janis M. Gibbs Interdisciplinary: Andrew Spicer Italian Studies: Jennifer Haraguchi Pedagogy: Chris Barrett Science and Medicine: Chad D. Gunnoe Spanish and Latin American Studies: Nieves Romero-Diaz Theology:o Rady Roldán-Figueroa NOMINATING COMMITTEE Amy E. Leonard, Beth Quitslund, Jeffreyo R. Watt, Thomas Robisheaux, Elizabeth A. Lehfeldt ENDOWMENT CHAIRS Susano Dinan and James Clifton SIXTEENTH CENTURY SOCIETY & CONFERENCE FIFTIETH ANNIVERSARY COMMITTEE Sheila ffolliott (Chair) Kathryn Brammall, Kathleen M. Comerford, Gary Gibbs, Whitney A. M. Leeson, Ray Waddington, Merry Wiesner-Hanks Waltero S. Melion (ex officio) 2019 SCSC PRIZE COMMITTEES Founders’ Prize Karen Spierling, Stephanie Dickey, Wim François Gerald Strauss Book Prize David Luebke, Jesse Spohnholz, Jennifer Welsh Bainton Art & Music History Book Prize Bret Rothstein, Lia Markey, Jessica Weiss Bainton History/Theology Book Prize Barbara Pitkin, Tryntje Helfferich, Haruko Ward Bainton Literature Book Prize Deanne Williams, Thomas L. -

Menso Alting Und Seine Zeit
Menso Alting und seine Zeit Vor 400 Jahren starb der Prediger und Theologe Menso Alting – ein streitbarer Calvinist, dessen Wirken weit über Emden und Groningen hinausreichte. Das Ostfriesische Landesmuseum Emden und die Johannes a Lasco Bibliothek erinnern in einer Gemeinschaftsausstellung an den Kirchenmann der Reformationszeit und der folgenden Zeit der Konfessionalisierung. Die kulturhistorische Präsentation versteht sich als prägnanter Auftakt zum „Reformationsjubiläum 2017“ – aus der zur „Reformationsstadt“ erklärten Stadt Emden. ls Menso Alting am 10. Juni 1575 in der Gast- Ahauskirche von Emden predigte, ahnte er nicht, dass er wenige Monate später in der Stadt ansässig werden würde – und bis an sein Lebensende bliebe. Er war in jenen Tagen nur auf „Dem besten, frömmsten und berühmtesten Mann, Menso Alting, der Durchreise gewesen, um dem wirklich hervorragenden Theologen, der Christus beim seine Eltern zu besuchen, Weiden der Kirche 45 Jahre hindurch treu gedient hat … die im niederländischen Er kam in den Himmel im Jahre der christlichen Zeitrechnung Eelde lebten, wo er am 9. 1612 am 7. Oktober. Diese Inschrift verfasste für den ihm eng November 1541 das Licht verbundenen Freund sein Freund Ubbo Emmius.“ der Welt er blickt hatte. Doch seine Predigt hatte Auszug aus Menso Altings Grabsteininschrift, die der Theologe begeistert und, so berichte- Ubbo Emmius (1547-1625) für seinen Freund verfasste. te Alting später selbst: „da zu dieser Zeit die Diener der Emder Kirche infolge der Pest gestorben waren, schickten der berühmte Herr Johann, Graf von Ost- friesland, der Senat von Em- den und das Presbyterium Briefe und einen Boten an Friedrich III., den Kurfürs- ten von der Pfalz, und baten ihn dringend darum, dass er mich der damals so geschä- digten Kirche in Emden ab- gebe .. -

Sterben Und Tod Im Spiegel Frühneuzeitlicher Gelegenheitsschriften in Nordwestdeutschland
247 Sterben und Tod im Spiegel frühneuzeitlicher Gelegenheitsschriften in Nordwestdeutschland Matthias Bollmeyer Neben diversen Formen von gegenständlicher oder zeremonieller Überlieferung und Tradition hat der Umgang mit dem Sterben, dem Tod und der Bestattung auch zahlreiche sprachliche, textliche, dokumentarische und literarische Resonanzen erfahren. Diesbezüglich sind als Textzeugen im Allgemeinen Grabsteine u.ä., Inschriften, Akten und Archivalien, historische und literarische Verarbeitungen ebenso zu nennen wie Gelegenheitsschriften, die im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen stehen sollen. 1 Die Gelegenheitsschriften machen den größten Teil der gesamten frühneuzeitlichen Druckproduktion aus. Die kulturhistorischen Merkmale von Leichenpredigten und sonstigen Trauerschriften werden am Beispiel einer bei der Geburt ihres Kindes verstorbenen Frau im vorletzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts im Kontext der Stadt Hannover folgendermaßen kommentiert: „Was vor 200 Jahren einem unglücklichen Leichen-Gefolge von poetischen Gemüthern zugemuthet wurde, erscheint unglaublich. Nachdem bei dem Leichenbegängniß [...] vom [...] Pastor [...] eine 64 Druckseiten fassende Leichen-Predigt gehalten, verherrlichte ein Candidatus juris ‚die durch ihre Fruchtbarkeit Erstorbene-Aloe‘ in einer Ellen langen Abdankungsrede.“ 2 Der Verfasser dieser Anmerkungen weist in seinen sehr direkt gewählten Worten auf einige wesentliche Merkmale der frühneuzeitlichen Gelegenheitsschriften zur Thematik des Todes hin: Er erwähnt den im Verhältnis zur Individualität -

Annual Report 2016
Annual report 2016 share your talent. move the world. 6 Contents Preface 2 Strategic themes 5 - Energy 6 - Healthy Ageing 10 - Entrepreneurship 14 Excellent university of applied sciences 18 Top degree programmes 20 Key figures 22 The organisation 24 Key figures schools 28 Performance indicators 30 Award winners 57 Illustrations: Debora Westra, student Design (Illustration), Minerva Art Academy Preface In the spring of 2016, we presented our new an economy that relies on renewable – green – raw materials strategic plan: ‘Innovating Together’. This plan rather than fossil fuel resources. Applied research leads to new biobased products, processes and industry. It is our way of focuses on our social mandate. We want to supporting the transition to a more sustainable world. prepare students for professional practice and In 2016, we also definitively concluded the previous strategic to support their development as independent, period. We have achieved many of our ambitions in the past critical and responsible citizens. few years. Our results with regard to the 2012 performance agreements we made with the Ministry of Education, Culture and Science received a positive review in 2016. This is an We also respond to an increasing demand from society and the extremely satisfying outcome; we would like to express our professional field, asking us to transform knowledge acquired from compliments to everyone who contributed to making this 2 fundamental research into innovation in professional practice. To happen. Together, we have enhanced the quality of our teaching 3 achieve this aim, we are developing into a learning community: and research, providing us with a firm foundation for the years a place where students, lecturer-researchers and professionals to come. -

Een Christelijk-Sociaal Pleidooi
Vrijheid - Vrijheid Vrijheid Een christelijk-sociaal pleidooi Een christelijk-sociaal pleidooi Vrijheid Heeft het bijzonder onderwijs toekomst? Blijft er ruimte voor christelijke zorginstellingen? Bestaat het recht op privacy nog in tijden van terrorisme? Mogen burgers en politici altijd zeggen wat ze denken? Vragen die laten zien dat vrijheid geen vanzelfsprekend bezit is, ook niet in het Nederland van vandaag. Deze bundel toont de christelijke wortels van onze vrijheden aan en laat zien hoe die in Nederland zijn uitgegroeid tot een veelzijdige civil society en een stevige democratische rechtsstaat. Vanuit verschillende invalshoeken G.J. Spijker (red.) wil dit pleidooi het huidige vrijheidsdebat een stap verder brengen door het opnieuw te verbinden met de christelijk-sociale traditie. Met onder meer bijdragen van Gijsbert van den Brink, Beatrice de Graaf, Stefan Paas, Jan van der Stoep, Kars Veling en een interview met André Rouvoet. Een christelijk-sociaal pleidooi G.J. Spijker (red.) ISBN: 978-90-71075-14-8 V Vrijheid Vrijheid Een christelijk-sociaal pleidooi G.J. Spijker (red.) G. Groen van Prinstererstichting Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie Buijten & Schipperheijn Motief - Amsterdam Colofon Eerste druk: oktober 2010 © oktober 2010, G.J. Spijker (red.) Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende en de uitgever. ISBN 978-90-71075-14-8 Omslagillustratie: Frivista (Folkert Rinkema) Inhoud Woord vooraf Jan Westert ...................................................................................... 7 Inleiding: vrijheid onder druk Geert Jan Spijker ..................................................9 A. Vrijheid in historisch perspectief: christelijke wortels ................................. 23 Het christelijk vrijheidsbegrip Gijsbert van den Brink ................................. -
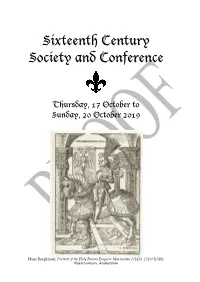
2019 SCSC Program 6
Sixteenth Century Society and Conference Thursday, 17 October to Sunday, 20 October 2019 Hans Burgkmair, Portrait of the Holy Roman Emperor Maximilian I (1459–1519) (1518). Rijksmuseum, Amsterdam Sixteenth Century Society & Conference 17-20 October 2019 2018-19 OFFICERS President: Walter S. Melion Vice-President: Andrew Spicer Past President: Kathleen M. Comerford Executive Director: Bruce Janacek Treasurer: Eric Nelson COUNCIL Class of 2019: Brian Sandberg, Daniel T. Lochman, Suzanne Magnanini, Thomas L. Herron Class of 2020: David C. Mayes, Charles H. Parker, Carin Franzén, Scott C. Lucas Class of 2021: Sara Beam, Jason Powell, Ayesha Ramachandran, Michael Sherberg PROGRAM COMMITTEE Chair: Andrew Spicer Art History: James Clifton Digital Humanities: Suzanne Sutherland English Literature: Scott C. Lucas French Literature: Scott M. Francis German Studies: Jennifer Welsh History: Janis M. Gibbs Interdisciplinary: Andrew Spicer Italian Studies: Jennifer Haraguchi Science and Medicine: Chad D. Gunnoe Pedagogy: Chris Barrett Spanish and Latin American Studies: Nieves Romero-Diaz Theology: Rady Roldán-Figueroa SCSC—St. Louis—2019 2 NOMINATING COMMITTEE Amy E. Leonard Beth Quitslund Jeffrey R. Watt Thomas Robisheaux Liz Lehfeldt SIXTEENTH CENTURY SOCIETY & CONFERENCE FIFTIETH ANNIVERSARY COMMITTEE Sheila ffolliott (Chair) Kathryn Brammall Kathleen M. Comerford Gary Gibbs Whitney A.M. Leeson Ray Waddington Merry Wiesner-Hanks Walter S. Melion (ex officio) GRADUATE STUDENT STIPEND SELECTION COMMITTEE Jennifer M. DeSilva Kathleen M. Comerford William R. Bowen SCSC—St. Louis—2019 3 2018–2019 SCSC PRIZE COMMITTEES Founders' Prize Karen Spierling, Stephanie Dickey, Wim François Gerald Strauss Book Prize David Luebke, Jesse Spohnholz, Jennifer Welsh Bainton Art & Music History Book Prize Bret Rothstein, Lia Markey, Jessica Weiss Bainton History/Theology Book Prize Barbara Pitkin, Tryntje Helfferich, Haruko Ward Bainton Literature Book Prize Deanne Williams, Thomas L. -

Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2016 1 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van de Stichting Gereformeerde Scholengroep (GSG) over het kalenderjaar 2019. Met dit jaarverslag legt het College van Bestuur verantwoording af aan het Ministerie van OCW over de gestelde doelen, de activiteiten en de behaalde resultaten. Dit jaarverslag is in het kader van de horizontale verantwoording ook geschreven voor medewerkers, ouders, studenten, leerlingen, andere onderwijsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, en andere betrokkenen bij onze scholen. Dit jaarverslag is ook te vinden op de sites: www.gomaruscollege.nl en www.mensoaltinggroningen.nl. Veel actuele informatie over onze scholen kunt u vinden op onze websites en op de websites www.scholenopdekaart.nl en www.mbotransparant.nl. Reactie Mocht u na het lezen van dit jaarverslag een reactie willen geven, dan kunt u dat doen via de mail: [email protected] of u kunt bellen naar 050 – 524 4500. Gebruikte afkortingen BBL : Beroepsbegeleidende leerweg (combinatie werken en leren) BOL : Beroepsopleidende leerweg (leren op school, stage in bedrijf of instelling) BPV : Beroepspraktijkvorming (praktijkgedeelte van de opleiding) BVE : Beroeps‐ en volwasseneneducatie DUO : Dienst Uitvoering Onderwijs GSG : Gereformeerde Scholengroep JOB : Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs KD : Kwalificatiedossier MBO : Middelbaar beroepsonderwijs MR : Medezeggenschapsraad van het Gomarus College O&K : Afdeling Onderwijs & Kwaliteit ROC Menso Alting OOP : Onderwijsondersteunend personeel OP -

The Influence Upon Calvin of His Debate with Pighius», Inwiefern Pighius' Angriff Auf Cal Vins Lehre Vom Unfreien Willen Von 1542 Diesen Beeinflußte
Buchbesprechungen Ferner untersucht Anthony N. S. Lane in seinem Aufsatz «The influence upon Calvin of his Debate with Pighius», inwiefern Pighius' Angriff auf Cal vins Lehre vom unfreien Willen von 1542 diesen beeinflußte. Dabei wurde Calvin zur Beschäftigung mit Aussagen der Kirchenväter und Aristoteles gezwungen. Dies führte dazu, daß Calvin in seiner Gegenschrift von 1543 die selbe Lehre vom unfreien Willen nun noch deutlicher und detaillierter dar legte. Besonders interessant im Blick auf die Zürcher Reformation ist der Auf satz von A. Schindler «Zwingiis Gegner und die Kirchenväter - ein Überblick»: Der Autor beschränkt sich auf diejenigen altgläubigen Gegner Zwingiis, die Texte gegen Zwingli in Zürich und Umgebung veröffentlichten und sich dabei auf die Kirchenväter beriefen. Zwingiis Gegner im Chorher renstift waren vor allem Konrad Hofmann und dann auch Jakob Edlibach. Hofmann hatte schon vor dem Durchbruch der Reformation mit Zwingli Aus einandersetzungen. Dann war da auch der Generalvikar des Bischofs von Kon stanz, Johann Fabri. Unter den politisch wichtigen Leuten in Zürich spielte der Zürcher Vizekanzler Joachim am Grüt eine relativ gefährliche Rolle, während Valentin Compar, Landschreiber in Uri, den Zürcher Reformator hauptsächlich durch eine Streitschrift angriff. Alles in allem vereinigen die Bände sehr unterschiedliche Beiträge zur Rezeptionsgeschichte der Kirchenväter in der Reformationszeit, und werden schon deshalb wohl kaum in fortlaufender Lektüre gelesen werden. Die ein zelnen Studien hingegen werden bei spezifischer Suche wertvolle Dienste lei sten. Rudolf Hofer, Matt Correspondance de Theodore de Beze, recueillie par Hippolyte Aubert, publie par Alain Dufour, Beatrice Nicoliier et Reinhard Bodenmann, tome 20: 1579, Geneve, Droz, 1998. XXI, 343 S., ISBN 2-600-00250-2. -

Reformed Protestantism, 5
Reformed Protestantism Sources of the 16th and 17th centuries 5. East Friesland and North-Western Germany, 2nd installment Editor: Wim Janse, Universiteit Leiden/Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands 2 References Bibliographies Jürgens, H.P. Johannes a Lasco Libraries Jürgens, Henning P. Johannes a Lasco: BM STC German, 1455-1600 ein Leben in Büchern und Briefen. JALB British Museum. Dept. of Printed Wuppertal: Foedus, 1999. (Veröf- Johannes a Lasco Bibliothek, Emden, Books. Short-title catalogue of books fentlichungen der Johannes a Lasco Germany printed in the German-speaking coun- Bibliothek Grosse Kirche Emden; 1) tries and German books printed in other KBG countries from 1455 to 1600 now in the NUC pre-1956 Koninklijke Bibliotheek, The Hague, British Museum. London: Trustees of The National union catalog, pre-1956 Netherlands the British Museum, 1962. imprints: a cumulative author list repre- senting Library of Congress printed RUG Boekenoogen, J.G. Cat. der werken cards and titles reported by other Bibliotheek der Rijksuniversiteit Gro- over de Doopsgezinden American libraries. London: Mansell, ningen, Netherlands Boekenoogen, Jan Gerrit. Catalogus der 1968-81. werken over de Doopsgezinden ende SuUB Brem. hunne geschiedenis, aanwezig in de Tielke, M. Ostfriesische Bib. Staats- und Universitätsbibliothek Bre- bibliotheek der Vereenigde Doopsgezin- Tielke, Martin. Ostfriesische Biblio- men, Germany de Gemeente te Amsterdam. Amsterdam: graphie (16. Jh.-1907). Hildesheim: A. J.H. Bussy, 1919. Lax, 1990. (Veröffentlichungen der TUK Historischen Kommission für Nieder- Bibliotheek Theologische Universiteit Brandes, W. Bib. der niedersächsi- sachsen und Bremen; 30a) Kampen, Netherlands schen Frühdrucke Brandes, Walther. Bibliographie der VD 16 UBA niedersächsischen Frühdrucke bis zum Verzeichnis der im deutschen Sprachbe- Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Jahre 1600.