Historie Jahrbuch 12.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Canada As the Target of GDR Espionage Helmut Müller-Enbergs
Document généré le 2 oct. 2021 03:58 Journal of Conflict Studies Canada as the Target of GDR Espionage Helmut Müller-Enbergs Volume 29, spring 2009 Résumé de l'article German Democratic Republic (GDR) diplomatic missions included a legal URI : https://id.erudit.org/iderudit/jcs29art04 residentur: an intelligence service base whose presence was more or less openly acknowledged. It was staffed by the Hauptverwaltung A (HVA - Main Directorate Aller au sommaire du numéro Foreign Intelligence), one of the principal divisions within the Ministerium für Staatssicherheit (Ministry for State Security). The HVA’s main task was espionage. While most of the HVA files have been destroyed, the HVA had created Éditeur(s) a special database that holds all of the information it produced between 1969 and 1989. This database allows scholars to identify which source delivered what The University of New Brunswick information and when, who received the information, and what value each piece of information had. The GDR’s Canadian embassy did not open until 1987, and ISSN due to the short term of its existence, the HVA residentur in Canada could hardly have played a significant intelligence role. And we can be almost certain that it 1198-8614 (imprimé) did not build up and manage an unofficial spy network from Canada. In fact, the 1715-5673 (numérique) HVA appears to have acquired its knowledge about Canada primarily from other sources, mainly agents within the West German foreign ministry and from other Découvrir la revue partner intelligence agencies. The GDR undoubtedly had deep insights into the domestic and foreign affairs of Canada. -

Approach/Avoidance: Communists and Women in East Germany, 1945-9 Author(S): Donna Harsch Source: Social History, Vol
Approach/Avoidance: Communists and Women in East Germany, 1945-9 Author(s): Donna Harsch Source: Social History, Vol. 25, No. 2 (May, 2000), pp. 156-182 Published by: Taylor & Francis, Ltd. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/4286643 Accessed: 24-04-2018 15:00 UTC JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://about.jstor.org/terms Taylor & Francis, Ltd. is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Social History This content downloaded from 35.176.47.6 on Tue, 24 Apr 2018 15:00:46 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms Social History Vol. 25 No. 2 May 2000 0* Donna Harsch Approach/avoidance: Communists and women in East Germany, 1945-9 In July 1945, a German Communist scolded fellow members of the KPD for how they talked to women in the Soviet zone of occupation. According to Irene Girtner (aka Elli Schmidt), her comrades opened lectures to female audiences with the question: 'Is it not a fact that Hitler came to power only because a high proportion of women succumbed to the poison of Nazi propaganda?'l A year later, Schmidt rued, Communists continued to make the 'error' of expounding on the guilt women bore for the fascist seizure of power.2 As late as May 1947, another woman in the party felt the need to point out that, infact, women had voted at a lower rate for Hitler in I928, only catching up to the male vote in I93I-2.3 For her part, Elli Schmidt did not question the accuracy of the charge but its political acumen. -

Die Hochschule. Journal Für Wissenschaft Und Bildung
die hochschule. journal für wissenschaft und bildung Herausgegeben von HoF Wittenberg – Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Redaktion: Peer Pasternack & Martin Winter Anschrift: Redaktion „die hochschule“, HoF Wittenberg, Collegienstraße 62 D-06886 Wittenberg; Tel.: 0177/3270900; Fax: 03491/466-255 Email: [email protected]; [email protected] Vertrieb: Lydia Ponier, Tel. 03491/466-254; Fax: 03491/466-255 ISSN 1618-9671. Dieser Band: ISBN 3-937573-00-3 Die Zeitschrift „die hochschule“ versteht sich als Ort für Debatten aller Fragen der Hochschuforschung sowie angrenzender Themen aus der Wissenschafts- und Bildungsforschung. Manuskripte werden in dreifacher Ausfertigung erbeten. Ihr Umfang sollte 25.000 Zeichen nicht überschreiten. Weitere Autorenhinweise sind auf den Internetseiten der Zeitschrift zu finden unter: http://www.diehochschule.de Von 1991 bis 2001 erschien „die hochschule“ unter dem Titel „hochschule ost“ in Leipzig (im Internet: http://www.uni-leipzig.de/~hso). „die hochschu- le“ steht in der editorischen Kontinuität von „hochschule ost“ und doku- mentiert dies durch eine besondere Aufmerksamkeit für ostdeutsche und osteuropäische Hochschul- und Wissenschaftsentwicklung sowie –ge- schichte. Als Beilage zum „journal für wissenschaft und bildung“ erscheint der „HoF- Berichterstatter“ mit aktuellen Nachrichten aus dem Institut für Hochschul- forschung Wittenberg. HoF Wittenberg, 1996 gegründet, ist ein An-Institut der Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg (im Internet: http://www.hof.uni-halle.de). Es hat seinen Sitz in der Stiftung Leucorea Wittenberg und wird von Prof. Dr. Reinhard Kreckel, Institut für Soziologie der Universität Halle-Wittenberg, geleitet. Neben der Zeitschrift „die hochschule“ mit dem „HoF-Berichterstatter“ pub- liziert das Institut die HoF-Arbeitsberichte (ISSN 1436-3550) sowie die Buchreihe „Wittenberger Hochschulforschung“. -
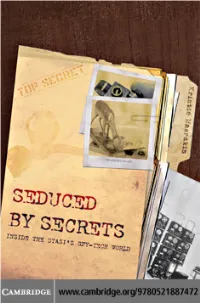
Seduced by Secrets: Inside the Stasi's Spy-Tech World
P1: SBT 9780521188742pre CUNY1276/Macrakis 978 0 521 88747 2 January 17, 2008 14:21 This page intentionally left blank ii P1: SBT 9780521188742pre CUNY1276/Macrakis 978 0 521 88747 2 January 17, 2008 14:21 SEDUCED BY SECRETS More fascinating than fiction, Seduced by Secrets takes the reader inside the real world of one of the most effective and feared spy agencies in history. The book reveals, for the first time, the secret technical methods and sources of the Stasi (East German Ministry for State Security) as it stole secrets from abroad and developed gadgets at home, employing universal, highly guarded techniques often used by other spy and security agencies. Seduced by Secrets draws on secret files from the Stasi archives, includ- ing CIA-acquired material, interviews and friendships, court documents, and unusual visits to spy sites, including “breaking into” a prison, to demonstrate that the Stasi overestimated the power of secrets to solve problems and cre- ated an insular spy culture more intent on securing its power than protecting national security. It re-creates the Stasi’s secret world of technology through biographies of agents, defectors, and officers and by visualizing James Bond– like techniques and gadgets. In this highly original book, Kristie Macrakis adds a new dimension to our understanding of the East German Ministry for State Security by bringing the topic into the realm of espionage history and exiting politically charged commentary. Kristie Macrakis is a professor of the history of science at Michigan State University. She received her Ph.D. in the history of science from Harvard University in 1989 and then spent a postdoctoral year in Berlin, Germany. -

Rosenholz«-Datei Eröffnet Neue Einblicke Ins Stasi-Netz
Helmut Müller-Enbergs »Rosenholz« Eine Quellenkritik unter Mitarbeit von Sabine Fiebig Günter Finck Georg Herbstritt Stephan Konopatzky BF informiert 28 (2007) Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik Abteilung Bildung und Forschung Postfach 218 10106 Berlin [email protected] Die Meinungen, die in dieser Schriftenreihe geäußert werden, geben ausschließlich die Auffassungen der Autoren wieder. Abdruck und publizistische Nutzung sind nur mit Angabe des Verfassers und der Quelle sowie unter Beachtung des Urheberrechtsge- setzes gestattet. Titelbild: CD mit sogenannten »Rosenholz«-Daten (BStU) Schutzgebühr: 5,00 € 2. Auflage Berlin 2007 Inhalt 1 Einführung 5 2 Quellenlage 9 2.1 Akten der HV A 9 2.2 Datenbank HHO 12 2.3 Abteilungen XV 13 2.4 SIRA 13 2.5 Interviews 15 3 Vorgeschichte 17 3.1 Das Anlegen der Karteikarten 17 3.2 Das Löschen von Karteikarten 19 3.3 Mikrofilme 21 3.4 Der CIA-Coup 26 3.5 »Rosenholz I« 28 3.6 »Rosenholz ll« 31 4 Formblatt 16 36 4.1 Die Karteikarte 37 4.2 Die Beschriftung durch den operativen Mitarbeiter 38 4.3 Der Nachname 39 4.4 Wie viele Bürger sind verzeichnet? 41 4.4.1 Mehrfacherfassungen 41 4.4.2 Fiktive Personalien und andere Identitäten 42 4.4.3 Arbeitskartei 45 4.5 Der Geburtsname 46 4.6 Der Vorname 46 4.7 Geburtsdatum und -ort 47 4.8 Personenkennzahl 48 4.9 Staatsangehörigkeit / Nationalität 49 4.10 Wohnanschrift 52 4.11 Beruf und Arbeitsstelle 52 4.12 Vorgangsdaten 53 4.12.1 Registriernummer 53 4.12.2 Diensteinheiten 55 -

The Stasi at Home and Abroad the Stasi at Home and Abroad Domestic Order and Foreign Intelligence
Bulletin of the GHI | Supplement 9 the GHI | Supplement of Bulletin Bulletin of the German Historical Institute Supplement 9 (2014) The Stasi at Home and Abroad Stasi The The Stasi at Home and Abroad Domestic Order and Foreign Intelligence Edited by Uwe Spiekermann 1607 NEW HAMPSHIRE AVE NW WWW.GHI-DC.ORG WASHINGTON DC 20009 USA [email protected] Bulletin of the German Historical Institute Washington DC Editor: Richard F. Wetzell Supplement 9 Supplement Editor: Patricia C. Sutcliffe The Bulletin appears twice and the Supplement usually once a year; all are available free of charge and online at our website www.ghi-dc.org. To sign up for a subscription or to report an address change, please contact Ms. Susanne Fabricius at [email protected]. For general inquiries, please send an e-mail to [email protected]. German Historical Institute 1607 New Hampshire Ave NW Washington DC 20009-2562 Phone: (202) 387-3377 Fax: (202) 483-3430 Disclaimer: The views and conclusions presented in the papers published here are the authors’ own and do not necessarily represent the position of the German Historical Institute. © German Historical Institute 2014 All rights reserved ISSN 1048-9134 Cover: People storming the headquarters of the Ministry for National Security in Berlin-Lichtenfelde on January 15, 1990, to prevent any further destruction of the Stasi fi les then in progress. The poster on the wall forms an acrostic poem of the word Stasi, characterizing the activities of the organization as Schlagen (hitting), Treten (kicking), Abhören (monitoring), -

Mfs-Handbuch —
Anatomie der Staatssicherheit Geschichte, Struktur und Methoden — MfS-Handbuch — Bitte zitieren Sie diese Online-Publikation wie folgt: Helmut Müller-Enbergs: Hauptverwaltung A (HV A). Aufgaben – Strukturen – Quellen (MfS-Handbuch). Hg. BStU. Berlin 2011. http://www.nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0292-97839421301580 Mehr Informationen zur Nutzung von URNs erhalten Sie unter http://www.persistent-identifier.de/ einem Portal der Deutschen Nationalbibliothek. Vorbemerkung Das Handbuchprojekt »Anatomie der Staatssicherheit« ist eines der ältesten Vorhaben des Forschungsbereiches der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU). Es wurde bereits im Jahr 1993 begonnen – wenige Monate nach der Gründung der Abteilung »Bil dung und Forschung« und stellt dem wissenschaftlichen Fachpublikum wie auch anderen interessierten Nutzern von Stasi-Akten in kontinuierlich erscheinenden Teillieferungen umfassendes Grundwissen zum MfS zur Verfügung: die Entwicklung der Gesamtinstituti on MfS in ihrem historischen Kontext, die Geschichte seiner wichtigsten Arbeitsbereiche, grundlegende Darlegungen zu den hauptamtlichen und inoffiziellen Mitarbeitern sowie verschiedene Übersichten und Materialien zur Struktur des MfS und ihrer Entwicklung, Kurzbiographien des Leitungspersonals und eine Edition der wichtigsten Grundsatzdoku mente. Das »MfS-Handbuch« folgt der Verpflichtung der BStU zur »Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes durch Unterrichtung der Öffentlichkeit über Struk tur, Methoden und Wirkungsweise des Staatssicherheitsdienstes« -

Med Stigmo in Elito Poklicna Identiteta V Obveščevalni Službi
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Sonja Jakič Med stigmo in elito Poklicna identiteta v obveščevalni službi MAGISTRSKO DELO Ljubljana, 2007 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Sonja Jakič Med stigmo in elito Poklicna identiteta v obveščevalni službi MAGISTRSKO DELO Mentorica: dr. Marina Lukšič Hacin Ljubljana, 2007 2 K A Z A L O UVOD……………………………………………………………………………………………..4 1. OPREDELITEV POJMOV……………………………………………………………...8 1.1 STIGMA……………………………………………………………………...8 1.2 ELITA……………………………………………………………………….10 1.3 POKLIC……………………………………………………………………..11 1.4 POKLICNA IDENTITETA…………………………………………………12 1.5 OBVEŠČEVALNA SLUŽBA………………………………………………16 1.5.1 KRATEK ORIS ZGODOVINE RAZVOJA OBVEŠČEVALNIH SLUŽB………………………………17 1.5.2 OBVEŠČEVALNE SLUŽBE DANES……………………23 1.6 POKLICNA IDENTITETA V OBVEŠČEVALNI SLUŽBI………………..27 2. ZNAČILNOSTI POKLICNE IDENTITETE V OBVEŠČEVALNI SLUŽBI…………29 2.1 TAJNOST IN DELO S TAJNOSTJO………………………………………30 2.2 ŽARGON……………………………………………………………………..37 3. PRIDOBIVANJE IN VZDRŽEVANJE POKLICNE IDENTITETE V OBVEŠČEVALNI SLUŽBI……………………………………………………………….40 3.1 VSTOP V OBVEŠČEVALNO SLUŽBO……………………………………42 3.1.1 PREHODNI OBRED, INICIACIJA…………………………43 3.1.2 IZJAVA OZ. ZAPRISEGA…………………………………..46 3.2 PRIDOBIVANJE IN VZDRŽEVANJE POKLICNE IDENTITETE V OBVEŠČEVALNI SLUŽBI………………………………………………..49 3.2.1 LOJALNOST…………………………………………………49 3 3.2.2 MIT…………………………………………………………….52 3.2.3 ŽARGON……………………………………………………...56 3.2.4 SIMBOL……………………………………………………….58 3.2.5 SAMOPODOBA IN PREDSODKI…………………………..61 3.2.5.1 ELITIZEM…………………………………………62 3.2.5.2 STIGMATIZACIJA………………………………66 -

On the Frontline of Cold War Espionage
Kristie Macrakis, Thomas Wegener Friis, Helmut Müller-Enbergs, eds.. East German Foreign Intelligence: Myth, Reality and Controversy. London: Routledge, 2010. xii + 247 pp. $120.00, cloth, ISBN 978-0-415-48442-8. Reviewed by Thomas Boghardt Published on H-German (November, 2010) Commissioned by Benita Blessing (Oregon State University) Few institutions have become more striking MfS officers who droned on about the successful symbols of Soviet-style totalitarianism than East espionage operations of their agency, brushed Germany's Ministry for State Security (MfS, or critical questions aside, and "became louder, less Stasi). Like its archetype, the Soviet KGB, the noto‐ restrained, fnally banging on the benches with rious Stasi combined foreign espionage and do‐ abandon and dominating the venue."[1] To add in‐ mestic security functions under one administra‐ sult to injury, the MfS retirees quickly published tive roof. But while MfS domestic security opera‐ their own papers in an edited volume, without tions have generated sustained academic and consulting the dumbfounded Danish conference popular interest--witness the Oscar-winning organizers.[2] East German Foreign Intelligence is movie The Lives of Others (dir. Florian Henckel the academics' response to what many of them von Donnersmarck, 2006)--the same cannot be considered a rose-tinted view of the HVA. said about the operations of the Stasi's foreign in‐ The volume reproduces papers by several telligence arm, the HVA (Hauptverwaltung A, or Odense participants but includes a number of main department A). Knowledgeable publications contributions from other Cold War and intelli‐ in English are particularly rare. This collection of gence historians as well. -

Stasi Files and GDR Espionage Against the West
IFS Info 2/02 Bernd Schäfer Stasi Files and GDR Espionage Against the West Table of contents On the author ........................................................................................................................... 4 The Seizure of Stasi Buildings in 1989/90 and the Stasi Records Law of 1991 ....................... 5 The Foreign Intelligence Files................................................................................................... 6 The “Rosenholz” File Cards ................................................................................................ 7 The SIRA Tapes ................................................................................................................... 7 GDR Espionage Against the West ............................................................................................ 8 Penetration of West German Government and Intelligence Sources ................................... 8 Espionage against NATO .................................................................................................. 10 Notes ...................................................................................................................................... 13 Tidligere utgitte publikasjoner ............................................................................................... 15 On the author Dr. Bernd Schäfer was born in Kaiserslautern in the Federal Republic of Germany in 1962. During the 1980s, he studied History, Catholic Theology and Political Science at the Universities of Tübingen, -

Sex Für Den Frieden Mitarbeiter Der Stasi Verführten Westdeutsche Frauen Und Schöpften Sie Ab
Deutschland SPIONAGE Sex für den Frieden Mitarbeiter der Stasi verführten westdeutsche Frauen und schöpften sie ab. Die DDR-„Romeos“ hatten ihren Spaß, waren skrupellos – und erfolgreich. Von Henryk M. Broder s war nicht alles schlecht in der DDR. Arbeit war für alle da, die Mieten Ewaren billig und die öffentlichen Verkehrsmittel beinah umsonst. Die Volks- armee bewachte die Grenzen, die Volks- polizei sorgte für Ordnung, und das Ministerium für Staatssicherheit hielt die Dissidenten im Zaum. Auch das Erotische kam nicht zu kurz, wer sich im Inland bewährt hatte, wurde zu Sondereinsätzen ins westliche „Opera- tionsgebiet“ geschickt. „Ficken fürs Vater- land“ lautete der Auftrag inoffiziell, amt- lich ging es darum, „für längere Zeit einen weiblichen Vorgang zu führen und intim zu betreuen“. Mielkes Jungs waren nicht nur Schnüff- ler, Erpresser, Fälscher, Zersetzer und De- nunzianten, sie waren, wenn es darauf an- kam, auch tüchtige Liebhaber, die sich in Stasi-Chef Mielke, Untergebene (1989) „Einen weiblichen Vorgang intim betreuen“ die Herzen und Betten westdeutscher Frauen einschlichen. Er habe, sagte einer der „Romeos“ als Zeuge in einem Verfah- ren aus, „nur das Angenehme mit dem A. ZELCK Nützlichen verbunden“. Ex-Agentin Gabriele K.: „Meine einzige Liebe, die Liebe meines Lebens“ Die Frauen wurden, so die Buchautorin Elisabeth Pfister, 47, „zu Figuren im Spiel Es war immer derselbe Typ von Frau, hin- Frau ,Danke, ohne mich‘ sagen.“ So gut der Logistiker und Psychoexperten der Sta- ter dem die „Liebeskommandos der Stasi“ wie alle -

Stasi Intellligence on NATO, 1969-1989
PARALLEL HISTORY PROJECT ON NATO AND THE WARSAW PACT (PHP) Stasi Intelligence on NATO Bernd Schaefer and Christian Nuenlist (eds.) [Stasi Archives] [Stasi Documents] PHP Publications Series Washington, D.C. / Zurich November 2003 This publication is part of a publications series by the Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact (PHP). The PHP provides new scholarly perspectives on contemporary international history by collecting, analyzing, and interpreting formerly secret governmental documents. Since its establishment in 1999, the project has collected thousands of pages of material on security-related issues of the Cold War, published a large number of online documentaries on central issues such as mutual threat perceptions and alliance management, and organized several major international conferences on war planning, intelligence, and intra- bloc tensions. Further information is provided at the PHP Website: www.isn.ethz.ch/php. Table of Contents 1) Introduction, by Bernd Schaefer ...................................................................................1 2) Did East German Spies Prevent A Nuclear War? By Vojtech Mastny.........................8 3) Stasi Files and GDR Espionage Against the West, by Bernd Schaefer ....................14 4) List of Documents .......................................................................................................15 5) Sample Documents.....................................................................................................21 6) NATO’s «ABLE ARCHER 83» Exercise