Interkulturalität Der Versorgung Am Lebensende
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Plenarprotokoll 18/240
Plenarprotokoll 18/240 Deutscher Bundestag Stenografscher Bericht 240. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 22. Juni 2017 Inhalt: Gedenken an Bundeskanzler a. D. Dr. Helmut Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/ Kohl DIE GRÜNEN) ...................... 24489 A Präsident Dr. Norbert Lammert ........... 24479 A Hermann Gröhe, Bundesminister BMG ..... 24491 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Harald Weinberg (DIE LINKE) ........... 24493 A nung. 24530 D Dr. Karl Lauterbach (SPD) ............... 24493 D Absetzung der Tagesordnungspunkte 13, 14 c, 14 d und 15 b. 24484 A Nadine Schön (St. Wendel) (CDU/CSU) .... 24495 A Mechthild Rawert (SPD). 24496 B Zur Geschäftsordnung ................. 24484 B Erich Irlstorfer (CDU/CSU) .............. 24497 A Petra Crone (SPD) ...................... 24498 A Tagesordnungspunkt 7: a) – Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Ent- Tagesordnungspunkt 8: wurfs eines Gesetzes zur Reform der a) Unterrichtung durch die Bundesregie- Pfegeberufe (Pfegeberufereformge- rung: Bericht zur Umsetzung der High- setz – PfBRefG) tech-Strategie – Fortschritt durch For- Drucksachen 18/7823, 18/12847 ..... 24484 C schung und Innovation – Stellungnahme – Bericht des Haushaltsausschusses ge- der Bundesregierung zum Gutachten mäß § 96 der Geschäftsordnung zu Forschung, Innovation und techno- logischer Leistungsfähigkeit Deutsch- Drucksache 18/12848 ............. 24484 C lands 2017 b) Beschlussempfehlung und Bericht des Drucksache 18/11810 ................ 24499 C Ausschusses für Gesundheit zu dem Antrag -

Antragsheft 2
6. Parteitag, 2. Tagung und Bundesvertreterinnen- und Bundesvertreterversammlung der Partei DIE LINKE Bonn, 22. bis 24. Februar 2019 Antragsheft 2 Inhaltsverzeichnis Materialien für die 2. Tagung des 6. Parteitags Anträge ................................................................................................... Seite 7 Anträge mit überwiegendem Bezug zur Gesellschaft ............... Seite 9 Anträge mit überwiegendem Bezug zur Partei .......................... Seite 21 Anträge zur Finanzordnung und Ordnung für die Tätigkeiten der Finanzrevisionskommissionen .......................................... Seite 31 Berichte ................................................................................................... Seite 33 Bericht der Fraktion GUE/NGL ................................................. Seite 35 Bericht des Bundesausschusses ............................................ Seite 45 Bericht des Ältestenrates ........................................................ Seite 49 Bericht der Bundesfinanzrevisionskommission ........................ Seite 53 Materialien für die Vertreterinnen- und Vertreterversammlung Kandidaturen zur Aufstellung der Liste ............................................................ Seite 61 Impressum/Kontakt Bundesgeschäftsstelle der Partei DIE LINKE Kleine Alexanderstr. 28 10178 Berlin www.die-linke.de Redaktionsschluss: 10. Januar 2019 Materialien für die 2. Tagung des 6. Parteitages - Seite 5 - - Seite 6 - Anträge an die 2. Tagung des 6. Parteitages - Seite 7 - - Seite 8 - Anträge mit überwiegendem -

Wortprotokoll Der 80
Protokoll-Nr. 18/80 18. Wahlperiode Ausschuss für Gesundheit Wortprotokoll der 80. Sitzung Ausschuss für Gesundheit Berlin, den 8. Juni 2016, 16.30 Uhr Jakob-Kaiser-Haus, Saal 1 302 Vorsitz: Dr. Edgar Franke, MdB Tagesordnung - Öffentliche Anhörung Einziger Tagesordnungspunkt Seite 4 a) Antrag der Abgeordneten Harald Weinberg, Ulla Federführend: Ausschuss für Gesundheit Jelpke, Sabine Zimmermann (Zwickau), weiterer Mitberatend: Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. Innenausschuss Medizinische Versorgung für Geflüchtete und Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe Asylsuchende diskriminierungsfrei sichern BT-Drucksache 18/7413 b) Antrag der Abgeordneten Maria Klein-Schmeink, Federführend: Ausschuss für Gesundheit Luise Amtsberg, Kordula Schulz-Asche, weiterer Mitberatend: Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE Innenausschuss GRÜNEN Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Psychotherapeutische und psychosoziale Versor- Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe gung von Asylsuchenden und Flüchtlingen verbes- sern BT-Drucksache 18/6067 18. Wahlperiode Seite 1 von 14 Ausschuss für Gesundheit Mitglieder des Ausschusses Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder CDU/CSU Bertram, Ute Albani, Stephan Henke, Rudolf Brehmer, Heike Hennrich, Michael Dinges-Dierig, Alexandra Hüppe, Hubert Eckenbach, Jutta Irlstorfer, Erich Lorenz, Wilfried Kippels, Dr. Georg Manderla, Gisela Kühne, Dr. Roy Nüßlein, Dr. Georg Leikert, Dr. Katja Pantel, Sylvia Maag, Karin Rupprecht, Albert -

Annual Report 2010 Contents
ANNUAL REPORT 2010 CONTENTS EDITORIAL 2 BUILDING BRIDGES: 20 YEARS OF THE ROSA LUXEMBURG FOUNDATION 4 Award-winning east-west projects 5 Posters from 20 years of the Rosa Luxemburg Foundation 6 KEY ISSUE: AUTOMOBILES, ENERGY AND POLITICS 8 «Power to the People» conference of the Academy of Political Education 9 «Auto.Mobil.Krise.» Conference of the Institute for Social Analysis 10 THE ACADEMY OF POLITICAL EDUCATION 12 PUBLICATIONS OF THE ROSA LUXEMBURG FOUNDATION 16 EDUCATIONAL WORK IN THE FEDERAL STATES 20 CENTRE FOR INTERNATIONAL DIALOGUE AND COOPERATION 32 Interview with the new director of the Centre, Wilfried Telkämper 33 New presences: The Foundations in Belgrade and Quito 34 Africa Conference «Resistance and awakening» 35 Visit by El Salvador’s foreign minister 36 Israel and Palestine: Gender dimensions. Conference in Brussels 36 RELAUNCH OF THE FOUNDATION WEBSITE 40 PROJECT SPONSORSHIP 42 FINANCIAL AND CONCEPTUAL SUPPORT: THE SCHOLARSHIP DEPARTMENT 52 Academic tutors 54 Conferences of the scholarship department 56 RosAlumni – an association for former scholarship recipients 57 Scholarship recipient and rabbi: Alina Treiger 57 ARCHIVE AND LIBRARY 58 Finding aid 58 What is a finding aid? 59 About the Foundation’s library: Interview with Uwe Michel 60 THE CULTURAL FORUM OF THE ROSA LUXEMBURG FOUNDATION 61 PERSONNEL DEVELOPMENT 64 THE FOUNDATION’S BODIES 66 General Assembly 66 Executive Board 68 Scientific Advisory Council 69 Discussion Groups 70 ORGANIGRAM 72 THE FOUNDATION’S BUDGET 74 PUBLISHING DETAILS/PHOTOS 80 1 Editorial Dear readers, new political developments, the movements for democratic change in many Arab countries, or the natural and nuclear disaster in Japan all point to one thing: we must be careful about assumed certainties. -

Migration, Integration, Asylum: Political Developments in Germany 2015 Grote, Janne; Müller, Andreas; Vollmer, Michael
www.ssoar.info Migration, Integration, Asylum: Political Developments in Germany 2015 Grote, Janne; Müller, Andreas; Vollmer, Michael Veröffentlichungsversion / Published Version Forschungsbericht / research report Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Grote, J., Müller, A., & Vollmer, M. (2016). Migration, Integration, Asylum: Political Developments in Germany 2015. (Annual Policy Report / Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl (FZ)). Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl (FZ); Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Nationale Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN). https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-68289-3 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under Deposit Licence (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non- Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, transferable, individual and limited right to using this document. persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses This document is solely intended for your personal, non- Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für commercial use. All of the copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses -

2 Verantwortliche / Ggf. Sprecher/Innen Im Zugleich
2 Verantwortliche / ggf. Sprecher/innen im Zugleich Parteivorstand Ansprechpart- DIE LINKE für: ner/in für: Christine Buchholz Abrüstungs- und Friedenspolitik Anny Heike Helmut Scholz Brigitte Ostmeyer Agrarpolitik & Verbraucher/innenschutz AG Agrarpolitik und Wolfgang Methling ländlicher Raum Antifaschistische Politik AG Rechtsextremismus / Antifaschismus Elke Breitenbach Katina Schubert Antirassismus, Immigrant/innen und AG Antirassismus, ImmigrantInnen- und Katina Schubert Flüchtlingspolitik Flüchtlingspolitik Arbeitsmarktpolitik Heidi Scharf 3 Verantwortliche / ggf. Sprecher/innen im Zugleich Parteivorstand Ansprechpart- DIE LINKE für: ner/in für: Außen- und Sicherheitspolitik Wolfgang Gehrcke (Sprecher) Behindertenpolitik AG Selbstbestimmte Behindertenpolitik Britta Pietsch (Sprecherin) Irene Müller (Sprecherin) Marc Mulia Bildungspolitik AG Bildungspolitik Rosemarie Hein Sophie Dieckmann Europapolitik Jürgen Klute Helmut Scholz Fritz Schmalzbauer Familienpolitik Caren Lay 4 Verantwortliche / ggf. Sprecher/innen im Zugleich Parteivorstand Ansprechpart- DIE LINKE für: ner/in für: Caren Lay Frauen- und Gleichstellungspolitik AG Lisa Heidi Scharf BAG Die Linke.queer Anny Heike Gesundheitspolitik IG Gesundheit und Soziales Klaus Ernst BAG Drogenpolitik Sabine Lösing Michael Schlecht (Sprecher) Ralf Krämer Gewerkschaftspolitik AG Betrieb und Gewerkschaft Heidi Scharf (Sprecherin) Anny Heike Harald Werner Jan Korte Innen- und Rechtspolitik Katina Schubert BAG Bürgerrechte und Demokratie Halina Wawzyniak AG JuristInnen AG Ethnische Minderheiten -

Anerkennung Ausländischer Berufsqualifikationen
AUSWAHLBIBLIOGRAFIE Markus Linten | Sabine Prüstel Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen Zusammenstellung aus: Literaturdatenbank Berufliche Bildung Version: 3.0, Juni 2017 Bundesinstitut für Berufsbildung Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn Telefon (02 28) 1 07-0 Telefax (02 28) 1 07 29 76 / 77 Internet: www.bibb.de E-Mail: [email protected] Die vorliegende Auswahlbibliografie zum Thema „Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen“ wurde aus der Literaturdatenbank Berufliche Bildung (LDBB) zusammengestellt und beinhaltet chronologisch absteigend Literaturnachweise aus den vergangenen Jahren. Bei Online-Dokumenten sind die Nachweise über die URL direkt mit den jeweiligen Volltexten verlinkt. Diese und andere Literaturzusammenstellungen zu Themen der Berufsbildung finden Sie im Internet zum Download unter www.bibb.de/auswahlbibliografien. Die Literaturdatenbank Berufliche Bildung (LDBB) weist die deutschsprachige Fachliteratur zum Themenbereich Berufsbildung/ Berufspädagogik/ Berufsbildungsforschung ab dem Erscheinungsjahr 1988 systematisch nach. Die Datenbank ist unter www.ldbb.de online zugänglich und kostenfrei recherchierbar. Die über 60.000 Literaturnachweise sind neben bibliografischen Angaben durch Schlagwörter, Abstracts und eine Klassifikation inhaltlich erschlossen. Der Fokus der Auswertung liegt auf Zeitschriften und Sammelwerken, die in Bibliothekskatalogen und im Internet nur bedingt recherchierbar sind. Die LDBB wird von der Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz (AG BFN) unterstützt. Kooperationspartner -

20201118 3-Data.Pdf
Deutscher Bundestag 191. Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 18. November 2020 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 3 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite - Drucksachen 19/23944 und 19/24334 - Abgegebene Stimmen insgesamt: 656 Nicht abgegebene Stimmen: 52 Ja-Stimmen: 413 Nein-Stimmen: 235 Enthaltungen: 8 Ungültige: 0 Berlin, den 20.11.2020 Beginn: 14:48 Ende: 15:19 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Dr. Michael von Abercron X Stephan Albani X Norbert Maria Altenkamp X Peter Altmaier X Philipp Amthor X Artur Auernhammer X Peter Aumer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. André Berghegger X Melanie Bernstein X Christoph Bernstiel X Peter Beyer X Marc Biadacz X Steffen Bilger X Peter Bleser X Norbert Brackmann X Michael Brand (Fulda) X Dr. Reinhard Brandl X Dr. Helge Braun X Silvia Breher X Sebastian Brehm X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Dr. Carsten Brodesser X Gitta Connemann X Astrid Damerow X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Thomas Erndl X Hermann Färber X Uwe Feiler X Enak Ferlemann X Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) X Dr. Maria Flachsbarth X Thorsten Frei X Dr. Hans-Peter Friedrich (Hof) X Michael Frieser X Hans-Joachim Fuchtel X Ingo Gädechens X Dr. Thomas Gebhart X Alois Gerig X Eberhard Gienger X Seite: 3 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. -
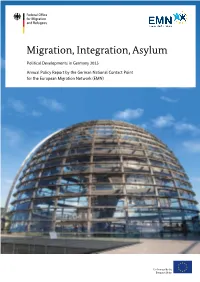
Migration, Integration, Asylum
Migration, Integration, Asylum Political Developments in Germany 2015 Annual Policy Report by the German National Contact Point for the European Migration Network (EMN) Co-financed by the European Union Migration, Integration, Asylum Political Developments in Germany 2015 Annual Policy Report by the German National Contact Point for the European Migration Network (EMN) Federal Office for Migration and Refugees 2016 Summary 5 Summary The German Bundestag passed a number of amendments The 2015 Policy Report of the German National Contact over the course of 2015, which include Point for the European Migration Network (EMN) provides an overview of the most important political dis- ■■ the Act on the redefinition of the right to stay and cussions as well as political and legislative developments the termination of residence (entry into force: in the areas of migration, integration, and asylum in the 1 August 2015), Federal Republic of Germany in the year 2015. The report ■■ Act on the Acceleration of Asylum Procedures – refers specifically to measures taken by the Federal Asylum Package I (entry into force: 24 October 2015), Republic of Germany to implement the Global Approach ■■ Act to improve accommodation, care and assistance to Migration and Mobility, the EU Strategy towards for foreign children and young persons (entry into the Eradication of Trafficking in Human Beings and the force: 1 November 2015), European Agenda for the Integration of Third-Country ■■ Third Victims’ Rights Reform Act (entry into force: Nationals. The report also describes the general struc- 31 December 2015). ture of the political and legal system in Germany. In addition to the legislation of the Bundestag, the Federal Ministry for Labour and Social Affairs (BMAS) revised the The jump in asylum migration and how to deal with it Employment Ordinance (BeschV) in 2015, which forms the was the central migration, integration and asylum issue basis for allowing immigrants in certain occupations and in 2015. -
The Committee on Health 2 “Patients Are at the Centre of Our Health Policy
The Committee on Health 2 “Patients are at the centre of our health policy. The quality of the care they receive is the yardstick by which the organisation of our health system is judged. We would all like to live a long, healthy life, and we all wish to benefit from medical advances and the oppor tunities opened up by the digital revolution. At the same time, however, the health system must remain affordable. At the centre of these conflicting interests, the Committee on Health discusses all topics falling within its remit and prepares decisions with the aim of equipping our health system to cope with future challenges.” Erwin Rüddel, CDU/CSU Chairman of the Committee on Health 3 The German Bundestag’s decisions are prepared by its committees, which are estab lished at the start of each elec toral term. Four of them are stipulated by the Basic Law, the German constitution: the Committee on Foreign Affairs, the Defence Committee, the Committee on the Affairs of the European Union and the Petitions Committee. The Budget Committee and the Committee for the Rules of Procedure are also required by law. The spheres of respon sibility of the committees essentially reflect the Federal Government’s distribution of ministerial portfolios. This enables Parliament to scruti nise the government’s work effectively. The Bundestag committees The German Bundestag sets political priorities of its own by establishing additional committees for specific sub jects, such as sport, cultural affairs or tourism. In addition, special bodies such as parlia mentary advisory councils, The committees discuss and committees of inquiry or deliberate on items referred study commissions can also to them by the plenary. -

Eine Geschichtspolitische Erfolgsgeschichte Im Gegenwind
Gedenkstätten und Geschichtspolitik – »Beiträge«, Heft 16 75 Detlef Garbe Gedenkstätten in der Bundesrepublik: Eine geschichtspolitische Erfolgsgeschichte im Gegenwind Unter der plakativen Überschrift »Falsche Pri- und Hungerpolitik gehörten, gleichwohl aber orität. Das Holocaust-Gedenken läuft Gefahr, im Rahmen der Stiftung »Erinnerung, Verant- in die zweite Reihe der deutschen Geschichts- wortung und Zukunft« von allen Zahlungen politik zu geraten«1 publizierte die Wochen- ausgeschlossen blieben, erklärt die Bundes- zeitung »Jüdische Allgemeine« am 23. Janu- regierung unumwunden, dass sie eine solche ar 2014 ihren Leitartikel zum Gedenktag für Entschädigung nicht anstrebe.7 Für »Opfer der die Opfer des Nationalsozialismus. Der Autor politischen Verfolgung in der ehemaligen SBZ/ des Leitartikels, Habbo Knoch, damals noch DDR (SED-Opferrente)«8 sieht der Koaliti- Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische onsvertrag hingegen eine Erhöhung der mo- Gedenkstätten, erkannte in dem vergleichs- natlichen Zuwendungen vor. Zur Stärkung der weise ausführlichen Abschnitt »Gedenken und »mahnende[n] Erinnerung an Flucht und Ver- Erinnern, kulturelles Erbe, Baukultur«2 des treibung« wurde die Einführung eines weiteren im Monat zuvor zwischen CDU, CSU und Gedenktages vereinbart,9 allerdings schweigt SPD geschlossenen Koalitionsvertrags einen sich der Koalitionsvertrag wenigstens zu der »geschichtspolitischen Paradigmenwechsel«3. vom Europäischen Parlament betriebenen Ini- Die neue Bundesregierung lege ihr Primat an- tiative zur Einführung des 23. -

Stellungnahme Zur Grundsicherung
DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)1176 Ausschuss für Arbeit und Soziales 4. Juni 2021 19. Wahlperiode Schriftliche Stellungnahme Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. Juni 2021 um 12:30 Uhr zum a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Pascal Kober, Michael Theurer, Jens Beeck, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Bagatellgrenze für Rückforderungen im Zweiten Sozialgesetzbuch - BT-Drucksache 19/29742 b) Antrag der Abgeordneten Ulrike Schielke-Ziesing, René Springer, Jürgen Pohl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD Armutsbekämpfung bei Rentnern – Einführung eines 25-Prozent-Freibetrages in der Grundsicherung - BT-Drucksache 19/29768 c) Antrag der Abgeordneten Matthias W. Birkwald, Katja Kipping, Susanne Ferschl, wei- terer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. Grundsicherungskürzungen bei Rentnerinnen und Rentnern verhindern - BT-Drucksache 19/24454 d) Antrag der Abgeordneten Katja Kipping, Matthias W. Birkwald, Susanne Ferschl, wei- terer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. Hartz IV überwinden – Sanktionsfreie Mindestsicherung einführen - BT-Drucksache 19/29439 e) Antrag der Abgeordneten Sven Lehmann, Anja Hajduk, Dr. Wolfgang Strengmann- Kuhn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Garantiesicherung statt Hartz IV – Mehr soziale Sicherheit während und nach der Corona-Krise - BT-Drucksache 19/25706 siehe Anlage 03.06.2021 // Öffentliche Anhörung im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales am 07.06.2021 STELLUNGNAHME ZU DEN ANTRÄGEN a) der Abgeordneten Sven Lehmann, Anja Hajduk, Dr. Wolfgang Strengmann- Kuhn, Markus Kurth, Beate Müller-Gemmeke, Corinna Rüffer, Filiz Polat, Ekin Deligöz, Katharina Dröge, Claudia Müller, Lisa Paus, Stefan Schmidt, Luise Amtsberg, Kai Gehring, Britta Haßelmann, Dr.