Masterarbeit / Master's Thesis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

April 2020 Newsletter
April 2020 www.rwop.org Board of Directors President Mindy Fischer President-Elect Linda Robertson First Vice-President (Programs) Kathy White Second Vice-President (Membership) Mary Anne Gibson Third Vice-President (Fundraising) Gayle Bennett Treasurer Betsy Landers Republican Women of Assistant Treasurer Linda Fisher Purpose Recording Secretary Peggy Haguewood Corresponding Secretary As Republican Women, we are Lisa Haguewood Chaplain conservative. And as conservatives, we are Dot Wieters cautious. In accordance with the CDC Membership Chair Beth Ueleke directive, we are canceling our meeting on Finance Chair April 1, 2020. Millie Gump By-Laws Chair Public Relations Chair We will continue to monitor the situation Pat Scroggs and will keep our members informed of any Legislation Chair Lucy Doane changes in our regular schedule. Campaign Chair/Volunteer Hours Julie Ethridge LDOH We hope to see the candidates for US Senate Lyna Medlock/Natalie Williams at our June BBQ, scheduled for June 3rd at Kathy White Parliamentarian Halle Plantation Clubhouse from 5:30 p.m. Barbara Trautman Newsletter until 7:30 p.m.. Suzanne Cunningham Special Events Terri Boatright/Lyna Medlock Peggy Larkin Caring for America Kelly Ellington Iris Fund Beth Webb Voter Registration Chair Cynthia Crosby/Kristina Garner Area 9 Vice President Millie Gump IT Liaison Kristina Garner/Barbara Capozella Historian Welcome New Members! Literacy Chair Kay Kelsey/Susie Field Joanna Young, [email protected]; Gail Weaver; Jan Winterburn Directory Chair [email protected]; Lauran Wingo; Dana Kendrick, Diana Taylor Immediate Past President [email protected] Sharon Ohsfeldt Nominating Committee Associate Members: Brandon Weise, Naser Fazlullah, Ben Landers, Sharon Ohsfeldt/Barbara Trautman Beth Webb/Susie Field/Kristina Garner Gail Weaver, John Paul Miles, Nancy Rose, The Honorable Paul Rose, Terri Boatwright/Karen Dunavant John Gillespie, Charlotte Kelly President's Message by Mindy Fischer " We live in a world in which we need to share responsibility. -

TRANSNATIONAL SMYTH: SUFFRAGE, COSMOPOLITANISM, NETWORKS Erica Fedor a Thesis Submitted to the Faculty at the University Of
TRANSNATIONAL SMYTH: SUFFRAGE, COSMOPOLITANISM, NETWORKS Erica Fedor A thesis submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Department of Music. Chapel Hill 2018 Approved by: Annegret Fauser David Garcia Tim Carter © 2018 Erica Fedor ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Erica Fedor: Transnational Smyth: Suffrage, Cosmopolitanism, Networks (Under the direction of Annegret Fauser) This thesis examines the transnational entanglements of Dame Ethel Smyth (1858–1944), which are exemplified through her travel and movement, her transnational networks, and her music’s global circulation. Smyth studied music in Leipzig, Germany, as a young woman; composed an opera (The Boatswain’s Mate) while living in Egypt; and even worked as a radiologist in France during the First World War. In order to achieve performances of her work, she drew upon a carefully-cultivated transnational network of influential women—her powerful “matrons.” While I acknowledge the sexism and misogyny Smyth encountered and battled throughout her life, I also wish to broaden the scholarly conversation surrounding Smyth to touch on the ways nationalism, mobility, and cosmopolitanism contribute to, and impact, a composer’s reputations and reception. Smyth herself acknowledges the particular double-bind she faced—that of being a woman and a composer with German musical training trying to break into the English music scene. Using Ethel Smyth as a case study, this thesis draws upon the composer’s writings, reviews of Smyth’s musical works, popular-press articles, and academic sources to examine broader themes regarding the ways nationality, transnationality, and locality intersect with issues of gender and institutionalized sexism. -

Revue Française De Civilisation Britannique, XXIII-1
Revue Française de Civilisation Britannique French Journal of British Studies XXIII-1 | 2018 Women in Britain since 1900: Evolution, Revolution or 'Plus ça change...' ? La Situation des femmes au Royaume-Uni depuis 1900 : changement ou continuité ? Marc Calvini-Lefebvre et Laura Schwartz (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/rfcb/1748 DOI : 10.4000/rfcb.1748 ISSN : 2429-4373 Éditeur CRECIB - Centre de recherche et d'études en civilisation britannique Référence électronique Marc Calvini-Lefebvre et Laura Schwartz (dir.), Revue Française de Civilisation Britannique, XXIII-1 | 2018, « Women in Britain since 1900: Evolution, Revolution or 'Plus ça change...' ? » [En ligne], mis en ligne le 15 mars 2018, consulté le 04 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/rfcb/1748 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rfcb.1748 Ce document a été généré automatiquement le 4 septembre 2020. Revue française de civilisation britannique est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. 1 SOMMAIRE Confronting Continuity in Women's History Introduction: British Civilization Studies and the “Woman Question” Marc Calvini-Lefebvre et Laura Schwartz « On ne peut pas empêcher les concepts de voyager » : un entretien avec Christine Delphy Marc Calvini-Lefebvre Gendered Implications of the Neoliberal Turn Neo-liberalism and Gender Inequality in the Workplace in Britain Louise Dalingwater A Tale of Female Liberation? The Long Shadow -

Votes for Women (Birmingham Stories)
Votes for Women: Tracing the Struggle in Birmingham Contents Introduction: Votes For Women in Birmingham The Rise of Women’s Suffrage Societies Birmingham and the Women’s Social and Political Union Questioning The Evidence of Suffragette History in Birmingham Key Information on Suffragette Movements in Birmingham Sources from Birmingham Archives and Heritage Collections General Sources Written by Dr Andy Green, 2009. www.connectinghistories.org.uk/birminghamstories.asp Early women’s Histories in the archive Reports of the Birmingham Women’s Suffrage Society [LF 76.12] Birmingham Branch of the National Council of Women [MS 841] Women Workers Union Reports [L41.2] ‘Suffragettes at Aston Parliament’, Birmingham Weekly Mercury, 17 October 1908. Elizabeth Cadbury Papers Introduction: Votes for Women in Birmingham [MS 466] The women of Birmingham and the rest of Britain only won the right to vote through a long and difficult campaign for social equality. ‘The Representation The Female Society for of the People Bill’ (1918) allowed women over the age of thirty the chance Birmingham for the Relief to participate in national elections. Only when the ‘Equal Franchise Act’ of British Negro Slaves (1928) was introduced did all women finally have the right to take part in [IIR: 62] the parliamentary voting system as equal citizens. For centuries, a sexist opposition to women’s involvement in public life tried Birmingham Association to keep women firmly out of politics. Biological arguments that women were for the Unmarried inferior to men were underlined by sentimental portrayals of women as the Mother and Her Child rightful ‘guardians of the home’. While women from all classes, backgrounds and political opinions continued to work, challenge and support society, [MS 603] their rights were denied by a ‘patriarchal’ or ‘male centred’ British Empire in which men sought to control and dominate politics. -
Red Gray Steps to Bicycle Safety Infographic
HOW TO MAKE A SUFFRAGETTE SASH Method One: For those low on time and/or resources 1 SUPPLIES NEEDED 1.Any white ribbon at least 1.5" wide. This one was purchased second-hand, most likely floral ribbon 2. Scissors 3. Newspaper 4. Purple, yellow and black permanent markers 5. Safety pin 2 MEASURING Hold the ribbon at your shoulder and stretch it diagonally to approximately 2" past your opposite hip. Double the ribbon and then cut it. 3 ADDING THE STRIPES Using newspaper to protect your work surface, color a stripe of purple down one entire side of your ribbon and a yellow stripe down the other. 4 ADDING THE SLOGAN Choose a slogan. Fold your sash in half so you make sure you are only writing the slogan on what will be the front. Use a black permanent marker and your best handwriting to add the slogan. 5 FINISHING Put your slash on so the slogan is in front. Use a saftey pin to pin the two ends together. 6 WEAR WITH PRIDE As Lebanon Township Committeman Tom McKee did at a township meeting where a proclamation honoring 100 Years of Suffrage was read by Councilwoman Beverly Koehler, seen here in full costume. C R E A T E D B Y T H E L E B A N O N T O W N S H I P M U S E U M HOW TO MAKE A SUFFRAGETTE SASH Method Two: For those with slightly more time or resources 1 SUPPLIES NEEDED 1. White grosgrain ribbon, 3" wide 2. -
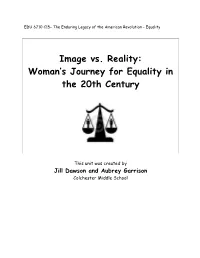
Woman's Journey for Equality in the 20Th Century
EDU 6710 C15- The Enduring Legacy of the American Revolution – Equality Image vs. Reality: Woman’s Journey for Equality in the 20th Century This unit was created by Jill Dawson and Aubrey Garrison Colchester Middle School Jill Dawson and Aubrey Garrison 2 Table of Contents Table of Contents…………………………………………………………………………….……..…………………2-3 Project Proposal (Unit Description)………………………………………………………………..…….4-11 Unit Calendar (teacher tool)…..………………………………………………………………………………12 Unit Notes (teacher tool)……………………………………………………………………………..…………13-22 Unit Overview (student handout)…………………………………………………………………………..23-24 Key Vocabulary for Unit (student handout)……………………………………………………….25-26 Notes Sheet (student handout)……………………………………………………..........................27-31 Analyzing Primary Sources: The Declaration of Independence (teacher lesson plan, including student handouts)……………………………………………..32-41 Analyzing Primary Sources: Letters Between John and Abigail Adams (teacher lesson plan, including student handouts)……………………………………………42-43 Analyzing Primary Sources: Elizabeth Cady Stanton’s Declaration of Sentiments (teacher lesson plan, including student handouts)……………………………………………44-53 Introducing the Women’s Suffrage Movement (teacher lesson plan, including student handouts)……………………………………………54-55 Analyzing Primary Sources: Women of 1900 – 1920 (teacher lesson plan, including student handouts)……………………………………………56-64 Study Guide for Accommodated Pop Quiz #1 (student handout/assessment)………………………………………………………………………………65-66 Accommodated Pop Quiz #1 (student handout/assessment)………………………………………………………………………………67-68 -

A Prostitution of the Profession?: the Ethical Dilemma of Suffragette
22-4-2020 ‘A Prostitution of the Profession’?: The Ethical Dilemma of Suffragette Force-Feeding, 1909–14 - A History of Force Feeding - NCBI … NCBI Bookshelf. A service of the National Library of Medicine, National Institutes of Health. Miller I. A History of Force Feeding: Hunger Strikes, Prisons and Medical Ethics, 1909-1974. Basingstoke (UK): Palgrave Macmillan; 2016 Aug 26. Chapter 2 ‘A Prostitution of the Profession’?: The Ethical Dilemma of Suffragette Force-Feeding, 1909–14 In 2013, the British Medical Association wrote to President Obama and US Secretary of Defense Chuck Hagel inveighing against force-feeding policies at Guantánamo Bay. The Association was deeply concerned with the ethical problems associated with feeding prisoners against their will, seeing this as a severe violation of medical ethics. To support its emotive claims, the Association pointed to the Declarations of Tokyo (1975) and Malta (1991) which had 1 both clearly condemned force-feeding as unethical. Nonetheless, American military authorities had resurrected the practice, the Association suggested, to avoid facing an embarrassing set of prison deaths that risked turning 2 international opinion against Guantánamo and the nature of its management. Like other critics, the Association had some compassion for military doctors who seemed to be caught in an unhappy dilemma: Should they prevent suicides by force-feeding or oversee slow, excruciating deaths from starvation? Yet despite showing empathy, critics from within the medical profession, such as British general -

Suffrage and Suffragettes in the Hartlepools, 1869 to 1919
Suffrage and Suffragettes in the Hartlepools, 1869 to 1919 The early years The organised fight for the right of women to vote in the United Kingdom goes back to the early years of the 19th Century, when popular movements began to directly criticise the traditional and often corrupt system of selecting the all male Members of Parliament. While partially successful through winning the 1832 Reform Act, which extended voting to 1 in 7 men based solely on their ownership of property, the same Act explicitly banned women from voting. There was slight progress in 1869 when the Municipal Reform Act doubled the number of eligible male voters in local elections, and allowed a very small proportion of richer women to vote as the head of their household. The Hartlepools had supported this act, submitting a local petition requesting suffrage on 14th July 1869, and directly benefitted through gaining the right to elect its own MP for the first time. In 1872 the fight for women's suffrage became a national movement with the formation of the National Society for Women's Suffrage (NSWS), and later, the more influential National Union of Women's Suffrage Societies (NUWSS). On the 12th March 1872 the corporation of West Hartlepool submitted a petition in support of a second attempt by Jacob Bright, the MP for Manchester, to get a Women’s Suffrage Bill adopted into law. His bill was supported locally at a meeting at the Temperance Hall on the 8th April where the leading campaigner Lydia Becker, the founder of the Women’s Suffrage Journal, Isabella Stewart and the Rev. -

April 2020 VOTER
Vol.63 #4 Political Responsibility through Informed and Active Participation April 2020 Annual Membership Meeting Set for June 6th The League of Women Voters Eden Area plans to hold our Annual Membership Meeting on Saturday, June 6th, at 9:30am. We may hold the meeting just online, or in-person with an online option; the board will make the final decision at our April board meeting. If you have not attended an online meeting before, we want you to know that we will be giving lots of support and instructions on how to participate. As of this writing, it is uncertain as to the need to meet totally online, but we are being proactive and preparing for that need. If we do end up offering an in-person meeting, it will be held at the Castro Valley School District, either at the board room or at the adult school. We will give you plenty of notice as to the exact location. As mentioned above, we will definitely have an online option if we do offer the in-person meeting, since many of our members may still wish to stay at home due to the current health crisis. We will be modeling social distancing protocols and other health practices. We encourage members to save the date and look for our next issue of the VOTER for the meeting kit, and for further instructions on where and how we will meet. Thank you for your patience. Census Is Vital to Our Democracy By now you should have received your U.S. Census invitation in the mail; it is a light blue color. -

Gt Yearbooks 1911 St.Pdf
1{\ ARCHIVES Georg"etown University Washington, D. C. 20007 » /// ABo:'STVTS g YE DOMESDAY BOOKE 1911 GEORGETOWN UNIVERSITY LAW SCHOOL PUBLISHED BY THE SENIOR CLASS We, the Class of Nineteen Eleten, dedicate this Booke to our beloved Dean, Harry M. Clabaugh, in recognition of his sincere efforts to cultivate an abiding lote of honor and integrity among this student body, his earnest labor to adtance the •welfare of this Unitersity, his eager desire to elevate the personnel and the standards of his profession. May this small vjork serte as a token of our appreciation of his ^orth as a man, li>hose ideals are lofty and l^hose spirit, pure. To the Class of Nineteen Elel>en, Greeting: We, the Editors of the Domesday Booke, have endeat- ored to portray, as best 'tee may, the happenings of the past three years; ive have sought to photograph the Class upon the pages of this Booke. If, at times, we hate erred, it is an error of judgment, not of intention. If, at times, v)e hate painted roughly, it is a defect of technique, not of spirit. We, hereby, complete our final ')t>riting, and "lie dovjn to pleasant dreams. " 5 Lecturers HOX. HARRY .M. ('LABAr(;H, LL.D. Dean of the Faculty, Lecturer on Common Law Pleading and Prai'tire, and. Equity Pleading and Practice GEORGE E. H.\?*IILTOX, LL.D. Lecturer on the Law of Wills HOX. SETH SHEPARij, LL.D. Lecturer on Constitidioiial Law and Equity Jurisprudence HOX. ASHLEY M. (JOULD Lecturer art the Law of Contracts, Persons and Domestic Relations, and Insurance HOX. -

A History of Force Feeding
A History of Force Feeding Ian Miller A History of Force Feeding Hunger Strikes, Prisons and Medical Ethics, 1909–1974 This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/), which permits use, duplication, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license and indicate if changes were made. The images or other third party material in this book are included in the work’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in the credit line; if such material is not included in the work’s Creative Commons license and the respective action is not permitted by statutory regulation, users will need to obtain permission from the license holder to duplicate, adapt or reproduce the material. Ian Miller Ulster University Coleraine , United Kingdom ISBN 978-3-319-31112-8 ISBN 978-3-319-31113-5 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-31113-5 Library of Congress Control Number: 2016941754 © The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2016 Open Access This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License ( http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), which permits use, duplication, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license and indicate if changes were made. -

Dedication Planned for New National Suffrage Memorial
Equality Day is August 26 March is Women's History Month NATIONAL WOMEN'S HISTORY ALLIANCE Women Win the Vote Before1920 Celebrating the Centennial of Women's Suffrage 1920 & Beyond You're Invited! Celebrate the 100th Anniversary of Women’s Right to Vote Learn What’s Happening in Your State and Online HROUGHOUT 2020, Americans will celebrate the Tcentennial of the extension of the right to vote to women. When Congress passed the 19th Amendment in 1919, and 36 states ratified it by August 1920, women’s right to vote was enshrined in the U.S. Constitution. Now there are local, state and national centennial celebrations in the works including shows and © Trevor Stamp © Trevor parades, parties and plays, films The Women’s Suffrage Centennial float in the Rose Parade in Pasadena, California, was seen by millions on January 1, 2020. On the float were the and performers, teas and more. descendants of suffragists including Ida B. Wells, Susan B. Anthony, Harriet Tubman, Frederick Douglass and Elizabeth Cady Stanton. Ten rows of Learn more, get involved, enjoy the ten women in white followed, waving to the crowd. Trevor Stamp photo. activities, and recognize as never before that women’s hard fought Dedication Planned for New achievements are an important part of American history. National Suffrage Memorial HE TURNING POINT Suffra- were jailed over 100 years ago. This gist Memorial, a permanent marked a critical turning point in suffrage Inside This Issue: tribute to the American women’s history. Great Resources T © Robert Beach suffrage movement, will be unveiled on Spread over an acre, the park-like A rendering of the Memorial August 26, 2020 in Lorton, Virginia.