Erläuterungen RROP 2001
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Variational Text Linguistics: Revisiting Register in English
Christoph Schubert and Christina Sanchez-Stockhammer (Eds.) Variational Text Linguistics Topics in English Linguistics Editors Elizabeth Closs Traugott Bernd Kortmann Volume 90 Variational Text Linguistics Revisiting Register in English Edited by Christoph Schubert Christina Sanchez-Stockhammer ISBN 978-3-11-044310-3 e-ISBN (PDF) 978-3-11-044355-4 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-043533-7 ISSN 1434-3452 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2016 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Cover image: Brian Stablyk/Photographer’s Choice RF/Getty Images Typesetting: fidus Publikations-Service GmbH, Nördlingen Printing and binding: CPI books GmbH, Leck ♾ Printed on acid-free paper Printed in Germany www.degruyter.com Acknowledgements The foundations for this edited collection of articles were laid at the interna- tional conference Register revisited: New perspectives on functional text variety in English, which took place at the University of Vechta, Germany, from June 27 to 29, 2013. The aim of the present volume is to conserve the research papers and many inspiring discussions which were stimulated then and to make them available to a larger audience. It was only possible to achieve this aim thanks to the help of many people joining us in the effort. First and foremost, we would like to thank all contributors for their continued cooperation in this project. -

KSB Celle KSB Harburg-Land Sportbund Heidekreis Inhaltsverzeichnis
anerkannt für ÜL C Ausbildung KSB Celle KSB Harburg-Land Sportbund Heidekreis Inhaltsverzeichnis Hier sind alle Fortbildungen zu finden, die über die Sportbünde Celle, Harburg-Land und Heidekreis angeboten werden. Mit einem „Klick“ auf den Titel werden sie direkt zur entsprechenden Ausschreibung geleitet Sprache lernen in Bewegung-Elementarbereich 4 Spiel und Sport im Schwarzlichtmodus 5 Fit mit digitalen Medien 6 Sport und Inklusion 7 Kräftigen und Dehnen 8 Fit mit Ausdauertraining /Blended learning Format 9 Starke Muskeln-wacher Geist - Kids 10 Spielekiste und trendige Bewegungsangebote 11 Das Deutsche Sportabzeichen 12 #Abenteuer?-Kooperative Abenteuerspiele und Erlebnispädagogik 13 Spiel- und Sport für kleine Leute 14 Alles eine Frage der Körperwahrnehmung! 15 Trainieren mit Elastiband 16 Mini-Sportabzeichen 17 Spiele mit Ball für Kinder im Vorschulalter 18 Rund um den Ball 19 Fitball-Trommeln 20 Einführung in das Beckenbodentraining 21 Der Strand wird zur Sportanlage 22 Inhaltsverzeichnis Stärkung des Selbstbewusstsein und Schutz vor Gewalt im Sport 23 Einführung in die Feldenkraismethode 24 Natur als Fitness-Studio 25 Bewegt in kleinen Räumen und an der frischen Luft 26 Übungsvielfalt 27 Stabil und standfest im Alter 28 Sport und Inklusion 29 Kinder stark machen 30 Ausbildung ÜL C 31 Information und Anmeldung 32 Legende: LQZ sind kostenfreie Fortbildungen für Lehrer, Erzieher und ÜL im Rahmen des Aktionsprogramms „Lernen braucht Bewegung“. Diese Fortbildung ist im C 50-Flexbereich der ÜL C-Ausbildung Breitensport anerkannt. ÜL B Diese Ausbildung ist für ÜL B Prävention anerkannt. Sprache lernen ….. 16.00-19.15 Uhr (4 LE) Celle Kostenfrei/ LQZ Dr. Bettina Arasin Nr.: 2/32/13870 … in Bewegung für den Elementarbereich. -

Mitgliedschaft Des Landkreises Cloppenburg in Gesellschaften, Körperschaften, Verbänden Und Vereinen
Kreisrecht Mitgliedschaft des Landkreises Cloppenburg in Gesellschaften, Körperschaften, Verbänden und Vereinen Lfd. Nr. Bezeichnung Amt 1 Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter der Länder Nieder- 50 sachsen und Bremen (AGJÄ) 2 Arbeitsgemeinschaft Peripherer Regionen Deutschlands WI (APER) 3 Bezirksverband Oldenburg 10 4 Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen WI (BAG-LEADER) 5 Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. 10 (vhw) 6 Caritas Verein Altenoythe 50 7 c-Port Hafenbesitz GmbH 20 8 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. 50 9 Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. 51 (DIJuF) 10 Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik 10 11 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 70 Abfall e.V. (DWA) 12 Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband 20 13 Energienetzwerk Nordwest (ENNW) 40 14 Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e.V. 20 15 FHWT Vechta-Diepholz-Oldenburg, Private Fachhochschule WI für Wirtschaft und Technik 16 Förder- und Freundeskreis psychisch Kranker im Landkreis 53 Cloppenburg e.V. 17 Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV) 10 18 Gemeinsame Einrichtung gemäß § 44 b SGB II (Jobcenter) 50 19 Gemeinschaft DAS OLDENBURGER LAND WI 19 Gesellschaft zur Förderung der Gewinnung von Energie aus 20 Biomasse der Agrar- und Ernährungswirtschaft mbH (GEA) 20 Großleitstelle Oldenburger Land 32 21 Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V. 67 22 GVV Kommunalversicherung VVaG 10 23 Heimatbund für das Oldenburger Münsterland e.V. 40 24 Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen e.V. 40 25 Interessengemeinschaft „Deutsche Fehnroute e.V.“ WI 26 Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) 10 27 Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanage- 10 ment (KGSt) 28 Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V. 10 (KAV) 29 Kommunaler Schadenausgleich Hannover (KSA) 20 30 Kreisbildungswerk Cloppenburg – Volkshochschule für den 40 Landkreis Cloppenburg e.V. -
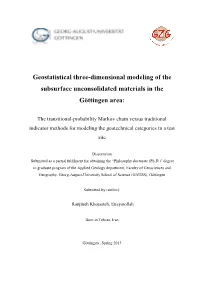
3.3. the Indicator Kriging (IK) Analyses for the Göttingen Test Site
Geostatistical three-dimensional modeling of the subsurface unconsolidated materials in the Göttingen area: The transitional-probability Markov chain versus traditional indicator methods for modeling the geotechnical categories in a test site Dissertation Submitted as a partial fulfilment for obtaining the “Philosophy doctorate (Ph.D.)" degree in graduate program of the Applied Geology department, Faculty of Geosciences and Geography, Georg-August-University School of Science (GAUSS), Göttingen Submitted by (author): Ranjineh Khojasteh, Enayatollah Born in Tehran, Iran Göttingen , Spring 2013 Geostatistical three-dimensional modeling of the subsurface unconsolidated materials in the Göttingen area: The transitional-probability Markov chain versus traditional indicator methods for modeling the geotechnical categories in a test site Dissertation zur Erlangung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Doktorgrades " Philosophy doctorate (Ph.D.)" der Georg-August-Universität Göttingen im Promotionsprogramm Angewandte Geoliogie, Geowissenschaften / Geographie der Georg-August University School of Science (GAUSS) vorgelegt von Ranjineh Khojasteh, Enayatollah aus (geboren): Tehran, Iran Göttingen , Frühling 2013 Betreuungsausschuss: Prof. Dr. Ing. Thomas Ptak-Fix, Prof. Dr. Martin Sauter, Angewandte Geologie, Geowissenschaftliches Zentrum der Universität Göttingen Mitglieder der Prüfungskommission: Prof. Dr. Ing. Thomas Ptak-Fix, Prof. Dr. Martin Sauter, Angewandte Geologie, Geowissenschaftliches Zentrum der Universität Göttingen Referent: Prof. -

Pastports, Vol. 3, No. 8 (August 2010). News and Tips from the Special Collections Department, St. Louis County Library
NEWS AND TIPS FROM THE ST. LOUIS COUNTY LIBRARY SPECIAL COLLECTIONS DEPARTMENT VOL. 3, No. 8—AUGUST 2010 PastPorts is a monthly publication of the Special Collections Department FOR THE RECORDS located on Tier 5 at the St. Louis County Library Ortssippenbücher and other locale–specific Headquarters, 1640 S. Lindbergh in St. Louis sources are rich in genealogical data County, across the street Numerous rich sources for German genealogy are published in German-speaking from Plaza Frontenac. countries. Chief among them are Ortssippenbücher (OSBs), also known as Ortsfamilienbücher, Familienbücher, Dorfsippenbücher and Sippenbücher. CONTACT US Literally translated, these terms mean “local clan books” (Sippe means “clan”) or To subscribe, unsubscribe, “family books.” OSBs are the published results of indexing and abstracting change email addresses, projects usually done by genealogical and historical societies. make a comment or ask An OSB focuses on a local village or grouping of villages within an ecclesiastical a question, contact the parish or administrative district. Genealogical information is abstracted from local Department as follows: church and civil records and commonly presented as one might find on a family group sheet. Compilers usually assign a unique numerical code to each individual BY MAIL for cross–referencing purposes (OSBs for neighboring communities can also reference each other). Genealogical information usually follows a standard format 1640 S. Lindbergh Blvd. using common symbols and abbreviations, making it possible to decipher entries St. Louis, MO 63131 without an extensive knowledge of German. A list of symbols and abbreviations used in OSBs and other German genealogical sources is on page 10. BY PHONE 314–994–3300, ext. -

Summary of Family Membership and Gender by Club MBR0018 As of December, 2009 Club Fam
Summary of Family Membership and Gender by Club MBR0018 as of December, 2009 Club Fam. Unit Fam. Unit Club Ttl. Club Ttl. District Number Club Name HH's 1/2 Dues Females Male TOTAL District 111NH 21484 ALFELD 0 0 0 35 35 District 111NH 21485 BAD PYRMONT 0 0 0 42 42 District 111NH 21486 BRAUNSCHWEIG 0 0 0 52 52 District 111NH 21487 BRAUNSCHWEIG ALTE WIEK 0 0 0 52 52 District 111NH 21493 BURGDORF-ISERNHAGEN 0 0 0 33 33 District 111NH 21494 CELLE 0 0 0 43 43 District 111NH 21497 EINBECK 0 0 0 35 35 District 111NH 21501 GIFHORN 0 0 0 33 33 District 111NH 21502 GOETTINGEN 0 0 0 45 45 District 111NH 21505 HAMELN 0 0 0 41 41 District 111NH 21506 HANNOVER CALENBERG 0 0 0 30 30 District 111NH 21507 HANNOVER 0 0 0 59 59 District 111NH 21508 HANNOVER HERRENHAUSEN 0 0 0 51 51 District 111NH 21509 HANNOVER TIERGARTEN 0 0 0 38 38 District 111NH 21510 HELMSTEDT 0 0 0 41 41 District 111NH 21511 HILDESHEIM 0 0 2 43 45 District 111NH 21512 HILDESHEIM MARIENBURG 0 0 0 39 39 District 111NH 21513 HILDESHEIM ROSE 0 0 0 50 50 District 111NH 21514 HOLZMINDEN 0 0 0 39 39 District 111NH 21518 MUNSTER OERTZE 0 0 0 36 36 District 111NH 21521 GOSLAR-BAD HARZBURG 0 0 0 44 44 District 111NH 21522 NORTHEIM 0 0 0 35 35 District 111NH 21523 OBERHARZ 0 0 0 32 32 District 111NH 21528 SUEDHARZ 0 0 0 34 34 District 111NH 21531 PEINE 0 0 0 44 44 District 111NH 21532 PORTA WESTFALICA 0 0 0 35 35 District 111NH 21534 STEINHUDER MEER 0 0 0 28 28 District 111NH 21535 UELZEN 0 0 0 40 40 District 111NH 21536 USLAR 0 0 0 31 31 District 111NH 21539 WITTINGEN 0 0 0 33 33 District 111NH -

Organigramm Des Kirchenamtes Hildesheim Telefon: 05121 100-0 Telefax: 05121 100-999 (Sekretariat OG)
Verwaltungsleitung Jens Stöber, Tel. -600 Querschnittsaufgaben Organigramm des Kirchenamtes Hildesheim Monika Reicke*) / Andrea Hildebrandt / Sabine Reich-Meyer*) Stand: 01.01.2018 · Leitung Kirchenamt Tel. -601 / -603 / -601 Telefon: 05121 100-0 · Betreuung Verbandsvorstand · Postausgang / · Posteingang Telefax: 05121 100-999 (Sekretariat OG) · Erteilung von Genehmigungen nach KGO und KKO sowie · Registratur/Archiv / · Sitzungsdienst Beanstandung von Beschlüssen · Telefonzentrale · Budgetplanung Datenschutzbeauftragte: Elke Schünemann * -106 · Betreuung Kirchenkreisverband Hildesheim Fachbereich I Fachbereich II Fachbereich III Fachbereich IV Fachbereich V - Finanz- und Bauwesen - Rechnungswesen – - Liegenschaften / Friedhöfe / EDV / - Personalwesen – - Diakonie - Fachbereichsleiter: Hartmut Haase Meldewesen Fachbereichsleiter: Helmut Jost Tel. -200 Fachbereichsleiter: Matthias Wehling Fachbereichsleiter: Sven Böning Fachbereichsleiterin: Cordula Stepper Tel. -100 · Leitung des Fachbereiches Tel. -300 Tel. -400 Tel. -500 · stellvertretende Verwaltungsleitung · Verwaltung Rücklagen- u. Darlehensfonds (RDF) · Leitung des Fachbereiches · Leitung des Fachbereiches · stellvertretende Verwaltungsleitung · Leitung des Fachbereiches · Disposition der Geldanlagen · Generalia Liegenschaften und · grundsätzliche Fragen des · Leitung des Fachbereiches · Finanzplanung/Gesamtzuweisung Kirchenkreisverband · Aufsicht über Zahlstellen Ersatzlanderwerbe, EDV, Meldewesen Arbeits- und Dienstrechtes · Betreuung · Betreuung Kirchenkreisvorstand und FiPla-Ausschuss -
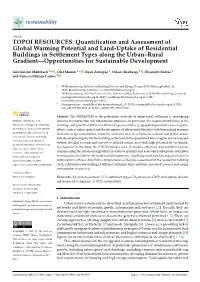
Quantification and Assessment of Global Warming Potential
sustainability Article TOPOI RESOURCES: Quantification and Assessment of Global Warming Potential and Land-Uptake of Residential Buildings in Settlement Types along the Urban–Rural Gradient—Opportunities for Sustainable Development Ann-Kristin Mühlbach 1,* , Olaf Mumm 2,* , Ryan Zeringue 2, Oskars Redbergs 2 , Elisabeth Endres 1 and Vanessa Miriam Carlow 2 1 TU Braunschweig, Institute for Building Services and Energy Design (IGS), Mühlenpfordtstr. 23, 38106 Braunschweig, Germany; [email protected] 2 TU Braunschweig, Institute for Sustainable Urbanism (ISU), Pockelsstr. 3, 38106 Braunschweig, Germany; [email protected] (R.Z.); [email protected] (O.R.); [email protected] (V.M.C.) * Correspondence: [email protected] (A.-K.M.); [email protected] (O.M.); Tel.: +49-531-391-3524 (A.-K.M.); +49-531-391-3537 (O.M.) Abstract: The METAPOLIS as the polycentric network of urban–rural settlement is undergoing Citation: Mühlbach, A.-K.; constant transformation and urbanization processes. In particular, the associated imbalance of the Mumm, O.; Zeringue, R.; Redbergs, shrinkage and growth of different settlement types in relative geographical proximity causes negative O.; Endres, E.; Carlow, V.M. TOPOI effects, such as urban sprawl and the divergence of urban–rural lifestyles with their related resource, RESOURCES: Quantification and land and energy consumption. Implicitly related to these developments, national and global sustain- Assessment of Global Warming able development goals for the building sector lead to the question of how a region can be assessed Potential and Land-Uptake of without detailed research and surveys to identify critical areas with high potential for sustainable Residential Buildings in Settlement development. -

The Spatial and Temporal Diffusion of Agricultural Land Prices
The Spatial and Temporal Diffusion of Agricultural Land Prices M. Ritter; X. Yang; M. Odening Humboldt-Universität zu Berlin, Department of Agricultural Economics, Germany Corresponding author email: [email protected] Abstract: In the last decade, many parts of the world experienced severe increases in agricultural land prices. This price surge, however, did not take place evenly in space and time. To better understand the spatial and temporal behavior of land prices, we employ a price diffusion model that combines features of market integration models and spatial econometric models. An application of this model to farmland prices in Germany shows that prices on a county-level are cointegrated. Apart from convergence towards a long- run equilibrium, we find that price transmission also proceeds through short-term adjustments caused by neighboring regions. Acknowledegment: Financial support from the China Scholarship Council (CSC NO.201406990006) and the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) through Research Unit 2569 “Agricultural Land Markets – Efficiency and Regulation” is gratefully acknowledged. The authors also thank Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Niedersachsen (P. Ache) for providing the data used in the analysis. JEL Codes: Q11, C23 #117 The Spatial and Temporal Diffusion of Agricultural Land Prices Abstract In the last decade, many parts of the world experienced severe increases in agricultural land prices. This price surge, however, did not take place evenly in space and time. To better understand the spatial and temporal behavior of land prices, we employ a price diffusion model that combines features of market integration models and spatial econometric models. An application of this model to farmland prices in Germany shows that prices on a county-level are cointegrated. -

Grundwasserschutzberatung in Der Zielkulisse Der EG-Wasserrahmenrichtlinie Für Die Beratungsgebiete Mittlere Ems/Vechte Und
Gewässerschutzberatung im Beratungsgebiet Hunte, März 2020 Kurzinformation der WRRL-Gewässerschutzberatung Gewässerschutzberatung in der WRRL-Zielkulisse Im letzten Jahr erfolgte die Neuausschreibung der Bera- tungsleistungen in den WRRL-Zielkulissen. Die bestehen- den Zielkulissen/ Beratungsgebiete wurden z.T. erweitert o- der neu zugeschnitten/ benannt. Darüber hinaus sind neue Gebiete dazugekommen (siehe www.lwk-niedersach- sen.de, webcode: 01021537). Die LWK Niedersachsen berät in den Zielkulissen Hunte, Leda-Jümme, Ems/ Hase und Hase. Die letzten drei ge- nannten Kulissen umfassen Teile der ehemals durch die LWK beratenen Gebiete Mittlere Ems Süd und Mittlere Ems Nord. Das Beratungsgebiet Hunte (siehe Karte) erstreckt sich im Wesentlichen über Teile der Landkreise Oldenburg, Diepholz, Vechta und Wesermarsch. Agrarumweltmaßnahmen 2020 In 2020 werden ausschließlich die nachfolgend aufgeführten Agrarumweltmaßnahmen ange- boten. Der Antrag auf entsprechende Förderung ist mit dem Sammelantrag (ANDI) bis spä- testens zum 15.05.2020 einzureichen. BV 1: Ökologischer Landbau (Grundförderung) BS 1: einjährige Blühstreifen BS 2: mehrjährige Blühstreifen BS 7: Erosions- / Gewässerschutzstreifen BS 8/ 9: Erosionsschutz-/ Vogelschutzhecke GL 1 bis GL 5: Grünlandmaßnahmen (Ausnahme GL 4, diese gilt nur für Bremer Antragsteller) Der Abschluss weiterer Agrarumweltmaßnahmen, z.B. AL 2 (Zwischenfruchtanbau), BV 2 (emissionsarme Gülleausbringung), ist in 2020 nicht möglich. Nährstoffsituation im Gebiet Hunte Anfang März 2020 wurde der Nährstoffbericht für Niedersachsen 2018/ 2019 veröffentlicht. Der Betrachtungsraum umfasst den Meldezeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2019. Die Stickstoffaufbringung aus organischen und organisch-mineralischen Düngemitteln pro Hektar liegt gemäß Nährstoffbericht in den im Gebiet Hunte befindlichen Landkreisen (LK, im Wesentlichen Oldenburg, Diepholz, Vechta und Wesermarsch) im Bereich zwischen 144 kg N/ha (LK DH) und 180 kg N/ha (LK VEC). -

Of Council Regulation (EC)
C 305/24 EN Official Journal of the European Union 16.12.2009 V (Announcements) OTHER ACTS COMMISSION Publication of an application pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (2009/C 305/09) This publication confers the right to object to the application pursuant to Article 7 of Council Regulation (EC) No 510/2006. Statements of objection must reach the Commission within six months from the date of this publication. SINGLE DOCUMENT COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 ‘LÜNEBURGER HEIDEKARTOFFELN’ EC No: DE-PGI-0005-0614-03.07.2007 PGI ( X ) PDO ( ) 1. Name: ‘Lüneburger Heidekartoffeln’ 2. Member State or third country: Germany 3. Description of the agricultural product or foodstuff: 3.1. Type of product: Class 1.6: Fruit, vegetables and cereals, fresh or processed 3.2. Description of the product to which the name in (1) applies: Ware potatoes and early potatoes of class ‘extra’ produced in the Lüneburger Heide. ‘Lüneburger Heidekartoffeln’ have a pale, smooth skin with flat eyes and yellow flesh. They correspond to the cooking qualities ‘vorwiegend festkochend’ (vf) (mainly firm boiling) or ‘festkochend’ (f) (firm boiling) and fulfil the quality characteristics of class ‘extra’; they are therefore healthy, whole, firm and prac tically clean potatoes; for the elongated varieties there is a lower grading limit of 30 mm, for the round varieties a limit of 35 mm. The biggest difference between the largest and the smallest tuber within a consignment or packaging unit must not be more than 30 mm. -
Waldglashütten Im Osterwald Informationen Und Quellen Zur Frühgeschichte Der Glasproduktion Im Nördlichen Weserbergland
Waldglashütten im Osterwald Informationen und Quellen zur Frühgeschichte der Glasproduktion im nördlichen Weserbergland Der Höhenzug des Osterwaldes im heutigen Kreis Hameln-Pyrmont ist bekannt für einen mehr als 300-jährigen Steinkohlenbergbau sowie als Standort mehrerer neuzeitlicher Glashütten. Als Lauen- steiner Gläser besaßen die Produkte der Osterwalder Glashütten im 18. und 19. Jahrhundert europaweit hohes Ansehen. Das erste Glas im Osterwald wurde bereits Hunderte von Jahren früher hergestellt. Eine Waldglashütte des 15. Jahrhunderts im Osterwald Wesentliches Kennzeichen früher Glasherstellung war die Anlage der Be- triebe fernab von Städten und Siedlungen in holzreichen und unzugäng- lichen Waldgebieten. Vor allem der Archäologie verdanken wir wichtige Erkenntnisse über die mitteleuropäischen Glaslandschaften, zu denen auch das Weserbergland gehörte. Die historischen Quellen fließen dage- gen eher spärlich. Auch die Informationen zu den frühen Glashütten im Osterwald sind nur infolge besonders glücklicher Umstände überliefert. Am 9. November des Jahres 1497 treffen fünf männliche, erwachse- ne Mitglieder der Familie Bock aus zwei Linien zusammen - vermutlich auf einem Burghof der Familie in Elze. Die ursprünglich aus Wülfingen stammenden Böcke halten bereits seit mehr als 100 Jahren das Recht, Holz und Bodenschätze im östlichen Teil des Osterwalds zu nutzen. Das Waldgebiet ist ungeteilter Familienbesitz und alle lebenden männlichen Familienmitglieder versuchen 1497, ihre Rechte gegen die Grafen von Spiegelberg in Coppenbrügge