Offenheit Und Teilen in Der Open Educational Resources (OER) Bewegung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Open Education Resources: Current Limitations and Challenges and Its Usage in Developing Countries
Open Education Resources: Current Limitations and Challenges and its Usage in Developing Countries Mark Peneder and Felix Walcher February 9, 2020 1 Abstract As the cost and demand of higher education is on the rise all over the world, education stakeholders are searching for ways to meet these demands. Open Educational Resources (OER) have the potential to provide these resources and promote lifelong learning. OER are freely accessible resources for educational purpose. OER are considered to reduce the gap between different strata of society and countries. But despite all these opportunities, OER has still not reached its full potential. This might be explained by the fact that it is still in the early adoption state and the number of challenges that OER is still facing at the moment. Often both teachers and students in higher education communities are not aware of the potential of OER. Furthermore, the major content of OER is mostly English language based and global north dominated. OER is free to use but not free to produce and maintain, because of this the perhaps biggest challenge of Open Educational Resources is their sustainability in financial terms. Developing countries have the possibility to benefit even more from existing OER to enhance or develop new teaching material based on the knowledge from all over the world but are also facing additional challenges. The western-dominated resources have to be recontextualized for their cultural context and they are plagued by limited funding, poor internet infrastructure and a general lack of awareness of OER and policies for its use and creation. -

Open Source and Sustainability: the Role of University
OPEN SOURCE AND SUSTAINABILITY: THE ROLE OF UNIVERSITY Dr. Giorgio F. SIGNORINI, PhD Dipartimento di Chimica, Università di Firenze via della Lastruccia, 3 I-50019 Sesto F. (Firenze), Italy giorgio.signorini@unifi.it Abstract One important goal in sustainability is making technologies available to the maximum possible number of individuals, and especially to those living in less developed areas (Goal 9 of SDG). However, the diffusion of technical knowledge is hindered by a number of factors, among which the Intellectual Property Rights (IPR) system plays a primary role. While opinions about the real effect of IPRs in stimulating and disseminating innovation differ, there is a growing number of authors arguing that a different approach may be more effective in promoting global development. The success of the Open Source (OS) model in the field of software has led analysts to speculate whether this paradigm can be extended to other fields. Key to this model are both free access to knowledge and the right to use other people’s results. After reviewing the main features of the OS model, we explore different areas where it can be profitably applied, such as hardware design and production; we then discuss how academical institutions can (and should) help diffusing the OS philosophy and practice. Widespread use of OS software, fostering of research projects aimed to use and develop OS software and hardware, the use of open education tools, and a strong commitment to open access publishing are some of the discussed examples. Keywords Sustainable Development, University, Open Source, Open Education, Open Access 1 Introduction What is sustainability about? According to the widely accepted definition of the Brundtland Report (Brundtland 1987), human development is sustainable when it can satisfy the needs of the current generation without compromising the ability of future generations to do the same. -

(OER) Movement
MiT8 public media, private media May 3-5, 2013 at MIT, Cambridge, MA Theo Hug <[email protected]> (University of Innsbruck) Education for All Revisited: On Concepts of Sharing in the Open Educational Resources (OER) Movement DRAFT VERSION Abstract1 Relationships between the private and public sphere in education have been discussed repeatedly and in various ways. However, the role of media and media dynamics is widely underestimated in this context. Only recently, after the digital turn, has the focus of the debates changed. In the past few years, manifold initiatives aiming at opening up education on various levels using digital communications technologies and Creative Commons licenses. Additionally, massive open online courses (moocs) have been developed. Today, OER (Open Educational Resources) is used widely as an umbrella term for free content creation initiatives: OER Commons (http://www.oercommons.org/), Open Courseware (OCW), OER repositories, OCW search facilities, University OCW initiatives, and related activities. Shared resource sites such as Connexions (http://cnx.org), WikiEducator (http://wikieducator.org), and Curriki (www.curriki.org) have an increasing number of visitors and contributors. On one hand, the motif of ‘education for all’ is once again appearing in related debates and practices. On the other hand, notions of sharing play a crucial role in open content and open education strategies. This paper has a threefold purpose: it starts with an outline of selected understandings of sharing in educational contexts; it then addresses their relevance for OER development through examining contrasting and relational conceptual dimensions. Furthermore, the contribution aims to take forms of sharing as media forms and to distinguish between stronger and weaker forms of sharing. -

Open Courseware and Developing Countries: Building a Community
Open Courseware and Developing Countries: Building a Community This is the report of The Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries, convened in Paris by UNESCO 1-3 July 2002, with the support of the William and Flora Hewlett Foundation and organizational assistance from the Western Cooperative for Educational Telecommunications, WCET. Participants mapped a collaborative course, involving colleges and universities from around the world, for the productive and creative use of openly shared educational resources. In advance comments, summarized in an appendix to this report, they provided insights on the potentials and complex issues involved. This report was prepared by John Witherspoon. Contents The Forum Report Introduction: Open Resources 3 Defining the Concept 3 Prospects and Issues 3 Open Educational Resources: Turning a Concept into Reality 5 Design of an Index/Database 5 Creating a Globally Viable Infrastructure 6 2003: From Concept to Operation 6 Appendix A: Overview of the MIT OpenCourseWare Initiative 7 Appendix B: Summary of Forum Participants’ Preliminary Papers 11 Appendix C: Participants and Organizational Representatives 15 2 Introduction: Open Resources In spring 2001 the Massachusetts Institute of Technology announced that over a half- dozen years the substance of virtually all its courses would be posted on the Web, available for use by faculty members and students around the world, at no charge.1 Just over a year later – before material from its first course was online – MIT’s OpenCourseWare concept became the focus of a new international community. This emerging consortium was organized to evaluate, adapt, use, and develop open resources for its members’ many cultures and diverse languages. -

The Opencourseware Story: New England Roots, Global Reach
08-NEB-117 NEJHE Summer 2008_Back 7/9/08 3:36 PM Page 30 FORUM: GOING DIGITAL The OpenCourseWare Story: New England Roots, Global Reach STEPHEN CARSON consortium, universities from Japan, thinking and a commitment to n April, representatives of more than 200 universities from around Spain, Korea, France, Turkey, Vietnam, addressing global challenges can the world gathered in Dalian, China, the Netherlands, the United Kingdom, produce remarkable results. I the United States — plus dozens from to move forward their efforts to create MIT OpenCourseWare a global body of freely accessible course China — have already published the materials from over 6,200 courses. The OpenCourseWare movement materials spanning both cultures and has its roots in New England. The In a world of increasingly restrictive disciplines. These institutions have concept emerged in 2000 at intellectual property laws and intensi- committed to freely and openly sharing Massachusetts Institute of Technology on the Web the core teaching materials fying competition to provide for-profit where then-President Charles Vest — including syllabi, lecture notes, Web services, this movement stands charged a faculty committee with assignments and exams — from the in stark contrast to prevailing trends. answering two questions: “How is the courses they offer to their enrolled The story of this OpenCourseWare Internet going to change education?” students. Through the OpenCourseWare movement illustrates how novel and “What should MIT do about it?” A Culture of Shared Knowledge Developing a Strategy for Low-Cost Textbook Alternatives JUDY BAKER he open educational resources (OER) movement them available for use by community college students encourages the creation and sharing of free, open- and faculty. -
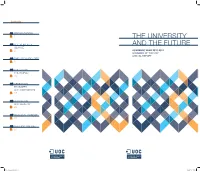
The University and the Future
Contents PRESENTATION 1 THE UNIVERSITY THE YEAR AT A AND THE FUTURE GLANCE 2 ACADEMIC YEAR 2010-2011 SUMMARY OF THE UOC ANNUAL REPORT THE UOC IN FIGURES 8 THE UOC IN THE WORLD 16 RESEARCH, TRANSFER AND INNOVATION 18 EDUCATION AND QUALITY 20 FINANCIAL REPORT 22 THE UOC ONLINE 24 portada okENG.indd 1 09/02/12 11:04 “OVER THE LAST ACADEMIC YEAR WE HAVE MADE EVERY EFFORT TO ENSURE THAT THE UOC IS EVEN MORE OPEN AND ACCESSIBLE, FLEXIBLE AND ADAPTABLE TO SOCIETY’S NEEDS, AND MOBILE, MULTILINGUAL AND MULTI-FORMAT IN ORDER TO BE ABLE TO RESPOND TO THE LIFESTYLES OF OUR STUDENTS.” Imma Tubella, President of the UOC rectora.uoc.edu THE UNIVERSITY AND THE FUTURE Recently, I have had the opportunity to For this reason, over the last academic present the UOC’s educational and gov- year we have made every effort to ensure ernance model at international university that the UOC is even more open and ac- forums in such diverse corners of the world cessible, fl exible and adaptable to society’s as Washington, Paris, Singapore, Qatar and needs, and mobile, multilingual and multi- Kenya to widely differing audiences from the format in order to be able to respond to the academic, scientifi c, business and govern- lifestyles of our students. ment sectors. On each occasion, I felt great pride on hearing how speakers – both those This commitment means we have to who already knew about us and those who reinvent ourselves constantly and steer our only just had – saw the UOC as a point of organisation so as to bravely navigate the reference for their online universities. -
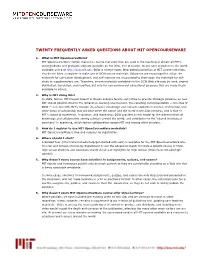
Twenty Frequently Asked Questions About Mit Opencourseware
TWENTY FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT MIT OPENCOURSEWARE 1. What is MIT OpenCourseWare? MIT OpenCourseWare (OCW) makes the course materials that are used in the teaching of almost all MIT’s undergraduate and graduate subjects available on the Web, free of charge, to any user anywhere in the world. Available online at http://ocw.mit.edu, OCW is a large-scale, Web-based publication of MIT course materials. You do not have to register to make use of OCW course materials. Educators are encouraged to utilize the materials for curriculum development, and self-learners are encouraged to draw upon the materials for self- study or supplementary use. Therefore, course materials contained on the OCW Web site may be used, copied, distributed, translated, and modified, but only for non-commercial educational purposes that are made freely available to others. 2. Why is MIT doing this? In 1999, former MIT Provost Robert A. Brown asked a faculty committee to provide strategic guidance on how MIT should position itself in the distance/e-learning environment. The resulting recommendation — the idea of OCW — is in line with MIT’s mission (to advance knowledge and educate students in science, technology, and other areas of scholarship that will best serve the nation and the world in the 21st century), and is true to MIT’s values of excellence, innovation, and leadership. OCW provides a new model for the dissemination of knowledge and collaboration among scholars around the world, and contributes to the “shared intellectual commons” in academia, which fosters collaboration across MIT and among other scholars. 3. -

Impact of Opencourseware Publication on Higher Education Participation and Student Recruitment
Impact of OpenCourseWare Publication on Higher Education Participation and Student Recruitment Stephen Carson1, Sukon Kanchanaraksa2 (not shown), Ira Gooding2, Fred Mulder3, and Robert Schuwer3 1Massachusetts Institute of Technology, US 2Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, US 3Open Universiteit, The Netherlands Abstract The free and open publication of course materials (OpenCourseWare or OCW) was initially undertaken by Massachusetts Institute of Technology (MIT) and other universities primar- ily to share educational resources among educators (Abelson, 2007). OCW, however, and more in general open educational resources (OER),1 have also provided well-documented opportunities for all learners, including the so-called “informal learners” and “independent learners” (Carson, 2005; Mulder, 2006, p. 35). Universities have also increasingly docu- mented clear benefits for specific target groups such as secondary education students and lifelong learners seeking to enter formal postsecondary education programs. In addition to benefitting learners, OCW publication has benefitted the publishing institu- tions themselves by providing recruiting advantages. Finally enrollment figures from some institutions indicate that even in the case of the free and open publication of materials from online programs, OCW does not negatively affect enrollment. This paper reviews evaluation conducted at Massachusetts Institute of Technology, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHSPH), and Open Universiteit Nederland (OUNL) concerning OCW effects on higher education participation and student recruitment. Keywords: Distance education; open learning; open universities; distance universities; higher education; e-learning; online learning 1 In this paper we will use one reference term only (OCW), just for convenience and being fully aware of the definition differences between OCW and OER. Only in the case of possible misun- derstanding we refer specifically to OER. -

Open An-Open-Web.Pdf
AN OPEN WEB Copyright : The Contributors (see back) Published : 2011-01-30 License : None Note : We offer no warranty if you follow this manual and something goes wrong. So be 1 careful! Introduction 1. The Web is Closed 2. The Future is Open 2 1. THE WEB IS CLOSED “As much as we love the open Web, we’re abandoning it.” -Chris Anderson, WIRED Magazine The Web was meant to be Everything. As the Internet as a whole assumes an increasingly commanding role as the technology of global commerce and communication, the World Wide Web from its very inception was designed to be a free and open medium through which human knowledge is created, accessed and exchanged.1 But, that Web is in danger of coming to a close. The Web was meant to be Free. It laid out a language of HyperText, which anyone could use to author electronic documents and connect them together with links. The documents in totum were meant to form a global web of information with no center and no single point of control.2 The first Web browser was also a Web editor, and this principle that any node in the network can both consume and create content has more or less been defended to this day. The Web was meant to be Open. It detailed a common interface that could be implemented on any computer. This innovation overcame the obstacles of incompatible platforms and tools for the sharing of knowledge on the Net,3 by defining a Hypertext Transfer Protocol (HTTP) and other standards for the discovery and communication of online data. -
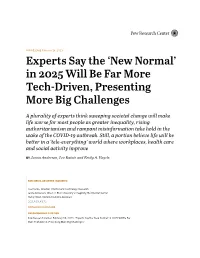
Experts Say the 'New Normal' in 2025 Will Be Far More Tech-Driven
FOR RELEASE February 18, 2021 Experts Say the ‘New Normal’ in 2025 Will Be Far More Tech-Driven, Presenting More Big Challenges A plurality of experts think sweeping societal change will make life worse for most people as greater inequality, rising authoritarianism and rampant misinformation take hold in the wake of the COVID-19 outbreak. Still, a portion believe life will be better in a ‘tele-everything’ world where workplaces, health care and social activity improve BY Janna Anderson, Lee Rainie and Emily A. Vogels FOR MEDIA OR OTHER INQUIRIES: Lee Rainie, Director, Internet and Technology Research Janna Anderson, Director, Elon University’s Imagining the Internet Center Haley Nolan, Communications Associate 202.419.4372 www.pewresearch.org RECOMMENDED CITATION Pew Research Center, February 18, 2021. “Experts Say the ‘New Normal’ in 2025 Will Be Far More Tech-Driven, Presenting More Big Challenges” 1 PEW RESEARCH CENTER About Pew Research Center Pew Research Center is a nonpartisan fact tank that informs the public about the issues, attitudes and trends shaping America and the world. It does not take policy positions. It conducts public opinion polling, demographic research, content analysis and other data-driven social science research. The Center studies U.S. politics and policy; journalism and media; internet, science and technology; religion and public life; Hispanic trends; global attitudes and trends; and U.S. social and demographic trends. All of the Center’s reports are available at www.pewresearch.org. Pew Research Center is a subsidiary of The Pew Charitable Trusts, its primary funder. For this project, Pew Research Center worked with Elon University’s Imagining the Internet Center, which helped conceive the research and collect and analyze the data. -

Open Source and Sustainability
OPEN SOURCE AND SUSTAINABILITY: THE ROLE OF UNIVERSITY Dr. Giorgio F. SIGNORINI, PhD Dipartimento di Chimica, Università di Firenze via della Lastruccia, 3 I-50019 Sesto F. (Firenze), Italy giorgio.signorini@unifi.it Abstract One important goal in sustainability is making technologies available to the maximum possi- ble number of individuals, and especially to those living in less developed areas (Goal 9 of SDG). However, the diffusion of technical knowledge is hindered by a number of factors, among which the Intellectual Property Rights (IPR) system plays a primary role. While opinions about the real effect of IPRs in stimulating and disseminating innovation differ, there is a growing number of authors arguing that a different approach may be more effective in promoting global development. The success of the Open Source (OS) model in the field of software has led analysts to speculate whether this paradigm can be extended to other fields. Key to this model are both free access to knowledge and the right to use other people’s results. After reviewing the main features of the OS model, we explore different areas where it can be profitably applied, such as hardware design and production; we finally discuss how academical in- stitutions can (and should) help diffusing the OS philosophy and practice. Widespread use of OS software, fostering of research projects aimed to use and develop OS software and hardware, the use of open education tools, and a strong commitment to open access publishing are some of the discussed examples. Keywords Open Source, Sustainable Development, University, Open Education, Open Access arXiv:1910.06073v1 [cs.CY] 8 Oct 2019 1 Introduction What is sustainability about? According to the widely accepted definition of the Brundtland Report (Brundtland 1987), human development is sustainable when it can satisfy the needs of the current gener- ation without compromising the ability of future generations to do the same. -
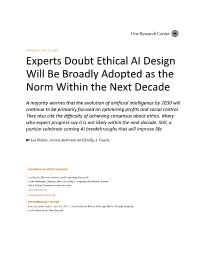
Experts Doubt Ethical AI Design Will Be Broadly Adopted As the Norm Within the Next Decade
FOR RELEASE June 16, 2021 Experts Doubt Ethical AI Design Will Be Broadly Adopted as the Norm Within the Next Decade A majority worries that the evolution of artificial intelligence by 2030 will continue to be primarily focused on optimizing profits and social control. They also cite the difficulty of achieving consensus about ethics. Many who expect progress say it is not likely within the next decade. Still, a portion celebrate coming AI breakthroughs that will improve life BY Lee Rainie, Janna Anderson and Emily A. Vogels FOR MEDIA OR OTHER INQUIRIES: Lee Rainie, Director, Internet and Technology Research Janna Anderson, Director, Elon University’s Imagining the Internet Center Haley Nolan, Communications Associate 202.419.4372 www.pewresearch.org RECOMMENDED CITATION Pew Research Center, June 16, 2021. “Experts Doubt Ethical AI Design Will Be Broadly Adopted as the Norm in the Next Decade” 1 PEW RESEARCH CENTER About Pew Research Center Pew Research Center is a nonpartisan fact tank that informs the public about the issues, attitudes and trends shaping America and the world. It does not take policy positions. It conducts public opinion polling, demographic research, content analysis and other data-driven social science research. The Center studies U.S. politics and policy; journalism and media; internet, science and technology; religion and public life; Hispanic trends; global attitudes and trends; and U.S. social and demographic trends. All of the center’s reports are available at www.pewresearch.org. Pew Research Center is a subsidiary of The Pew Charitable Trusts, its primary funder. For this project, Pew Research Center worked with Elon University’s Imagining the Internet Center, which helped conceive the research and collect and analyze the data.