Nahverkehrsplan Der Stadt Leipzig
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Der Tag, Als Die Sonne Verschwand Solch Einen Andrang Hatte Das Astronomische Zentrum Breiten Als Partielle Finsternis Präsentierte (Kleines Foto)
05 / 2015 | 24. Jahrgang Fotos: Michael Strohmeyer Michael Fotos: Der Tag, als die Sonne verschwand Solch einen Andrang hatte das Astronomische Zentrum Breiten als partielle Finsternis präsentierte (kleines Foto). Der lange nicht erlebt. Hunderte Neugierige aus der gesamten Besuch des Astro-Zentrums war eine gute Idee, denn der Region und aus den Schkeuditzer Schulen waren gekom- Freundeskreis Planetarium hatte auf dem Gelände mehrere men, um am Tag des Frühlingsanfangs ein besonderes Teleskope aufgestellt. So konnte das zweieinhalb Stunden Naturschauspiel aus „nächster Nähe“ zu erleben: eine totale dauernde Spektakel unter fachkundiger Erläuterung bestens Sonnenfinsternis auf der Nordhalbkugel, die sich in unseren beobachtet werden. Nächster Termin: September 2081! Ansiedlung Ablehnung Anerkennung Anpflanzung Stadtrat schafft Voraussetzun- Schkeuditz stemmt sich Feuerwehrleute auf der Fünfte Baumpflanzaktion der gen für weiteres Gewerbe im gegen nächtliche Triebwerks- Jahreshauptversammlung Auenwald-Apotheke gilt alter Norden Probeläufe im Freien befördert Streuobstwiese S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 2 | Schkeuditzer Bote Von Sperrmüllfrust und Standortlust Liebe Schkeuditzerinnen und gemeinsam von den Industrie- faktoren heute auf eine bessere Schkeuditzer, und Handelskammern Leipzig Zufriedenheitsbewertung ver- und Halle-Dessau sowie den weisen. Verschlechtert hat sich diese Seite im Boten nutze ich, Handwerkskammern zu Leip- die Zufriedenheitsbewertung um Informationen mitzuteilen, zig und Halle (Saale) zum zur Breitbandanbindung und Entwicklungen oder wichtige Thema: „Standortzufriedenheit zur Verfügbarkeit von Hoch- Entscheidungen vorzustellen, in Mitteldeutschland – eine schulabsolventen und Fachar- die alle Haushalte in Schkeu- Unternehmensbefragung“ er- beiten / Meistern. Sie finden die ditz erreichen sollen. So führte stellt wurde. Wie attraktiv eine Studie zum Nachlesen auf der ich im Februar zum Prob- Wirtschaftsregion ist, bemisst Homepage der Stadt. -

Espen Sponsrship 2008
Tearing down barriers – METABOLISM NUTRITION AND CLINICAL SOCIETY FOR THE EUROPEAN nutrition brings people together LEIPZIG, GERMANY LEIPZIG, GERMANY Preliminary Programme Clinical Nutrition&Metabolism 31 August-3September2013 31 ESPEN Congress on www.espen.org Michael Fischer TABLE OF CONTENTS Welcome Message Abstracts Dates & Deadlines ESPEN Awards Venue & Contacts Registration Congress Venue Procedures Organising Secretariat Registration Fees Other Contacts LLL Courses Fees Payment Committees Other Registration Guidelines ESPEN 2013 Central ESPEN Accommodation Accommodation Information Preliminary Programme List of Hotels Main Topics of ESPEN 2013 Time Schedule Congress Information Programme Overview Social Events & Excursions Programme Day by Day General Information LLL Courses What are the LLL Courses? Access & Transportation Overview Detailed LLL Courses Programme Sponsoring & Exhibition LLL Courses Registration Fees 2 WELCOME MESSAGE Dear Colleagues, On behalf of the Local Organising Committee and the German Society for Clinical Nutrition (DGEM) we would like to invite you to the 35th ESPEN Congress 2013 held for the second time in Leipzig. Some of you may have already participated at the 10th Congress in Leipzig in 1988. Since then Europe has changed tremendously. 25 years on, we are grateful to have the opportunity once again to host the ESPEN Congress in Leipzig and to share with you this “wind of change”. The city of Leipzig in the former GDR was the origin of the peaceful revolution in 1989, which was the beginning of “Freiheit” (freedom) and the reunification of Germany. This historical background creates the theme for the Congress: “Tearing down barriers – nutrition brings people together”. You can expect an interesting, broad and open-minded programme, offering both updated and cutting-edge science, as well as clinical practice. -
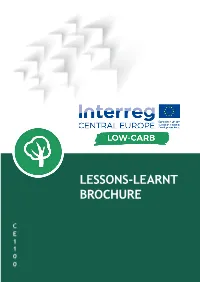
LOW-CARB Lessons Learnt Brochure
LESSONS-LEARNT BROCHURE C E 1 1 0 0 IMPRINT About the project LOW-CARB – Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas 1aimed CONTENTS at enhancing capacities for integrated low-carbon mobility planning for functional urban areas (FUAs). To achieve this, the project tackled the most important aspects of sustainable urban mobility planning (SUMP) What is LOW-CARB about? .............................................................................. 5 and looked at how these can be adapted to the realities of the functional urban area: integrated coordina- tion, institutional cooperation, and action plan implementation, including joint financing and public invest- What the partners achieved in their Functional Urban Areas and what they learnt .......... 6 ments in low-carbon mobility systems in challenging times. Clean public transport services together with FUA Leipzig (Germany): Achieve low-carbon workplace mobility to a remote district ----------6 new combined mobility offers, like sharing services or multimodal information services, were placed at the FUA Brno (Czech Republic) – Increase the (high) share of low-carbon modes usage in the FUA 9 core of the planning process. FUA Koprivnica (Croatia): Create one single public transport zone in the FUA ----------------- 11 FUA Szeged (Hungary): Understand mobility needs and tailor the Pt offer accordingly ------- 13 Project Number CE1100 LOW-CARB - Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas FUA Parma (Italy): -

Discover Leipzig by Sustainable Transport
WWW.GERMAN-SUSTAINABLE-MOBILITY.DE Discover Leipzig by Sustainable Transport THE SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT GUIDE GERMANY The German Partnership for Sustainable Mobility (GPSM) The German Partnership for Sustainable Mobility (GPSM) serves as a guide for sustainable mobility and green logistics solutions from Germany. As a platform for exchanging knowledge, expertise and experiences, GPSM supports the transformation towards sustainability worldwide. It serves as a network of information from academia, businesses, civil society and associations. The GPSM supports the implementation of sustainable mobility and green logistics solutions in a comprehensive manner. In cooperation with various stakeholders from economic, scientific and societal backgrounds, the broad range of possible concepts, measures and technologies in the transport sector can be explored and prepared for implementation. The GPSM is a reliable and inspiring network that offers access to expert knowledge, as well as networking formats. The GPSM is comprised of more than 140 reputable stakeholders in Germany. The GPSM is part of Germany’s aspiration to be a trailblazer in progressive climate policy, and in follow-up to the Rio+20 process, to lead other international forums on sustainable development as well as in European integration. Integrity and respect are core principles of our partnership values and mission. The transferability of concepts and ideas hinges upon respecting local and regional diversity, skillsets and experien- ces, as well as acknowledging their unique constraints. www.german-sustainable-mobility.de Discover Leipzig by Sustainable Transport Discover Leipzig 3 ABOUT THE AUTHORS: Mathias Merforth Mathias Merforth is a transport economist working for the Transport Policy Advisory Services team at GIZ in Germany since 2013. -

Ärzteblatt Sachsen 1/2003 27
Personalien Unsere Jubilare im Februar 2003 Wir gratulieren 60 Jahre 65 Jahre 75 Jahre 01. 02. Dr. med. Dalitz, Ute 01. 02. Becker, Peter 03. 02. Dr. med. Eysold, Regina 01324 Dresden 02625 Bautzen 01237 Dresden 01. 02. Prof. Dr. med. habil. Gräfe, Gerd 01. 02. Brosz, Helga 03. 02. Wild, Armin 04159 Leipzig 09633 Tuttendorf 08468 Reichenbach 01. 02. Dr. med. Reißmann, Gisela 01. 02. Prof. Dr. med. habil. Skrzypczak, Jörg 04. 02. Dr. med. Kleint, Wolfgang 01468 Reichenberg 04157 Leipzig 01277 Dresden 01. 02. Tomesch, Bärbel 05. 02. Prof. Dr. sc. med. Reißig, Dieter 08. 02. Dr. med. Meißner, Joachim 08427 Fraureuth 04315 Leipzig 01189 Dresden 02. 02. Dr. med. Ackermann, Rolf 05. 02. Dr. med. Riemer, Wolfgang 09. 02. Dr. med. Mirtschink, Maria 04808 Wurzen 04425 Taucha 04129 Leipzig 02. 02. Dr. med. Löffelmann, Horst 06. 02. Dr. med. Bildat, Dieter 14. 02. Dr. med. Richter, Walter 08412 Werdau 04435 Schkeuditz 01477 Arnsdorf 03. 02. Dieck, Wolfgang 06. 02. Hebenstreit, Ingrid 23. 02. Dr. med. Görner, Eberhard 01640 Coswig 01069 Dresden 04680 Zschadraß 04. 02. Dr. med. Drews, Eckehard 07. 02. Riedel, Karl 28. 02. Prof. Dr. med. habil. Göhler, Werner 04668 Grimma 04886 Arzberg 04275 Leipzig 04. 02. Dr. med. Richter, Hartmut 08. 02. Dr. med. habil. Oeser, Roland 29. 02. Dr. med. Colditz, Christa 04889 Gneisenaustadt Schildau 08321 Zschorlau 04275 Leipzig 05. 02. Kirseck, Hannelore 09. 02. Dr. med. Georgi, Peter 09126 Chemnitz 01129 Dresden 80 Jahre 05. 02. Dr. med. Kordel, Karl-Heinz 09. 02. Dr. med. Trülzsch, Barbara 24. 02. Dr. med. Kunze, Irmgard 04539 Groitzsch 01309 Dresden 08258 Wernitzgrün 06. -

Anlage 6 – Ortsteilverzeichnis
Anlage 6 Seite 1 Ortsteilverzeichnis für Tarifzonenzuordnung in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen - 01.08.2021 TZ/GZ/Stv/HAT TZ/HATZ-Ü- Ortsteil PLZ Gemeinde Landkreis Bundesland Bemerkungen Z Tarif/VMS-TZ Ablaß 04769 Mügeln, Stadt Nordsachsen SN 129 Abtlöbnitz 06618 Molauer Land Burgenlandkreis ST 256 Dreiecksiedlung, Abzw. 04451 Borsdorf Leipzig SN 629 110/168 Lindigt, Abzw. 04779 Wermsdorf Nordsachsen SN 128 Mannsdorf, Abzw. 06712 Kretzschau Burgenlandkreis ST 663 258/259 Reckwitz, Abzw. 04779 Wermsdorf Nordsachsen SN 128 Schaddel, Abzw. 04668 Grimma, Stadt Leipzig SN 144 Adelwitz 04886 Arzberg Nordsachsen SN 124 Albersdorf 04420 Markranstädt, Stadt Leipzig SN 156 Albersroda 06268 Steigra Saalekreis ST 232 Alberstedt 06279 Farnstädt Saalekreis ST 231 Albrechtshain 04683 Naunhof, Stadt Leipzig SN 147 Allerstedt 06642 Kaiserpfalz Burgenlandkreis ST 251 Almrich 06618 Naumburg (Saale), Stadt Burgenlandkreis ST 255 Almsdorf 06632 Mücheln (Geiseltal) Saalekreis ST 234 Alten (Dessau) 06847 Dessau-Roßlau, Stadt Dessau-Roßlau, Stadt ST 270 Altenbach 04828 Bennewitz Leipzig SN 141 Altenburg 04600 Stadt Altenburg Altenburger Land TH 571 322 Altengroitzsch 04539 Groitzsch, Stadt Leipzig SN 155 Altenhain 04687 Trebsen, Stadt Leipzig SN 144 Altenhof 04703 Leisnig Mittelsachsen SN 131 36 Altenroda 06647 Bad Bibra, Stadt Burgenlandkreis ST 252 Altkirchen 04626 Altkirchen Altenburger Land TH 324 Altmörbitz 04655 Kohren-Sahlis, Stadt Leipzig SN 154 Altmügeln 04769 Mügeln, Stadt Nordsachsen SN 129 Altoschatz 04758 Oschatz, Stadt Nordsachsen SN 516 -

MDV-Tarifzonenplan
Tarifzonenplan Anlage 8 Prettin Großtreben nach Könnern nach Könnern / Halberstadt nach Wieskau nach Köthen / Magdeburg nach Bad Schmiedeberg Greudnitz nach Friedeburg/Hettstedt Schlettau nach Bitterfeld / Dessau / Rosen- Aus der Anzahl der Dornitz nach Zörbig Garsena Löbejün Kösseln Lutherstadt Wittenberg / Magdeburg Dommitzsch Mockritz feld Söllichau befahrenen, zusammen- Plötz Mösthinsdorf Dahlenberg Domnitz nach Bitterfeld / Dessau / Schwemsal Durch- Johannashall Lutherstadt Wittenberg / Magdeburg Tornau wehna 122 Döbrichau hängenden Tarifzonen Petersberg Schnaditz Trossin Döbern Rothenburg Kütten nach Brehna Falkenberg Drebligar Nauendorf Kossa ergibt sich die Preisstufe Ostrau Löbnitz Bad Düben Dobis Dößel Tiefensee Authausen Vogelgesang Nehlitz Brachstedt Dammendorf 512 124 des Tickets. Neutz Wallwitz Sausedlitz Roitzschjora Görschlitz Pressel 223 Eismannsdorf 121 Elsnig Zwethau Elsterberg Beesenstedt Rumpin Badrina Gimritz Beidersee Saalekreis Pohritzsch Serbitz Laußig Neiden Wettin Teicha Schwerz Laue Wellaune Kötten Kloschwitz Lettewitz Möder- Oppin Plößnitz Niemberg 166 Eulenau Beilrode Roitzsch Weidenhain Ab 1. August 2017 Schwittersdorf au Gruna Zasch- Spicken- Reibitz Glaucha 515 witz Morl Senne- Maschwitz dorf Zschernitz Wöllnau Torgau Döblitz 224 Noitzsch Blumberg Naundorf Grube witz Braschwitz Wölls- Delitzsch Spröda Hohen- Arzberg 222 Ferdinande Petersdorf Storkwitz Rote Jahne, Pfützthal Tornau 511 Beerendorf prießnitz BSZ Graditz Prausitz Hohenthurm 163 Landkreis Nordsachsen Wildenhain H.-Trotha Halle-Center Landsberg -

Gutes Aus Haus &
WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen Richard-Wagner-Straße 7a 04509 Delitzsch T 034202 988-1050 F 03421 75885-1055 [email protected] www.wfg-nordsachsen.de Gutes aus Haus Gutes & Hof in Nordsachsen Gutes aus Haus & Hof in Nordsachsen Entdecken, Einkaufen und Genießen – Gutes aus dem Landkreis Nordsachsen Lust auf gute, frische Ware direkt vom Erzeuger um die Ecke? Dann sollte diese Broschüre Ihr ständiger Begleiter sein. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Nordsachsen hat Produkte von über 60 regionalen Herstellern, mit eigenem Hofverkauf, zusammengetragen und für Sie in dieser Broschüre übersichtlich aufbereitet. Fleisch, Fisch, Käse, Obst, Honig, Kräuter, Backwaren – und das alles von „nebenan“. Handwerklich traditionell erzeugte Lebensmittel, Frische aus der Region, hochwertige Produkte vom preisgekrönten Limou- sinrind bis hin zur köstlichen selbstgemachten Marmelade nach Großmutters Art – hier finden Sie ein reichhaltiges Angebot und lernen nebenbei kleine idyllische Läden, interessante Landwirtschaftsbetriebe, aber auch starke regionale Marken kennen. Unsere Broschüre soll für Sie ein kleiner Wegweiser sein und Ihnen zeigen, was der Landkreis Nordsachsen alles Leckeres und Feines zu bieten hat. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken, Einkaufen und Genießen ! Ihre Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nordsachsen 1 Gutes aus Haus & Hof Inhaltsverzeichnis in Nordsachsen Legende Delitzscher Land Wir haben für Sie die Angebote in den drei Regionen Delitzscher Land, Dübener Heide, Sächsisches Zweistromland/Ostelbien zusammen- Landfleischerei Zwochau GmbH S 10 gefasst, damit Sie schneller die jeweiligen Anbieter in Ihrer Nähe finden Gärtnerei Petersohn, Inh. Lutz Wulfert S 12 können. Die Angebote sind mit einheitlichen Piktogrammen zur leichteren Gemüsebau Kyhna KG S 14 Orientierung gekennzeichnet und der hauptsächliche Angebotsschwer- Marktfruchtbetrieb Heiko Fischer S 16 punkt eines Betriebes ist gesondert hervorgehoben. -

Franz Delitzsch
M F R A N Z D E L I T Z S C H El m e mo r i a l ( tr i b u te. V SAMUEL I ES CURTISS , P F E S S O R I N CH ICA T H E ICA E I N A Y R O GO OLOG L S M R . E D I N B U R G H . C L A R K 3 8 O T T , GE R GE S T REET . 1 8 9 1 . P IN T E D BY M I N A N D I R ORR SO G BB , F O R B T . 85 T . C L R K E D N U R G H . A , I N D N H AMI T N AD AM A N D C O . LO O , L O , S , D I E E H E E U N T . BL , G ORG RB R N E ‘V Y K C I N E A N D VVE L F O RD OR , S R B R . ‘ E u my $210t Qfiumm h z I N T Y A N D V S UD , RECREATION , CHRISTIAN SER ICE , P G 1 878-1 878 LEI ZI , , A A R R E N E R E Y D R PH , P R OF E S S O R C S P G G O , . , THIS SLIGHT TRIBUTE T O T H E MEMORY OF OU R BELOVED TEACHER IS DEDICAT ED AS W E CLASP H ANDS ONCE MORE V B I S G V O ER RA E . -

Leipzig 04288 Leipzig Olz Telekom-Turm Plaußig Stötteritz Häuser Lindenthal Tel
Zwe i- naundorfer S Kletzen- tr. Ochelmitz Gottschalkstr. Rackwitz 2 Zschölkau Gottscheina Schkeu- 184 Göbschelwitz ditz AlbrechtshainerRadefeld Str. Podewitz Jesewitz from L-NordK Hohenheida a 14 r Halle l - F r i Gordemitz e d r Pönitz Wollmen i Kärrnerweg c h L-Mitte Merkwitz - S Schkeuditz geW-regnirpS-drahciR t r . Branch office Kärrnerstraße 68 Station Tram 4 L-Messegelände Seegeritz Pehritzsch H 87 Leipzig 04288 Leipzig olz Telekom-Turm Plaußig Stötteritz häuser Lindenthal Tel. +49 (0)69 8062-0 K Taucha Fax +49 (0)69 8062-9827 ärr r. Str ner t . str S Pehritzsch . r E-Mail [email protected] 2 e Kärrnerstr. rf . Möckern 14 6 r Mockauo Bus Stop t Ba lsd S a Halle 13 St g 38 öt e Siedlung ter Leipzig it Gohlis w Taucha Waldfrieden ze 14 r S Leipzig 4 Böhlitz-Ehrenberg tr 9 aß r. r e St Panitzsch e Weimar Dresden - u n Erfurt Jena a L-Ost e r k i l 4 l ue ö Hohentichelnstr. 6 e ga Gera Chemnitz b M r o 72 o T Zwickau L Th.-Heuss-Str. 181 Leutzsch 6 Borsdorf Paunsdorfer Str. Engelsdorf Coming from the south and west along the A38 Lindenau Engelsdorfer Str. Brandis 87 2 Exit 'Leipzig-Südost' (direction Leipzig) – Reudnitz Mölkau Beucha M Muldentalstraße – Prager Straße (direction Sommerfelder Str. Zwei- n 186 Miltitz Plagwitz Schleußiger Weg ö aund S l orfer Str k . c Telekom city centre) – turn right across the tram track h Antonien- H a o u ön st lz- häu Turm Kleinpösna a r. -

Ärzteblatt Sachsen 1/2019
Pe RSONALIA Unsere Jubilare im Februar 2019 16.02. Dr. med. Hesse, Christian 01776 Hermsdorf 16.02. Dr. med. Schramm, Ines 04275 Leipzig Wir gratulieren! 17.02. Dr. med. Schmidt, Bernd 08340 Schwarzenberg 18.02. Dipl.-Med. Vodel, Karin 17.02. Dipl.-Med. Doerfel, Ulrich 08248 Klingenthal 65 Jahre 09648 Mittweida 19.02. Dr. med. Fiedler, Edith 19.02. Dipl.-Med. Otto, Gisa 09128 Chemnitz 01.02. Dr. med. 01324 Dresden 19.02. Prof. Dr. med. habil. Kleinschmidt, Anette 19.02. Sälzer, Joachim Hein, Werner 09212 Limbach-Oberfrohna 02956 Rietschen 04289 Leipzig 02.02. Dr. med. Fiedler, Kristine 23.02. Dr. med. Rieder, Christa-Maria 20.02. Dipl.-Med. Wobst, Frank 08056 Zwickau 04808 Wurzen 01558 Großenhain 05.02. Dr. med. Straube, Jürgen 24.02. Geisler, Annegret 21.02. Kitzbichler, Hans-Peter 01640 Coswig 02827 Görlitz 08209 Auerbach 05.02. Dr. med. Sturz, Kornelia 24.02. Dr. med. Lachmann, Peter 23.02. Strunz, Jürgen 01099 Dresden 01665 Klipphausen 08107 Hartmannsdorf 06.02. Dr. med. Schäffer, Reinhard 25.02. Dr. med. Behnert, Christine 08451 Crimmitschau 08058 Zwickau 13.02. Dr. med. Scholz, Gabor-Boris 75 Jahre 27.02. Dr. med. Ostertag, Karoline 08060 Zwickau 01187 Dresden 14.02. Dr. med. Knauer, Beate 02.02. Dr. med. Huhle, Monika 27.02. Schleif, Christine 04277 Leipzig 01219 Dresden 04159 Leipzig 25.02. Dr. med. Schubert, Sonja 02.02. Kanig, Erdmuthe 28.02. Dr. med. Gneuß, Hannelore 04288 Leipzig 02625 Bautzen 08485 Lengenfeld 26.02. Dipl.-Med. Janicki, Christiane 02.02. Schindler, Eckard 28.02. Dr. med. Seifert, Werner 08064 Zwickau 01326 Dresden 02827 Görlitz 26.02. -

Schießstände in Sachsen - Tabelle 1 - Kontakte
Schießstände in Sachsen - Tabelle 1 - Kontakte Kontakt Ansprech- Landkreis Nr. Ort: Schießanlage Betreiber Adresse Telefonnr. Homepage Öffnungszeiten partner Fabrikstraße 4, Chemnitz / Schießstand 09228 0372000/88316 / Chemnitz (Stadt) 1 Irmscher nicht verfügbar k.A. Wittgensdorf Wittgensdorf Chemnitz/OT 0162/8117280 Wittgensdorf Schießstand Dresdner Militär- Langebrücker Dresden www.bdmp- Dresden (Stadt) 2 Dresden - und Polizeischützen Jürgen Gessner Straße 10, 0351/8805170 siehe homepage Langebrück dresden.de Klotzsche 1992 e.V. 01109 Dresden Annaberger Priv. Privilegierter 037348/22483 + Oberwiesen- Schießstand Straße 81, Erzgebirgskreis 3 Schützenverein zu Peter Riedel 7225 bzw. 037348 nicht verfügbar nach Absprache thal Oberwiesen-thal 09484 Kurort Wiesenthal e.V. 7225 Oberwiesenthal Damaschke- Schießsport- Greifensteiner Wiesa / Günter Brett- straße 31, 09427 www.greifenstei Erzgebirgskreis 4 anlage Schützen- und 037341/3363 siehe homepage Schönfeld schneider Ehrenfrieders- nschuetzen.de Schönfeld Jägerverein e.V. dorf Talstraße 7, OT Mi:17-21Uhr, Sa: 10 - Schießstand Wiesenbad / 1. Schützenverein Wiesa, 09488 03733 / 5 8120, www.hoffmann- 12 und 15 -17 Uhr Erzgebirgskreis 5 „Am Thomas Schiefer Wiesa zu Wiesa Thermalbad 037343/2235 stargard.de/svw/ nach Anmeldung für Christfelsen“ Wiesenbad Nichtmitglieder Talstraße 2, Jöhstadt / SV Schützenhof 099477 www.schuetzenh nach Anmeldung, Mo, Erzgebirgskreis 6 Oberschmiede Preßnitztal/Mittelsch Lars Wendler 037343/2047 Preßnitztal Oberschmiede- of-erzgebirge.de Di Ruhetag berg miedeberg berg Mildenauer 03733 / 54110 Ulrich Dorfstr. 220b Erzgebirgskreis 7 Mildenau Schützenverein oder nicht verfügbar k.A. Buschmann 09456 Mildenau 1656 e.V. 03733/22208 Turnvater-Jahn- Schlettauer Str: 12, 09456 Erzgebirgskreis 8 Annaberg Thomas Müller 03733-25777 nicht verfügbar k.A. Schützenverein e.V. Annaberg Buchholz Kontakt Ansprech- Landkreis Nr. Ort: Schießanlage Betreiber Adresse Telefonnr.