Erfolgreiche Motorenforschung in Graz Rudolf Pischinger Donnerstag, 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mission Innovation Austria 3 Contents
Logo Vektor Blau CMYK 64 0 0 0 Grün CMYK 50 0 100 0 AUSTRIA’S WAY INTO THE FUTURE OF ENERGY OFStrategies ENERGY and Success Stories MISSION INNOVATION AUSTRIA 3 CONTENTS PREFACE ..............................................................................................................................................................................Page 4 STRATEGIES AND ACTIVITIES Mission Innovation – Clean energy technologies to combat climate change .................................................... Page 8 #Mission 2030 – Austrian Climate and Energy Strategy ........................................................................................ Page 9 Positive Market Developments – Energy technologies made in Austria ........................................................... Page 10 Innovation for the Future of Energy – Research & technological development in Austria ........................... Page 12 Mission Innovation Challenges ..................................................................................................................................... Page 14 Mission Innovation Austria – R&D programmes and activities in Austria ......................................................... Page 15 Flagship Region Energy – Innovative solutions in real-life operation................................................................. Page 16 Energy Research – New options for the energy transition ................................................................................... Page 18 City of Tomorrow – Solutions for urban living -
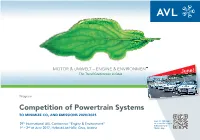
Competition of Powertrain Systems
MOTOR & UMWELT – ENGINE & ENVIRONMENT The Trend Conference in Graz June! TOPTOP LEVELLEVEL SPEAKERSSPEAKERS TESTTEST DRIVESDRIVES Program Competition of Powertrain Systems TO MINIMIZE CO2 AND EMISSIONS 2020/2025 Scan the QR Code 29th International AVL Conference “Engine & Environment“ to access the “Engine & Environment“ st nd 1 – 2 of June 2017, Helmut-List-Halle, Graz, Austria Mobile App. FOREWORD The development of powertrains is currently in a phase of diesel engine play? Particularly when the well-to-wheel method enormous change. Electric vehicles have been announced for is applied to electric hydrogen to drive fuel cell vehicles? some time, but now several OEMs are planning market shares Do plug-in hybrids still make sense if electricity is not counted up to 25 % within 10 years. Hence the focus of development as having a zero CO2 contribution? Is the 48 Volt route perhaps must be shifted NOW: The competition of powertrain systems the better choice for hybrids? Will there still be many add-on is intensifying. hybrid transmissions or only DHTs (Dedicated Hybrid Transmis- sions)? What does the transmission of the future even look like? Does the combustion engine still have a future in this scenario? Will it lose ground or will it be able to assert itself by implement- The conference will cover and discuss the competitive ing new technologies and highly efficient exhaust gas aftertreat- approaches on a system level and the technical solutions ment systems together with e-fuel or bio-fuel? What role will the for such concepts. Prof. Dr. h.c. Helmut List Dr. Robert Fischer Chairman and CEO Executive Vice President, Engineering and Technology AVL List GmbH Powertrain Systems , AVL List GmbH / 2 CONTENTS GENERAL INFORMATION 2 Foreword Conference Office: AVL List GmbH, Additional conference documents are also Hans-List-Platz 1, A-8020 Graz, available at the registration desk. -

Auf Den Seiten Des CDHK
Willkommen auf den Seiten des CDHK Kontakt Suche A-Z CDHK Newsletter Ihre E-mail Adresse: Nachrichten Bayer-Stiftungslehrstuhl für IPR eingerichtet 2005-07-01 Anja Feldmann Abonnieren Die Bayer AG richtet am Chinesisch-Deutschen Abbestellen Hochschulkolleg einen Stiftungslehrstuhl im Bereich Wirtschaftsrecht ein. Der Lehrstuhl werde sich thematisch mit dem Recht des Links Geistigen Eigentums auseinandersetzen, sagte Bayer-Vorstandsmitglied Dr. Udo Oels bei der Vertragsunterzeichnung am 1. Juli in Shanghai. Tongji-Präsident Prof. Dr. Wan Gang mit Bayer-Vorstand zum Artikel... Dr. Udo Oels bei der Unterzeichnung des Stiftungslehrstuhls Foto: CDHK Bayer-Stiftungslehrstuhl für IPR eingerichtet Neue Ausgabe des CDHK-Newsletters IDS Scheer AG diskutiert mit CDHK-Wirtschaftsinformatik Olympischer Geist weht an der Tongji Wechsel in der CDHK-Spitze Mehr... Termine TestDaf-Intensivkurs 12. September 2005 CDF-Lesung mit Zdenka Becker 18. Mai 2005 10 Uhr Lesung mit Carsten Otte 1. Juni 2005 10 Uhr Vortrag: Hochschullandschaft und Hochschulreform in Deutschland 11. April 2005 15:00 Uhr CDF-Vortrag: Deutsche Klangkunst und ihre Einfluesse aus Asien 14. April 2005 19.00 Uhr Blockvorlesung Physical Electronics 04. April 2005 bis 08. April Lesung Antje R. Strubel und Anne C. Voorhoeve 15. April 2005 10 Uhr NEUER TERMIN - CDF-Vortrag Rechtswissenschaft an Hochschulen 8. April 2005 17 Uhr Vortrag von Nobelpreisträger Reinhard Selten - Beschränkte Rationalität 8. März 2005 und Wirtschaft Wanderausstellung "30 Jahre Deutschland in den Vereinten Nationen" 22. März bis 8. April Mehr... [Zurück] [Impressum] © Chinesisch-Deutsches Hochschulkolleg 1998-2004 [Nach Oben] http://cdhk.tongji.edu.cn/de/index.php07.07.2005 14:45:39 Willkommen auf den Seiten des CDHK Nachrichten Kontakt Suche A-Z CDHK Newsletter Ihre E-mail Adresse: Bayer-Stiftungslehrstuhl für IPR eingerichtet 2005-07-01 Anja Feldmann Druckversion Abonnieren Die Bayer AG richtet am Chinesisch-Deutschen Abbestellen Hochschulkolleg einen Stiftungslehrstuhl im Bereich Wirtschaftsrecht ein. -

40Th International Vienna Motor Symposium May 15 to 17, 2019
40. Internationales Wiener Motorensymposium 15. bis 17. Mai 2019 40th International Vienna Motor Symposium May 15 to 17, 2019 Von/By Bernhard Geringer & Hans Peter Lenz MTZextra MTZ Motortechnische Zeitschrift 80 (2019), Nr. 9 | Springer Vieweg | Wiesbaden | Germany Wiener Motorensymposium JUBILÄUM Wiener MotorensYMPosium Prof. Hans Peter Lenz und Prof. Bernhard Geringer (© ÖVK) 40 Jahre Internationales Wiener Motorensymposium AUTOREN In den vergangenen vierzig Wiener Motorensymposien spiegelt sich nicht nur die technische Entwicklung des Verbrennungsmotors wider – die Symposien sind auch ein Spiegel für gesellschaftliche, politische und insbesondere ökologische Entwicklungen. Brig. Prof. Dipl.-Ing. Günter Hohl stellvertretender Vorsitzender des ÖVK, Wien, Österreich MOTORENSYMPOSIEN Das 1. Symposium, BILD 1, fand am 25. Januar 1979 statt und trug den Die Internationalen Wiener Motoren Titel „Kraftfahrzeug und Umwelt”. symposien beginnen mit einer Veran Es beschäftigte sich thematisch mit staltung, die bereits als Symposium der zukünftigen Abgas verringerung. bezeichnet wurde. Die Beinamen Assoc. Prof. Dr. Peter Hofmann Vorstandsmitglied des ÖVK, „Wiener“ und „International“ kamen GRÜNDER PROFESSOR LENZ Wien, Österreich erst später hinzu. Das damalige Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Gründer und treibende Kraft der Wiener Kraftfahrwesen der TU Wien mit dem Moto rensymposien war Prof. Lenz. Diese Vorstand Prof. Hans Peter Lenz trat als erste Veran staltung besuchten legendäre Veranstalter auf. Präsentiert wurden For Vertreter der automo tiven Forschung wie zweites Symposium ausgerichtet wurde. schungsergebnisse des Instituts, aus dem Prof. Robert Eberan von Eberhorst, Neben den Präsentationen des eigenen das heutige Institut für Fahrzeugantriebe Vor gänger von Prof. Lenz an der TU Instituts waren bereits Vortragende aus und Automobiltechnik (IFA) hervorging. Wien, und Prof. Dr. Dr. h.c. -

Inhaltsverzeichnis
Österreichische Universitäten - Pressespiegel Inhaltsverzeichnis Wer bestimmt den Holzmarkt? Seite 3 Holzkurier vom 23.01.2020 (Seite 17) Die Ö1 KinderuniWas bedeutet der Klimawandel für Tiere und Pflanzen?Gestaltung: Seite 5 Ruth Hutsteiner tvbutler.at vom 23.01.2020 Ein Wald mit Migranten Seite 6 wienerzeitung.at vom 23.01.2020 17.55 BETRIFFT: GESCHICHTE Seite 10 Wiener Zeitung vom 23.01.2020 (Seite 26) Ein Wald mit Migranten Seite 11 Wiener Zeitung vom 23.01.2020 (Seite 15-16) Umweltministerin Leonore Gewessler präsentiert „Highlights der Bioenergieforschung Seite 15 2020" ots.at vom 22.01.2020 Einladung zur Podiumsdiskussion Africa-Uninet: Vision einer gemeinsamen, Seite 17 nachhaltigen Zukunft ots.at vom 22.01.2020 10 Jahre neue Therme Wien Seite 19 ots.at vom 22.01.2020 Einladung zur Pressekonferenz zum Projektabschluss des Förderprojektes Seite 22 Keytech4EV ots.at vom 22.01.2020 10 Jahre neue Therme Wien Seite 23 gutentag.news vom 22.01.2020 Austro Vin Tulln 2020 Seite 25 meinbezirk.at vom 22.01.2020 10 Jahre neue Therme Wien Seite 27 wirtschaftszeit.at vom 22.01.2020 Umweltministerin Leonore Gewessler präsentiert „Highlights der Bioenergieforschung Seite 29 2020″ brandaktuell.at vom 22.01.2020 Einladung zur Podiumsdiskussion Africa-Uninet: Vision einer gemeinsamen, Seite 31 nachhaltigen Zukunft brandaktuell.at vom 22.01.2020 10 Jahre neue Therme Wien Seite 33 brandaktuell.at vom 22.01.2020 Einladung zur Pressekonferenz zum Projektabschluss des Förderprojektes Seite 35 Keytech4EV brandaktuell.at vom 22.01.2020 Umweltministerin -
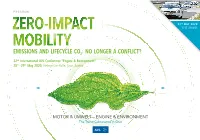
Emissions and Lifecycle Co2: No Longer a Conflict?
PROGRAM 27th MAY 2020 TEST DRIVES EMISSIONS AND LIFECYCLE CO2: NO LONGER A CONFLICT? 32nd International AVL Conference “Engine & Environment” 28th – 29th May 2020, Helmut-List-Halle, Graz, Austria MOTOR & UMWELT – ENGINE & ENVIRONMENT The Trend Conference in Graz FOREWORD 2019 saw a global decline in the sales of passenger cars and more to buy a diesel engine that contributes significantly to the reluctance to purchase can be explained by a certain sense CO2 reduction? Should vehicle development then indeed of uncertainty on the part of the buyers. As vehicles are usually focus on electric vehicles or do manufacturers have to invest kept by the same owner for a longer period of time, the buying in combustion engine development once more? Which role decision has long-term consequences. Under such conditions, will the different hybrid concepts play and will the fuel cell in it is an almost impossible task for vehicle buyers to take the particular meet its high expectations? Furthermore, will legisla- boundary conditions into account for many years in advance. tion allow CO2 trading in the automobile industry in order to accelerate e-fuel development? This uncertainty, however, also affects vehicle manufacturers. Will enough customers be willing to buy electric vehicles? If The conference offers its participants a suitable setting for an yes, at what price? Or will more customers be convinced once exchange concerning these questions. Prof. Dr. h.c. Helmut List Prof. Dr. Robert Fischer Chairman and CEO Executive Vice President, Engineering and AVL List GmbH Technology Powertrain Systems, AVL List GmbH 2 CONTENTS GENERAL INFORMATION 2 Foreword Conference Office: AVL List GmbH, Conference Documents: An order form for Hans-List-Platz 1, A-8020 Graz additional conference documents is available 3 General Information Tel.: +43 (316) 787 927 online and at the registration desk. -

Oktober 2001: 100 Jahre Promotionsrecht an Technischen Universitäten S
Ausgabe 2 - Oktober 2001: 100 Jahre Promotionsrecht an Technischen Universitäten S. 2 — Aktuelle Entwicklungen an der Fakultät S. 3 — Kurznachrichten S. 12 — Ehrendoktorat der TU Graz für einen Pionier der Biomedizinischen Technik S. 13 Impressum Medieninhaber: Technische Univer- sität Graz, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Kopernikus- gasse 24, A-8010 Graz Herausgeber: Projektgruppe e2i Erscheinungsweise: 3x jährlich Redaktion: DI Mag. Wolfgang Wallner Anzeigenkontakt: Mag. Gerda Petjak Layout und Satz: Dr. Ronald Chemelli Auflage: 5000 Redaktionsadresse: Krenngasse 37/5, A-8010 Graz, Tel.: (+43) 316/873-7925 Fax: (+43) 316/873-7924 Journal der Fakultät für Elektrotechnik und E-Mail: [email protected] Verlagspostamt: A-8010 Graz Informationstechnik an der TU Graz P.b.b. „Wir treten an!“ Antrittsvorlesungen von vier Professoren der Fakultät In nicht einmal zwei Studienjahren konn- Prof. Fickert wurde am sub auspiciis praesidentis Herr Prof. Fickert hat sich für die Reihenfolge – wie bereits ten an der Fakultät vier neue Ordinarien 13.01.1949 in Kemnade (BRD) abschloss. seine Antrittsvorlesung fol- erwähnt – nach dem Datum ihren Dienst antreten - Grund genug für geboren. gendes Thema gewählt: der Berufung richtet: Seine beruflichen Stationen einen öffentlichen Auftakt im Hörsaal i3. Nach dem Besuch des huma- waren nach der TU Wien die „Elektrischer Strom: Systeme Prof. Brasseur wurde am Im Folgenden Auszüge aus der Anspra- nistischen Gymnasiums stu- ELIN-UNION, die BBC und – Sicherheit/Schutz – Zuver- 27.01.1953 in Wien geboren. che von Dekan Prof. Dr. Rentmeister. dierte er Elektrotechnik an die Fa. WIENSTROM. lässigkeit in Theorie und der Technischen Hochschule Praxis“. Auch er studierte an der Tech- Wien, wo er im Jahre 1976 Am 01.10.1998 wurde Prof. -

Audio-Cds, Mankau Verlag 2014, 211 Min.) I 741.854/1-4 1
Mediathek der UB Graz Tonträger Bestandsverzeichnis Stand: 2021 Kurztitelverzeichnis. Die Volltitel sind über den Onlinekatalog UNI-KAT abfragbar Inhaltsverzeichnis 1. MEDIZIN / GESUNDHEIT 1 2. BIOLOGIE / ZOOLOGIE / UMWELT 1 3. PSYCHOLOGIE / PÄDAGOGIK / MANAGEMENT 1 4. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 3 5. GESCHICHTE / POLITIK 4 6. KUNST(GESCHICHTE) / ARCHITEKTUR 6 7. RELIGION / THEOLOGIE 6 8. SPORTWISSENSCHAFTEN 7 9. FREMDSPRACHEN-AUSBILDUNG 7 10. AUTOREN, LITERATUR / PHILOSOPHIE / KULTURWISSENSCHAFT 12 11. MUSIKWISSENSCHAFT 30 12. VERMISCHTES 32 Mediathek, Universitätsstraße 15/K2, A-8010 Graz, 2. Stock Tel.: +43/ 0316/ 380 - 1591 1. MEDIZIN / GESUNDHEIT Achtsamkeitsübungen für die klinische Praxis und den Alltag; Sprecherin: Petra Meibert (1 MP3-CD, Hogrefe Verlag 2019, 68 Min.) I 743.029 Bewährte Heilmeditationen aus dem Reich der Mitte; TCM-Box, Spracherin: V. Rendtorff (4 Audio-CDs, Mankau Verlag 2014, 211 Min.) I 741.854/1-4 1. Herzmeditation 2. Liebesmediatation 3. Fünf-Elemente-meditation 4. Heilmassagen Demenz – Schwerpunkt Aggressivität; Morderation: R.-E. Geiger u. J. Mertens, Veranstalungsreihe Forum am Hafen 2 (1 CD, Umsorgt-wohnen-Verlag 2009) I 742.307 Hüther, Gerald: Wie man sein Gehirn optimal nutzt; Originalvortrag, Workshop auf dem Kongress "Die Kraft von Imaginationen und Visionen" (2 Audio-CDs, Auditorium Netzwerk 2008, 126 Min.) I 652.939/1-2 Hüther, Gerald: Den Übergang meistern - Von der Ressourcenausnutzung zur Potenzialentwicklung; Original- Vortrag, Forum Humanum, Wisloch (1 Audio-CD, Auditorium-Netzwerk 2009, 60 Min.) I 652.942 Intuitives Reiki – geführte Meditation und Behandlung; Hörbuch mit Karin E. J. Kolland (1 Audio-CD, Hanael 2015, 70 Min.) I 742.347 Koch, Marianne; [im Gespräch mit P. Huemer] in: Im Gespräch 6 (ORF, Audio-CD-Ed. -

Hydrogen Production and Storage by Oxidation and Reduction of Iron-Based Oxygen Carriers
Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA 2018, April 16-19, 2018, Vienna, Austria Hydrogen Production and Storage by Oxidation and Reduction of Iron-based Oxygen Carriers Sebastian Bocka, Robert Zachariasa, Richard Schauperlb, Jürgen Rechbergerb, c c c a* Florian von Hofen , Gernot Voitic , Uwe Strohmeyer , Viktor Hacker a Institute for Chemical and Environmental Engineering, Graz University of Technology, Inffeldgasse 25C, 8010 Graz, Austria b AVL List GmbH, Hans List Platz 1, 8020 Graz, Austria c Rouge H2 Engineering GmbH, Reininghausstraße 13, 8020 Graz, Austria Abstract The fixed-bed chemical-looping hydrogen (CLH) process offers the possibility of decentralised small-scale hydrogen production and storage from local available renewable hydrocarbon sources like biogas. The detailed process simulation indicated the ability of converting a broad range of different bio-based feedstocks into hydrogen. Experiments for hydrogen production in a lab-scale reactor showed the ability to release high-pressurized hydrogen with up to 50 bar from the fixed-bed production system without an additional gas compression step. Hydrogen with a purity up to 99.999% was produced in the performed lab-scale experiments to meet the stringent requirements for FCEVs. Detailed process simulations for combined loading and unloading of the oxygen carrier with a typical biogas feedstock are presented. The thermodynamic analyses revealed a high influence of the reformer synthesis gas composition and also of the internal recirculation on the overall process efficiency. The previously loaded oxygen carrier is appropriate as process-integrated storage solution to cover fluctuating demands during the day i.e. for use in fuel stations. A long-term storage and distribution is possible due to the easy handling and the very high volumetric storage capacity compared to conventional tube trailer transportation. -

ABOUT AVL Passion and Results
ABOUT AVL Passion and Results. With more than 10,400 employees, AVL List GmbH is the was founded in 1948 with the headquarters in Graz, Austria. world’s largest independent company for the development, It provides industry-leading technologies and services simulation and testing of all types of powertrain systems based on the highest quality and innovation standards to (hybrid, combustion engine, transmission, electric drive, help customers reduce complexity and add value. batteries, fuel cell and control technology). The company AVL is the world’s largest independent company for the development, simulation, and testing of powertrain systems for passenger cars, commercial vehicles, construction, large engines, and their integration into the vehicle. The company has decades of experience in the development and optimization of powertrain systems for all industries. As a global technology leader, AVL provides complete and integrated development environments, measurement and test systems as well as state-of-the-art simulation methods. As a pioneer in the field of innovative solutions, such as diverse electrification strategies for powertrains, AVL is increasingly taking on new tasks in the field of autonomous driving, especially on the basis of subjective human sensations. In the competition of technologies – internal combustion engine, battery/electric drive and fuel cell – and their combinations, AVL is working intensively and with the same priorities. AVL has digitized the vehicle development process with state-of-the-art and highly scalable IT, software and technology platforms, and creates new customer solutions in the areas of big data, artificial intelligence, simulation and embedded systems in an agile and integrated development environment. -

Gemeinsam Studieren · Forschen · Gestalten 20 Jahre Chinesisch-Deutsches Hochschulkolleg (CDHK) 1998–2018
Gemeinsam studieren · forschen · gestalten 20 Jahre Chinesisch-Deutsches Hochschulkolleg (CDHK) 1998–2018 同舟共济二十载 再铸辉煌展未来 1998–2018 同济大学中德学院 2 KAPITELBEZEICHNUNG | 文件夹 序文 3 Inhalt | 目录 Vorwort der Herausgeber | 编者前言 . 7. Grußworte | 贺辞 . 9. Die TU München als Partnerin des CDHK | 慕尼黑工业大学作为中德学院的合作伙伴 . 132. Die RU Bochum als Partnerin des CDHK | 波鸿鲁尔大学作为中德学院的合作伙伴 . 136 Die Geschichte des CDHK | 中德学院历程 . 31 Die TU Braunschweig als Partnerin des CDHK | 布伦瑞克工业大学作为中德学院的合作伙伴 . 140. Eine Chronologie des CDHK | 中德学院大事记 . 32. Die TU Berlin als Partnerin des CDHK | 柏林工业大学作为中德学院的合作伙伴 . 144. Die Pioniere | 先锋开拓者 . 48 Die TU Darmstadt als Partnerin der Tongji-Universität | 达姆施塔特工业大学作为同济大学的合作伙伴 . 148 Das CDHK heute | 今天的中德学院 . 73. Das KIT als Partner der Tongji-Universität | 卡尔斯鲁厄理工学院作为同济大学的合作伙伴 . 150 Die Fachkoordinatoren und Fachbetreuer des CDHK | 中德学院专业协调人与专业导师 . 152. Ziele und Aufgaben des CDHK im Wandel der Zeit | 时代变革中的中德学院:目标与任务 . 74. Die Alumni des CDHK | 中德学院院友 . 170 Das Netzwerk der CDHK-„Stakeholder“ | 中德学院的合作网络——“股东” . 75 Das CDHK im Urteil seiner Alumni | 院友对中德学院的评价 . 174. Die Stellung des CDHK in der Tongji-Universität | 中德学院在同济大学内的定位 . 76 Das CDHK und die Partneruniversitäten | 中德学院和德国伙伴高校 . 78. Zukunftsperspektiven des CDHK | 中德学院未来展望 . 201 Das CDHK und die Wirtschaft | 中德学院与经济界 . 80 Einleitung | 引论 . 202. Die Finanzierung des CDHK | 中德学院的资金来源 . 82 1 . Aktionsrahmen für die deutsch-chinesische Zusammenarbeit | 《中德合作行动纲要:共塑创新》 . 203. Die Fakultäten des CDHK | 中德学院各系 . 83. 2 . Die Chinastrategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung | 德国联邦教育与研究部的《中国战略》 . 206. Fakultät Elektrotechnik | 电子与信息工程系 . 84 3 . Die Deutschlandstrategie des Ministry of Science and Technology (MoST) | 中国科技部的《德国战略》 . 211. Fakultät Maschinenbau | 机械工程系 . 88 4 . Strategische Ziele des DAAD für die künftige Zusammenarbeit mit der VR China | 德国学术交流中心(DAAD) Fakultät Fahrzeugtechnik | 车辆工程系 . 92. 未来与华合作战略目标 . 218 Fakultät Wirtschaftswissenschaften | 经济管理系 . -

Automobile Industry Cluster: Driving Styria Forward
Driving Styria Forward Automobile Industry Cluster: Driving Styria Forward Major Cluster Concepts: dynamic supplier/value added chain, active/emergent governance, privatized/post-1989+1992 European restructuring environment, university support/involvement, shifting markets/technologies, globally competitive industries Description Fehler! Textmarke nicht definiert. Styria, one of the nine Austrian "Bundesländer," has until recently been somewhat isolated because of the iron curtain along its southeastern border. It was also saddled with several uncompetitive state enterprises in its old industrial areas. The Automobile Cluster Styria (ACStyria) is a new and ambitious program now being carried out by the Styrian Economic Development Agency. The cluster’s development is an excellent illustration of how regional and industrial development policies can help stimulate the successful restructuring of a regional economy following Austria’s entry to the EU and the opening of Styria’s eastern borders to market competition. The exceptional governance and structure of ACStyria is likely to be its most interesting feature. Product Market Scope The newly emergent ACStyria now comprises about 100 companies with some 10,000 people working mainly in firms that directly contribute to the production of motor vehicles. Most of these firms are small and medium-size suppliers of basic materials, parts, and subassemblies to the larger original equipment manufacturers (OEMs). Large key firms, however, are additionally both generators and suppliers of high quality research and development in key technologies (e.g., internal combustion engine design, 4-wheel drive design and production, design and installation of vehicle production plants) in the international automobile market. Where only a few firms actually manufacture vehicles (Eurostar, Steyr Daimler Puch among a few others), about half of all cluster firms can be found in the field of metalworking (e.g.