20. Tätigkeitsbericht 2011/2012
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

After the Wall: the Legal Ramifications of the East German Border Guard Trials in Unified Germany Micah Goodman
Cornell International Law Journal Volume 29 Article 3 Issue 3 1996 After the Wall: The Legal Ramifications of the East German Border Guard Trials in Unified Germany Micah Goodman Follow this and additional works at: http://scholarship.law.cornell.edu/cilj Part of the Law Commons Recommended Citation Goodman, Micah (1996) "After the Wall: The Legal Ramifications of the East German Border Guard Trials in Unified Germany," Cornell International Law Journal: Vol. 29: Iss. 3, Article 3. Available at: http://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol29/iss3/3 This Note is brought to you for free and open access by Scholarship@Cornell Law: A Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Cornell International Law Journal by an authorized administrator of Scholarship@Cornell Law: A Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. NOTES After the Wall: The Legal Ramifications of the East German Border Guard Trials in Unified Germany Micah Goodman* Introduction Since the reunification of East and West Germany in 1990, the German government' has tried over fifty2 former East German soldiers for shooting and killing East German citizens who attempted to escape across the East- West German border.3 The government has also indicted a dozen high- ranking East German government officials.4 The German government charged and briefly tried Erich Honecker, the leader of the German Demo- cratic Republic (G.D.R.) from 1971 to 1989, for giving the orders to shoot escaping defectors. 5 While on guard duty at the border between the two * Associate, Rogers & Wells; J.D., Cornell Law School, 1996; B.A., Swarthmore College, 1991. -
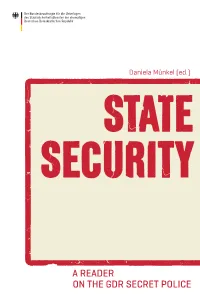
Bstu / State Security. a Reader on the GDR
Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Imprint Federal Commissioner for the Records of the State Security Service of the former German Democratic Republic Department of Education and Research 10106 Berlin [email protected] Photo editing: Heike Brusendorf, Roger Engelmann, Bernd Florath, Daniela Münkel, Christin Schwarz Layout: Pralle Sonne Originally published under title: Daniela Münkel (Hg.): Staatssicherheit. Ein Lesebuch zur DDR-Geheimpolizei. Berlin 2015 Translation: Miriamne Fields, Berlin A READER The opinions expressed in this publication reflect solely the views of the authors. Print and media use are permitted ON THE GDR SECRET POLICE only when the author and source are named and copyright law is respected. token fee: 5 euro 2nd edition, Berlin 2018 ISBN 978-3-946572-43-5 6 STATE SECURITY. A READER ON THE GDR SECRET POLICE CONTENTS 7 Contents 8 Roland Jahn 104 Arno Polzin Preface Postal Inspection, Telephone Surveillance and Signal Intelligence 10 Helge Heidemeyer The Ministry for State Security and its Relationship 113 Roger Engelmann to the SED The State Security and Criminal Justice 20 Daniela Münkel 122 Tobias Wunschik The Ministers for State Security Prisons in the GDR 29 Jens Gieseke 130 Daniela Münkel What did it Mean to be a Chekist? The State Security and the Border 40 Bernd Florath 139 Georg Herbstritt, Elke Stadelmann-Wenz The Unofficial Collaborators Work in the West 52 Christian Halbrock 152 Roger Engelmann -

Rundbrief Der SED-Diktatur
Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung Rundbrief der SED-Diktatur Januar 2021 Schleinufer 12 Tel.: 03 91 / 5 60 15 01 39104 Magdeburg Fax: 03 91 / 5 60 15 20 https://aufarbeitung.sachsen-anhalt.de E-Mail: [email protected] Tel. Geschäftszeiten: Mo---Do 9.00---15.00 Uhr; Fr 9.00---13.00 Uhr Ausführlichere Informationen sowie aktuelle Ergänzungen auf unserer Website unter „Termine‘‘ Liebe Leserin, lieber Leser, ich begrüße Sie zum Wechsel in das Jahr 2021. Wir befinden uns in einem Lockdown, mit dem wir hoffen, die Corona-Pandemie einzudämmen. Es wird ein Jahr voller Herausforderungen, deshalb freue ich mich, dass wir durch Alexander Hexel unterstützt werden, der in dem Projekt mit der Otto-von-Guericke-Universität und Prof. Frommer die Beratungsarbeit verstärkt. Er stellt sich in diesem Rundbrief vor. Im vergangenen Jahr wurden die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze entfristet und novelliert. Schon jetzt können wir feststellen, dass es einen deutlichen Anstieg an Anträgen gibt: ca. doppelt so viele Anträge zur strafrechtlichen Rehabilitierung und ca. dreimal so viele Anträge nach dem Verwaltungsrechtlichen und Beruflichen Rehabilitierungsgesetz. Die Zahlen wären bei besserer Erreichbarkeit sicher noch höher. Deshalb ist es mir an dieser Stelle wichtig mitzuteilen, dass wir unsere Arbeit ohne Unterbrechung fortführen und - auch über die Feiertage- für Beratung und Anfragen erreichbar sind. Wir werden natürlich die direkten persönlichen Kontakte reduzieren und weniger Sprechzeiten vor Ort anbieten können. Wir bemühen uns aber, die Angebote so weit wie möglich mit unserem Kooperationspartner, dem Caritas-Verband Magdeburg umzusetzen. Einige Beratungstage werden auch telefonisch angeboten. Dafür können Sie gerne Termine vereinbaren. -
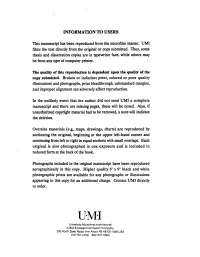
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. University Microfilms International A Bell & Howell Information Company 300 North Z eeb Road. Ann Arbor. Ml 48 1 0 6 -1 3 4 6 USA 313/761-4700 800/521-0600 Order Number 0201757 German writers and the Intermediate-range Nuclear Forces debate in the 1980s Stokes, Anne Marie, Ph.D. -

Hanns Seidel Foundation: Annual Report 2010
Hanns Seidel Foundation AnnuAl RepoRt 2010 short version english www.hss.de contentS contentS Foreword ........................................................................ 4 the Hanns Seidel Foundation: facts and figures ........................... 6 Academy for politics and current Affairs ................................... 7 the Berlin office ................................................................ 9 Institute for political education ........................................... 11 Institute for Scholarship programmes .................................... 14 liaison Bureaus/International conferences .............................. 15 office for Foreign Relations ................................................. 21 Institute for International cooperation ................................... 22 Hanns Seidel Foundation Worldwide ...................................... 28 Dr. Hanns Seidel (1901–1961) – whom the foundation is named after – was among the founding fathers of the Christian social union (CSU) in 1945 and party chairman (1955–1961). He was first elected in 1946 to the Bavarian landtag, appointed as Bavarian Minister of econo mics (1947–1954) and was the Bavarian Minister-President (1957–1960). For further information see: www.hss.de/ english/organization/hanns-seidel.html dr. Hanns seidel Hanns seidel Foundation | annual RepoRt 2010 3 FoReWord FoReWord In a year marked by spectacular resig- these sentences, spoken by Horst nations, heated debates and by the long seehofer, are just one example of the shadows cast by the -

A Comparison of Australian and German Literary Journalism
Edith Cowan University Research Online Theses: Doctorates and Masters Theses 2013 A comparison of Australian and German literary journalism Christine Boven Edith Cowan University Follow this and additional works at: https://ro.ecu.edu.au/theses Part of the Journalism Studies Commons Recommended Citation Boven, C. (2013). A comparison of Australian and German literary journalism. https://ro.ecu.edu.au/ theses/578 This Thesis is posted at Research Online. https://ro.ecu.edu.au/theses/578 Edith Cowan University Copyright Warning You may print or download ONE copy of this document for the purpose of your own research or study. The University does not authorize you to copy, communicate or otherwise make available electronically to any other person any copyright material contained on this site. You are reminded of the following: Copyright owners are entitled to take legal action against persons who infringe their copyright. A reproduction of material that is protected by copyright may be a copyright infringement. Where the reproduction of such material is done without attribution of authorship, with false attribution of authorship or the authorship is treated in a derogatory manner, this may be a breach of the author’s moral rights contained in Part IX of the Copyright Act 1968 (Cth). Courts have the power to impose a wide range of civil and criminal sanctions for infringement of copyright, infringement of moral rights and other offences under the Copyright Act 1968 (Cth). Higher penalties may apply, and higher damages may be awarded, for offences and infringements involving the conversion of material into digital or electronic form. -

The East German Revolution of 1989
The East German Revolution of 1989 A thesis submitted to the University of Manchester for the degree of Ph.D. in the Faculty of Economic and Social Studies. Gareth Dale, Department of Government, September 1999. Contents List of Tables 3 Declaration and Copyright 5 Abstract 6 Abbreviations, Acronyms, Glossary and ‘Who’s Who’ 8 Preface 12 1. Introduction 18 2. Capitalism and the States-system 21 (i) Competition and Exploitation 22 (ii) Capitalism and States 28 (iii) The Modern World 42 (iv) Political Crisis and Conflict 61 3. Expansion and Crisis of the Soviet-type Economies 71 4. East Germany: 1945 to 1975 110 5. 1975 to June 1989: Cracks Beneath the Surface 147 (i) Profitability Decline 147 (ii) Between a Rock and a Hard Place 159 (iii) Crisis of Confidence 177 (iv) Terminal Crisis: 1987-9 190 6. Scenting Opportunity, Mobilizing Protest 215 7. The Wende and the Fall of the Wall 272 8. Conclusion 313 Bibliography 322 2 List of Tables Table 2.1 Government spending as percentage of GDP; DMEs 50 Table 3.1 Consumer goods branches, USSR 75 Table 3.2 Producer and consumer goods sectors, GDR 75 Table 3.3 World industrial and trade growth 91 Table 3.4 Trade in manufactures as proportion of world output 91 Table 3.5 Foreign trade growth of USSR and six European STEs 99 Table 3.6 Joint ventures 99 Table 3.7 Net debt of USSR and six European STEs 100 Table 4.1 Crises, GDR, 1949-88 127 Table 4.2 Economic crisis, 1960-2 130 Table 4.3 East Germans’ faith in socialism 140 Table 4.4 Trade with DMEs 143 Table 5.1 Rate of accumulation 148 Table 5.2 National -
Bstu / Catalogue
ACCESS TO SECRECY EXHIBITION ON THE STASI RECORDS ARCHIVE ACCESS TO SECRECY. EXHIBITION ON THE STASI RECORDS ARCHIVE RECORDS THE STASI EXHIBITION ON SECRECY. TO ACCESS This catalogue to the permanent exhibition “Access to Secrecy” sheds light on the bureaucratic information system, working methods and everyday tasks of the Stasi. It also offers insight into the current work of the Stasi Records Archive, which preserves for future generations the files left behind by the State Security, thereby assuring that they remain accessible to the people who were personally affected by the Stasi as well as to the broader public. The following pages provide an overview of all the t opics addressed in the exhibition, from the establishment of the Stasi Records Archive to the Stasi’s extensive indexing system and the vast and varied records it left behind. Furthermore, the single case of a person directly targeted by the Stasi is presented in the catalogue and demonstrates the effects of Stasi surveillance. In addition to historical photos showing the everyday work and surveillance measures of the Stasi, the catalogue also contains reprints of original documents from the Stasi Records Archive. All the exhibition objects, most of which are presented to the public for the first time, are listed in the catalogue appendix with detailed information on the sources and picture credits. The catalogue includes a preface addressing the origins and development of the exhibition concept, an epilogue on the history of the former Stasi headquarters site where the exhibition is presented, and photos providing an impression of the construction phase of the exhibition. -

Geschichte Der Kirchlichen Jugendarbeit „Offene „Arbeit“ Jena 1970-1989
Opposition und Widerstand: Geschichte der kirchlichen Jugendarbeit „Offene „Arbeit“ Jena 1970-1989 vorgelegt von Henning Pietzsch M.A. aus Berlin Von Fakultät I – Geisteswissenschaften der Technischen Universität Berlin zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Philosophie -Dr. phil.- genehmigte Dissertation Promotionsausschuss: Vorsitzender: Prof. Dr. Werner Dahlheim Berichter: Prof. Dr. Wolfgang Benz Berichter: Priv. Doz. Siegfried Heimann Tag der wissenschaftlichen Aussprache: 11. März 2004 Berlin 2004 D 83 Henning Pietzsch , 1962 in Zeitz geboren, schloss eine Lehre als Installateur ab und leistete 1981/82 seinen Militärdienst. Pietzsch arbeitete bis zu seiner Ausreise 1988 zehn Jahre aktiv in der kirchlichen Jungen Gemeinde mit. Der zweite Bildungsweg ermöglichte ihm ein Studium der Geschichte und Politikwissenschaft, in dessen Anschluss er bis 2001 bei der Robert-Havemann-Gesellschaft Berlin arbeitete. Danach war er Stipendiat der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Berlin. Henning Pietzsch Gotenstraße 58 10829 Berlin Tel.: 030/78716245 E-Mail: [email protected] Internet: http://hometown.aol.de/hpietzsch/OffeneArbeit.html Wissenschaftliche Betreuer: Prof. Dr. Wolfgang Benz Zentrum für Antisemitismusforschung Technische Universität Berlin Ernst-Reuter-Platz 7 10587 Berlin Prof. Dr. Detlef Pollack Lehrstuhl für Vergleichende Kultursoziologie Europa-Universität-Viadrina Große Scharrnstrasse 59 15230 Frankfurt (Oder) Priv. Doz. Dr. Siegfreid Heimann Otto-Suhr-Institut Ihnestr. 26 12195 Berlin 2 Danksagung: Die vorliegende Arbeit wäre ohne die Anregungen und Hinweise von vielen Menschen kaum durchführbar gewesen. Ich danke sehr Gero Nosper (†)und meiner Mutter. Mein besonderer Dank gilt Herrn Professor Dr. Wolfgang Benz von der Technischen Universität Berlin, Herrn Professor Dr. Detlef Pollack von der Viadrina-Universität Frankfurt/Oder sowie Priv. Doz. Dr. -

Miller, Barbara (1997) the Stasi Legacy: the Case of the Inoffizielle Mitarbeiter
Miller, Barbara (1997) The Stasi legacy: the case of the Inoffizielle Mitarbeiter. PhD thesis. http://theses.gla.ac.uk/2416/ Copyright and moral rights for this thesis are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the Author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the Author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Glasgow Theses Service http://theses.gla.ac.uk/ [email protected] THE STASI LEGACY: THE CASE OF THE INOFFIZIELLE MITARBEITER Barbara Miller Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy University of Glasgow, Department of German May 1997 2 ABSTRACT The following thesis examines both the individual and the societal confrontation with one particular aspect of the legacy of the GDR's Ministerium für Staatssicherheit (MfS, or Stasi), that is the debate concerning onetime MfS informers (Inoffizielle Mitarbeiter, or IM). The thesis is divided into two main sections. Section One describes and analyses specific aspects of the IM system. Characteristics of the population of IM are examined in Chapter 1, and the ten case studies which are referred to throughout the course of the work are presented. These former IM were interviewed by the author in 1994-95, and the MfS files of eight of them were subsequently viewed. -

Gabriele Eckart
1 CURRICULUM VITAE Gabriele Eckart Address: Department of Modern Languages, Anthropology, and Geography Southeast Missouri State University One University Plaza Cape Girardeau, MO 63701 E-mail: [email protected] Education 1988-93 University of Minnesota, Minneapolis (Ph.D. in German, 1993) 1997-99 University of Texas, S.A. (M.A. in Spanish, 1999) 1978-79 Literatur-Institut Johannes R. Becher, Leipzig (diploma in creative writing, 1979) 1972-76 Humboldt Universität, Berlin (Staatsexamen in philosophy, 1976) Academic Awards 2011 Robert L. Kahn Poetry Prize, Society for Contemporary American Literature in German 2010 GRFC Grant, Southeast Missouri State University 2006 GRFC Grant, Southeast Missouri State University 2002 Outstanding Scholarship and Creative Activity Award of the College of Liberal Arts Professional Experience 2007-present Professor of German and Spanish, Southeast Missouri State University. 2003-2007 Associate Professor of German and Spanish, Southeast Missouri State University. 1999-2003 Assistant Professor of German and Spanish, Southeast Missouri State University. 1997-99 Assistant Professor of German and Spanish, St. Mary’s University. 1995-97 Assistant Professor of German and Spanish, Spring Hill College. 1994-95 Instructor of German, Spring Hill College. 1988-93 Teaching Assistant of German, University of Minnesota (Visiting Professor at University of Texas in Austin, Denison College, and Middlebury College) Languages German: native speaker. Spanish: near native fluency. English: near native fluency. Russian: reading ability. 2 French: reading ability. Affiliations Southeastern Council of Latin American Studies American Association of Teachers of German Missouri Association of Teachers of German Rocky Mountain Modern Language Association Society for Contemporary American Literature in German Wolfgang-Hilbig-Society Publications (scholarly and documentary) Books: Shifting Viewpoints: Cervantes in 20th and 21st Century Literature Written in German. -

Post-Gdr Memory—Cultural Discourses of Loss and Assertion in Reunified Germany
I POST-GDR MEMORY—CULTURAL DISCOURSES OF LOSS AND ASSERTION IN REUNIFIED GERMANY BY MOLLY REBECCA MARKIN DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in German in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2013 Urbana, Illinois Doctoral Committee: Professor Anke Pinkert, Chair Professor Mara R. Wade Professor Laurie R. Johnson Professor Yasemin Yildiz II Abstract When considering the blockage of a nuanced GDR memory within post-unification discourses, the historical moment of 1989 can be understood as a moment of loss for East Germans. While post-unification scholarship has addressed questions of GDR identity and generational memory in other post-1989 contexts, there is a surprising lack of scholarly work that discusses loss across different Eastern German generations that share the same historical moment of collapse and loss - 1989. In this dissertation, I divide the various Eastern German generational engagements with loss and assertion after 1989 into four chapters. Each generation forms a different discursive constellation: melancholic mourning: (Christa Wolf - chapter one), ambivalence (Lutz Rathenow and Thomas Brussig - chapter two), reappropriation (Jana Hensel and Jakob Hein - chapter three), and nostalgia/anti-nostalgia (Andrea Hanna Hünniger and the GDR museum - chapter four). Age and social position at the time of rupture fostered different perspectives regarding the experience of loss. My examination uses a case study approach to investigate