Download Full Text
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

BIEN - Basic Income Earth Network NEWSFLASH 57 June 2009
BIEN - Basic Income Earth Network NEWSFLASH 57 June 2009 www.basicincome.org The Basic Income Earth Network was founded in 1986 as the Basic Income European Network. It expanded its scope from Europe to the Earth in 2004. It serves as a link between individuals and groups committed to or interested in basic income, and fosters informed discussion on this topic throughout the world. The present NewsFlash has been prepared with the help of Paul Nollen, Uschi Bauer, Simon Birnbaum, David Casassas, Roland Duchâtelet, Sandro Gobetti, Dirk Jacobi, Lena Lavinas, Jim Mulvale, Rob Rainer, Dorothee Schulte-Basta, Gilles Seguin, Eduardo Matarazzo Suplicy, Benjamin Van Parys, Philippe Van Parijs, Fábio Waltenberg, Karl Widerquist, Almaz Zelleke, and Thérèse Davio. This NewsFlash can be downloaded as a PDF document on our website www.basicincome.org CONTENTS Editorial 1. Tribute to Brian Barry 2. Events 3. Glimpses of National Debates 4. Publications 5. New Links 6. About BIEN _____ BIEN NEWSFLASH 57 – June 2009 1 Editorial: Next BIEN Congress in July 2010, São Paulo, Brazil BIEN is currently preparing its next Congress, to be held on July 1st and 2nd, 2010, at the Faculty of Economics, Administration and Accounting of the University of São Paulo. Professors Lena Lavinas and Fábio Waltenberg have been appointed Executive Coordinators. They will be the focal point for four committees (funding, executive, academic, and communication), as well as the contact with BIEN's Executive Committee. An e-mail account has been created ([email protected]). There will be a detailed Call for Papers in the next issue of BIEN NewsFlash. -
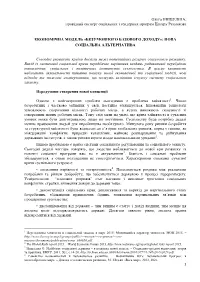
1456388199 File.Pdf
Ольга ПИЩУЛІНА, провідний експерт соціальних і гендерних програм Центру Разумкова ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ «БЕЗУМОВНОГО БАЗОВОГО ДОХОДУ»: НОВА СОЦІАЛЬНА АЛЬТЕРНАТИВА Сьогодні розвинуті країни досягли межі потенційних резервів соціального розвитку. Вихід із системної соціальної кризи передбачає вирішення завдань радикальної перебудови економічних, соціальних і політичних інститутів суспільства. В цьому контексті набувають актуальності питання пошуку нової економічної та соціальної моделі, нові підходи та можливі альтернативи, що можуть замінити існуючу систему соціального захисту. Передумови створення нової концепції Однією з найгостріших проблем сьогодення є проблема зайнятості1. Число безробітних і частково зайнятих у світі постійно збільшується. Інноваційні технології зумовлюють скорочення кількості робочих місць, а відтак виникають складності зі створенням нових робочих місць. Тому слід мати на увазі, що криза зайнятості в сучасних умовах може бути довготривалою, якщо не постійною. Суспільству буде потрібно дедалі менше працюючих людей для виробництва необхідного. Минулого року ризики безробіття та структурної зайнятості були віднесені до п‟ятірки глобальних ризиків, поряд з такими, як міждержавні конфлікти, природні катаклізми, майнове розшарування та руйнування державних інститутів, а також ризики втрати влади національними урядами2. Іншою проблемою є криза системи соціального регулювання та соціального захисту. Сьогодні дедалі частіше говорять, що людство наближається до нової ери розвитку та поточні соціальні програми вже не є актуальними3. -

Wege Zum Grundeinkommen
WEGE ZUM GRUNDEINKOMMEN Wege zum Grundeinkommen Herausgegeben von Dirk Jacobi und Wolfgang Strengmann-Kuhn Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung Mit Unterstützung durch: Dieser Sammelband erscheint im Rahmen der Bildungsarbeit des Arbeitskreises Zukunft des Sozialen des Bildungswerkes Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung. Ansprechpartnerin: Tanya Lazova (Koordination) E [email protected] Für die sprachliche Gleichstellung von Männern und Frauen gilt: Die Entscheidung über die gewählten Sprach- formen lag bei den AutorInnen. Die gewählte Sprachform ist jeweils weiblich und männlich zu verstehen. Alle Texte sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsge- setz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Bildungswerks. Das gilt insbesondere für Verviel- fältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Wege zum Grundeinkommen Herausgegeben von Dirk Jacobi und Wolfgang Strengmann-Kuhn Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung 2012 Redaktion und Koordination: Stefan Ziller und Dirk Jacobi Redaktionelle Mitarbeit: Anke Caspers, Mira Schirrmeister und Dorothee Schulte-Basta Gestaltung: Matthias Roth und Stefan Ziller (nach Entwürfen von blotto Design) Druck: agit-druck Titelgrafik: CC BY-SA 2.0. Weg von Martin Abegglen (Flickr) unter CC BY-SA 2.0. Quelle:www.flickr.com/photos/twicepix/5901746967. ISBN 978-3-927995-02-4 Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung, Kottbusser Damm 72, 10967 -

BIN REPORT N° 0
BIN REPORT n° 8 Marzo - aprile 2010 Basic Income Network Italia – Associazione Basic Income Network Italia Fondata a luglio 2008 Bin Report Coordinatore e curatore Sandro Gobetti Il presente bollettino telematico è stato preparato con la collaborazione di: Yannick Vanderborght; Bien Newsflash; Virgilio Dastoli; Andrea Fumagalli; Giuseppe Bronzini; Corrado Del Bò; Luca Santini; GianMarco Mecozzi; Giuseppe Allegri; Fausta Guarriello; Per collaborare alla realizzazione del Bin Report, vi invitiamo ad inviare contributi e notizie all'indirizzo [email protected] Per iscriversi al Bin Italia come "socio ordinario" o "sostenitore" www.bin-italia.org/iscriviti.php Per informazioni, documentazione, appuntamenti, notizie segui i continui aggiornamenti sul sito ufficiale del Bin Italia www.bin-italia.org Archivio dei Bin Report precedenti su: www.bin-italia.org/bin_report.php 1 Associazione Basic Income Network Italia - 2008 Sommario Bin Report N° 8 Marzo - aprile 2010 NAZIONALE: Cosenza 3 marzo: casa e reddito per tutti. Bolzano 4 marzo: reddito per tutti. Rimini 5 marzo: Yes we cash night. Milano 8 marzo: reddito di esistenza o lavoro di cittadinanza? Milano 10 marzo: lavoro o reddito per tutti? Roma 10 marzo: “Win for Rights – Welfare for Life”. Roma 16 marzo: teoria economica, postfordismo e reddito di cittadinanza. Pavia 17 marzo: reddito per tutti un’utopia concreta. Pisa 19 marzo: crisi, reddito e trasformazioni produttive. Torino 22 marzo: reddito per tutti un’utopia concreta. Roma 29 marzo: i devoti di San Precario per un reddito garantito. Napoli 12 aprile: reddito per tutti un’utopia concreta. Roma 15 aprile: seminario sugli ammortizzatori sociali. Roma: dal 20 aprile al 29 giugno: Professione precario. -

Fachbereichsarbeit
Bundesgymnasium/ Bundesrealgymnasium Hallein Arbeit als Recht, Einkommen als Pflicht DAS FINANZTRANSFERMODELL DES BEDINUNGLOSEN GRUNDEINKOMMENS Fachbereichsarbeit Geographie und Wirtschaftskunde Vorgelegt bei: Fischer Reinhard, Prof. Mag Von: Ramsauer Markus Elias, 8G Kuchl, Schuljahr 2013/2014 VORWORT Die Entscheidung, eine Fachbereichsarbeit für meine Reifeprüfung am Gymnasium Hallein zu verfassen erfolgte aus 2 Gründen. Zum einen wurde meinem Jahrgang das „Grundwerkzeug“ zum Schaffen eines derartigen Textes im Unterrichtsfach „Einführung in die Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens“ (EPWA) bereitgestellt, da zu diesem Zeitpunkt die Zentralmatura und die damit verpflichtende Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) für das Jahr 2014 als beschlossen galt und zum anderen liegt mir persönlich das Verfassen einer umfangreicheren Arbeit zu einem spezifischen Thema, in das es sich zu vertiefen gilt mehr, als das Lernen auf ein bestimmtes Ziel hin und die darauf folgende Prüfung. „Via destinatum est.“ Meine ursprüngliche Überlegung, mich den Recherchen über den Keynesianismus zu widmen wurde aufgrund eines für mich ärgerlichem Ereignisses während einer Diskussionsrunde im Geografieunterricht, als das Thema „Bedingungsloses Grundeinkommen“ zur Sprache kam, ich keine Auskunft über ein solches geben konnte und auch die Kenntnis über das Bestehen jenes Konzepts bei meinen Klassenkamerad/-innen nur bei den wenigsten vorhanden war, recht schnell verworfen und die Entscheidung zu Gunsten des Themas: „Das Finanztransfermodell des bedingungslosen Grundeinkommens“ gefällt. Die Suche nach Informationsquellen gestaltete sich angenehmer als angenommen, da genügend Literatur und eine Summe an Ansprechpartner/- innen zu dem Thema im deutschsprachigen Raum zu finden war und Originaltexte meistens als pdf. -Datei im Internet vorhanden waren. Auch war mir der laufende Nationalratswahlkampf eine Hilfe, da die politischen Organisationen dadurch größere Bereitschaft zeigten, auf meine Frage- Emails rasch zu antworten. -
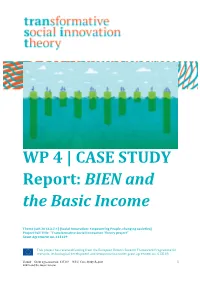
WP 4 | CASE STUDY Report: BIEN and the Basic Income
WP 4 | CASE STUDY Report: BIEN and the Basic Income Theme [ssh.2013.3.2-1] [Social Innovation- Empowering People, changing societies] Project Full Title: “Transformative Social Innovation Theory project” Grant Agreement no. 613169 This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613169. Transit – Grant agreement no. 613169 – WP4 | Case Study Report 1 BIEN and the Basic Income Suggested citation: Backhaus, J. & Pel, B. (2017). WP4 Case Study Report: BIEN and the Basic Income, TRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement no. 613169. Acknowledgements: We would like to express our gratitude to all our interviewees who responded to our lengthy question catalogue. Cover: Illustration by Andrew J. Nilsen (http://andrewjnilsen.com) Date: December 2017 Authors: Julia Backhaus, Bonno Pel Lead partner: ICIS-Maastricht University Participating partners: ICIS-Maastricht University and Université libre de Bruxelles Contact person: Julia Backhaus Maastricht University E-mail: [email protected] Phone: + 31-43-3884703 Disclaimer: The content of this publication does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the authors. Transit – Grant agreement no. 613169 – WP4 | Case Study Report 2 BIEN and the Basic Income Table of contents 1 Introduction ................................................................................... -

Imaginer Un Revenu Garanti Pour Tous
# LA CHANCE HISTORIQUE DES KURDES – pages 14 et 15 CINÉMA INSOUMIS À MANILLE PAR BERNARD EISENSCHITZ Page 27. 5,40 € - Mensuel - 28 pages N° 710 - 60e année. Mai 2013 DOSSIER : UNE UTOPIE À PORTÉE DE MAIN INÉGALITÉS, DÉMOCRATIE, SOUVERAINETÉ Imaginer un revenu Etat des lieux garanti pour tous pour préparer Inventer une autre vie, d’autres rapports sociaux, peut sembler hors de propos en période de crise. une reconquête L’exercice n’a pourtant jamais été aussi néces- saire. En Europe, en Amérique latine, en Asie, l’idée Nul ne croit plus que la raison l’emportera sur des d’un droit au revenu inconditionnel fait son chemin. politiques d’austérité insensées, ni que la morale préviendra les scandales mêlant argent et pouvoir. PAR M ONA C HOLLET Désormais, l’espoir d’un changement de direction repose sur la mise en cause frontale des intérêts en jeu. PAR S ERGE H ALIMI ON travaille, et, grâce à ce travail, on perçoit de l’argent. Une telle logique est si bien ancrée dans les esprits que la perspective d’instaurer un revenu inconditionnel, c’est-à-dire de verser à chacun une somme mensuelle suffisante pour lui permettre de «Je veux savoir d’où je pars plus ou moins universelles, dont dans un Pour conserver tant d’espoir» premier temps il importe de dresser le vivre, indépendamment de son activité rémunérée, apparaît comme (Paul Eluard, Poésie ininterrompue) une aberration. Nous sommes encore persuadés de devoir arra- bilan : l’envol des inégalités sociales, la cher à une nature aride et ingrate les moyens de notre subsistance décomposition de la démocratie politique individuelle; or la réalité est bien différente. -
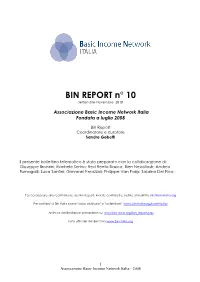
BIN REPORT N° 0
BIN REPORT n° 10 Settembre-Novembre 2010 Associazione Basic Income Network Italia Fondata a luglio 2008 Bin Report Coordinatore e curatore Sandro Gobetti Il presente bollettino telematico è stato preparato con la collaborazione di: Giuseppe Bronzini; Rachele Serino; Red Renta Basica; Bien Newsflash; Andrea Fumagalli; Luca Santini; Giovanni Perazzoli; Philippe Van Parijs; Sabrina Del Pico; Per collaborare alla realizzazione del Bin Report, inviate contributi e notizie all'indirizzo [email protected] Per iscriversi al Bin Italia come "socio ordinario" o "sostenitore" www.bin-italia.org/iscriviti.php Archivio dei Bin Report precedenti su: www.bin-italia.org/bin_report.php Il sito ufficiale del Bin Italia www.bin-italia.org 1 Associazione Basic Income Network Italia - 2008 Sommario Bin Report N° 10 Settembre-Novembre 2010 NAZIONALE: - 5 settembre Terni: presentazione del Bin Italia. - 9 e 10 ottobre Milano: Stati generali della precarietà. - 13 ottobre presentato a Roma Il Rapporto 2010 su povertà ed esclusione sociale in Italia. - Reddito minimo l' Europa approva il progetto pilota della Balzani. - Milano 2 novembre Precarietà e diritti. Welfare e reddito. San Precario incontra i candidati alle primarie del centro-sinistra a Milano. - Bari 15-19 novembre: Focus week contro povertà e esclusione sociale. - Roma 16 novembre: San Precario vuole il reddito garantito nel Lazio. - Roma 23 novembre: Protezione del reddito in Europa ed attuazione della legge sul reddito nella Regione Lazio. - Roma 24 novembre presentazione del primo QR (Quaderni per il Reddito a cura del Bin Italia) e dibattito sul reddito garantito nel Lazio. - Roma 25 novembre: San Precario di nuovo alla Regione Lazio. -

Papers Basic-Income Blaschke-2012Pdf
PaPeRs RonaLd bLaschke From the idea of a basic income to the PoLiticaL movement in euRoPe deveLoPment and questions tiftung s g R Rosa Luxembu From the Idea of a basic income to the political movement in Europe – development and questions Ronald Blaschke translated by Katharina Messinger Contents 1. Short history of the idea of a basic income in Europe and the US 2. The idea of a basic income becomes the political call of a wide, but politically differently coined movement in Germany 3. The European Basic Income Movement 4. Market liberal and emancipatory approaches to reasoning for and design of a basic income 4.1 Occupation, welfare state and radical democratisation of society and economy 4.2 Public goods, infrastructure and services 4.3 Redistribution 4.4 Gender equality 4.5 Reduction in use of natural resources 4.6 Global Social Rights 5. The European Basic Income Movement – Questions Literature 1 1. Short history of the idea of a basic income1 in Europe and the US Since the 18th century the idea of a basic income has been discussed by many well- known personalities in Europe, first among them Thomas Paine and Thomas Spence. Starting point of their ideas was the then existing poverty of members of their society which would not have existed in what they considered the natural state of man. This natural state would then provide sufficient natural means of living to everybody to secure their existence. Therefore, privatising natural means owned by everybody in combination with a division of labour would inevitably have made it impossible to guarantee the securing of livelihood through natural means for the individual. -

BIEN - Basic Income Earth Network NEWSFLASH 58 September 2009
BIEN - Basic Income Earth Network NEWSFLASH 58 September 2009 www.basicincome.org The Basic Income Earth Network was founded in 1986 as the Basic Income European Network. It expanded its scope from Europe to the Earth in 2004. It serves as a link between individuals and groups committed to or interested in basic income, and fosters informed discussion on this topic throughout the world. The present NewsFlash has been prepared with the help of Paul Nollen, John Baker, Uschi Bauer, Simon Birnbaum, David Casassas, Jurgen De Wispelaere, Corina Rodríguez Enríquez, Sandro Gobetti, Claudia & Dirk Haarmann, Dirk Jacobi, Lena Lavinas, Annie Miller, Jim Mulvale, Dani Raventós, Dorothee Schulte-Basta, Al Sheahen, Michel Schweri, Philippe Van Parijs, Fábio Waltenberg, Karl Widerquist, Almaz Zelleke, and Thérèse Davio. This NewsFlash can be downloaded as a PDF document on our website www.basicincome.org CONTENTS Editorial: Call for Papers, BIEN Congress July 2010 1. Events 2. New Issue of Basic Income Studies 3. Glimpses of National Debates 4. Publications 5. New Links 6. About BIEN _____ BIEN NEWSFLASH 58 – September 2009 1 Editorial: Call for papers for the next BIEN Congress, July 2010, São Paulo, Brazil BIEN is preparing its next Congress, to be held on June 30, July 1st and 2nd, 2010, at the Faculty of Economics, Administration and Accounting of the University of São Paulo. A website will be launched in the coming weeks. In the meanwhile, information is already available at www.basicincome.org The organizing committee, led by Lena Lavinas and Fábio Waltenberg, has issued the following call for papers. CALL FOR PAPERS: The 13th International Congress of the Basic Income Earth Network Universidade de São Paulo, Brazil June 30, July 1-2, 2010 CONGRESS THEME: Basic Income – an Instrument for Justice and Peace Basic income (BI) – the universal and unconditional income guarantee to individuals, on account of their belonging to a political community and on recognition of their common property on the community’s riches – should by now be considered a realistic utopia. -

The Promotion of Transformative Knowings Through Competing Claims to Expertise1 Bonno Pel & Julia Backhaus 17Th BIEN Congress, 25-27 September 2017, Lisbon (POR)
Realizing the Basic Income; the promotion of transformative knowings through competing claims to expertise1 Bonno Pel & Julia Backhaus 17th BIEN congress, 25-27 September 2017, Lisbon (POR) Dr. Bonno Pel (corresponding author) Université Libre de Bruxelles, Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire (IGEAT), Centre d'Etudes du Développement Durable (DB.6.250) 50 avenue FD Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgique [email protected] Julia Backhaus Maastricht University, Faculty of Humanities and Sciences International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS) P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht, The Netherlands [email protected] Abstract Current initiatives of social innovation bring forward new ways of doing and organizing, but transformative knowings as well. Their efforts towards the realization of those are important sites for the investigation of contemporary tensions of expertise. The promotion of transformative knowings typically involves a large bandwidth of claims to expertise. The attendant contestation is unfolded through the exemplar case of the Basic Income, in which the historically evolved forms of academic advocacy are increasingly accompanied by a new wave of activism. The crowd-funding initiatives, internet activists, citizen labs and petitions for referenda seek to realize the BI through different claims to expertise. Observing both the competition between the diverse claims to expertise and the overall co-production process through which the Basic Income is realized, this contribution concludes with reflections on the politics of expertise involved with transformative social innovation. Key words: Expertise, basic income, contestation 1 This paper is currently under review by the Science & Technology Studies journal. -

Une Utopie À Portée De Main
UNE UTOPIE A PORTEE DE MAIN Imaginer un revenu garanti pour tous Extrait du Monde Diplomatique, article complet pour le abonnés https://www.monde-diplomatique.fr/2013/05/CHOLLET/49054 Inventer une autre vie, d’autres rapports sociaux, peut sembler hors de propos en période de crise. L’exercice n’a pourtant jamais été aussi nécessaire. En Europe, en Amérique latine, en Asie, l’idée d’un droit au revenu inconditionnel fait son chemin. PAR MONA CHOLLET ON travaille, et, grâce à ce travail, on perçoit de l’argent. Une telle logique est si bien ancrée dans les esprits que la perspective d’instaurer un revenu inconditionnel, c’est-à-dire de verser à chacun une somme mensuelle suffisante pour lui permettre de vivre, indépendamment de son activité rémunérée, apparaît comme une aberration. Nous sommes encore persuadés de devoir arracher à une nature aride et ingrate les moyens de notre subsistance individuelle ; or la réalité est bien différente. Bourses étudiantes, congés parentaux, pensions de retraite, allocations familiales, indemnités de chômage, régime français des intermittents du spectacle, minima sociaux : autant de prestations qui ont en commun de découpler revenu et travail. Si insuffisants, si attaqués que puissent être tous ces dispositifs, ils montrent que le revenu garanti est une utopie « déjà là ». En Allemagne, le revenu de la population ne provient directement du travail qu’à hauteur de 41 %, signalent Daniel Häni et Enno Schmidt dans leur film Le Revenu de base (2008) (1). En France, en 2005, il dépendait à 30 % de la redistribution (allocations diverses) : « Malgré tous les discours idéologiques, malgré la liquidation de l’Etat-providence, vilipendé par les néolibéraux, la part des prélèvements obligatoires est montée inexorablement sous les présidents Mitterrand, Chirac et Sarkozy (2).