Mise En Page 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Hagenbeckallee.Pdf
33 | Biographien von A bis Z Hagenbeckallee mus befriedigen, zudem kolonialrassistisches Stellingen, seit 1928, benannt nach Carl Überlegenheitsgefühl gegenüber „fremden Völ - Hagenbeck (1844–1913), Tierhändler, „Völker- kern“ bestätigen, die als vermeintlich „primi- schau“-Ausrichter sowie Gründer und Zoodirek- tiv“ und „naturnah“ vorgeführt wurden, un- tor des Hagenbeck Tierparks geachtet ihrer tatsächlichen Lebensumstände. Siehe auch: Hagenbeckstraße, Stellingen (1949) Entsprechend hatte etwa die Schau 1899 den Siehe auch: Jacobsenweg, Stellingen, seit 1964, marktschreierischen Titel „Wildes Afrika“. Die benannt nach Adrian Jacobsen (1853–1947), gewollte Dramatik der Darbietungen beschrieb Forschungsreisender im Auftrag vom Tierpark Hagenbeck in seinen Lebenserinnerungen: Hagenbeck und Anwerber für die „Völker- „So ,überfielen‘ plötzlich zu Beginn des Spiels schauen“ Sklavenhändler dieses friedliche Dorf. Araber hoch zu Dromedar umritten mit Geschrei und 1866 übernahm Carl Gottfried Wilhelm Heinrich Gewehrgeknatter die eben noch schmausen- Hagenbeck von seinem Vater, dem ehemaligen den Dorfbewohner. (…) Dann erschienen euro - Fischhändler Gottfried Claes Carl Hagenbeck, päische Tierfänger, verjagten in einem Feuer- dessen Tierhandlung auf dem Spielbudenplatz gefecht die räuberischen Beduinen und an- in Hamburg-St. Pauli. In dieser Zeit wurden schließend gab es ein großes Friedensfest, bei zahlreiche zoologische Gärten gegründet; die dem unter heimischer Musikbegleitung ge- Nachfrage nach exotisch wirkenden Schau- tanzt und alle Riten -

Hagenbecks „Völkerschauen“
AB SEK II Anders sein / Internationale Beziehungen / Macht und Ohnmacht / SEK II: Imperialismus Kultur und Vergnügungen /Kolonialismus / Kaiserzeit Hagenbecks „Völkerschauen“ Schon im römischen Reich und wieder im Absolutismus wurden in Europa Menschen aus entfernten Weltgegenden wegen ihrer fremden Lebensweise und ihres anderen Aussehens ausgestellt. Es waren meistens Menschen aus Ethnien, deren Gebiet erobert wurde. Eine Blüte erfuhren diese „Menschenzoos“ in der Zeit des Kolonialismus. Im deutschen Reich war der Hamburger Carl Hagenbeck ein Großunternehmer in diesem Gewerbe. Seine Anwerber begaben sich in Kolonien und abgelegene Weltgegenden und versuchten, möglichst große Gruppen der dortigen Einwohner zu einem Aufenthalt in Europa zu bewegen – mit Überredungskraft, finanziellen Anreizen und auch mittels Druck. Carl Hagenbeck eröffnete seine erste Menschenausstellung mit Lappländern 1874 in Hamburg, dann folgten Berlin und Leipzig. 1876 kamen drei „Nubier“ nach Deutschland. 1880 folgten die Inuit, von deren Aufenthalt die untenstehenden Schriftquellen stammen (Siehe auch „Zeitgenosse“ Abraham Urikab). 1884 organsierte Hagenbeck eine „Kalmücken“ (richtig Oiraten) – Schau, darauf folgte eine Ceylonschau. Alle Schauen wurden so inszeniert, dass künstliche Gebäude im „Stil“ des Herkunftslands als Behausungen zu sehen waren und die Fremden „ihre“ Handwerke, Gesänge und Tänze vorführten. Den ganzen Tag lang wurden sie bei einem künstlich wiedererschaffenen Alltagsleben angeschaut. Hagenbecks Erfolg war überragend. 1908 konnte er den Zoo -

Revisiting the Relationship Between Indigenous Agency and Museum Inventories
Revisiting the Relationship between Indigenous Agency and Museum Inventories: An Object-Centered Study of the Formation of Lübeck's Jacobsen Collection (1884/1885) from the Northwest Coast of America By Angela Hess Cover: Objects from Lübeck’s Jacobsen collection. Photo: Angela Hess, July 2019 Revisiting the Relationship between Indigenous Agency and Museum Inventories: An Object-Centered Study of the Formation of Lübeck's Jacobsen Collection (1884/1885) from the Northwest Coast of America Author: Angela Hess Student number: s2080087 MA Thesis Archaeology (4ARX-0910ARCH) Supervisor: Dr. M. De Campos Françozo Specialization: Heritage and Museum Studies University of Leiden, Faculty of Archaeology Leiden, June 5, 2020, final version 1 2 Table of Contents Acknowledgements ............................................................................................................. 5 Chapter One: Introduction .................................................................................................. 6 Defining the Research Scope: Aims and Objectives, Hypotheses, Limitations ............. 10 Methodology and Theoretical Frameworks .................................................................. 12 Working Definitions ...................................................................................................... 14 Outline of Chapters ....................................................................................................... 17 Chapter Two: Contexts and Concepts for the Study of the 1884/85 Jacobsen Collection19 2.1 -

Race, Empire and Inherited Histories: Readings of Kafka, Schnitzler and Heyse
Race, Empire and Inherited Histories: Readings of Kafka, Schnitzler and Heyse by Vasuki Shanmuganathan A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Germanic Languages & Literatures and Women & Gender Studies Institute University of Toronto © Copyright by Vasuki Shanmuganathan 2016 Race, Empire and Inherited Histories: Readings of Kafka, Schnitzler and Heyse Vasuki Shanmuganathan Doctor of Philosophy in German Literature, Culture and Theory Department of Germanic Languages & Literatures and Women & Gender Studies Institute University of Toronto 2016 Abstract My dissertation examines the discourses of empire during the shift from aesthetic to biopolitical ways of reading race, which influenced nineteenth and twentieth century German language writings. Seemingly disparate novellas from Paul Heyse and Arthur Schnitzler and a short story from Franz Kafka serve to illustrate how race was locally defined through the narrative of inherited histories in the German and Austro-Hungarian Empires. “Inherited histories” is a term which privileges heredity, race and kinship networks as sites to study empire during a period when national and linguistic terms of defining bodies were different. In collocation, the first historical exploration of German and Austrian family business networks in colonial Ceylon and an autobiography from John George Hagenbeck show how views on race were globally ordered through colonialism but also blurred in order to accommodate trade. Additional materials such as postcards, photographs and stagings of ethnographic exhibits further inform the unstable constructions of race in the through kinship networks and heredity. There are three key contributions this dissertation makes to race, sexuality and colonial studies. The first section shows how the German and Austro-Hungarian Empire did not require formal colonies, ii comparable to the British or French regimes, to own businesses in colonial Ceylon. -

Inside Stories: Agency and Identity Through Language Loss
INSIDE STORIES: AGENCY AND IDENTITY THROUGH LANGUAGE LOSS NARRATIVES IN NUNATSIAVUT by © Martha MacDonald A thesis submitted to the School of Graduate Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Interdisciplinary Program Memorial University of Newfoundland June 2015 ABSTRACT This thesis examines narratives told about language loss in the Inuit territory of Nunatsiavut in Northern Labrador, NL, based on forty-five interviews carried out in 2002/2003 and in 2013/2014. (These are narratives in the folkloristic sense of a text that tells a story.) Language shift in Nunatsiavut has progressed rapidly since the mid- twentieth century until the current population of active speakers is low enough to cause concern about the survival of Inuttitut. The following questions were addressed: what people think caused the decline of the language; what the effect of Inuttitut language retention or shift has been on Labrador Inuit identity; and how these narratives have changed in their character and use over time. Analysis of the interviews and accompanying research on Moravian education, literacy, and the use of narrative revealed that people’s explanations for language loss varied according to their age, and, accordingly, they had different ideas on the importance of Inuttitut retention as a part of Inuit identity. The oldest generation of people interviewed, most of them Inuttitut speakers, identified a combination of circumstances that arose from community decisions, but they retained their feeling that the language was a vital part of identity. The next generation felt that Inuttitut had been removed from their communities through the combined forces of school, church and government, and felt that it was possible to be Inuit without the language, but that it continues to be important. -

Hagenbecks „Völkerschauen“
AB SEK I Anders sein / Internationale Beziehungen / Macht und Ohnmacht / SEK I: Imperialismus Kultur und Vergnügungen /Kolonialismus / Kaiserzeit Hagenbecks „Völkerschauen“ Schon im römischen Reich und wieder im Absolutismus wurden in Europa Menschen aus entfernten Weltgegenden wegen ihrer fremden Lebensweise und ihres anderen Aussehens ausgestellt. Es waren meistens Menschen aus Ethnien, deren Gebiet erobert wurde. Eine Blüte erfuhren diese „Menschenzoos“ in der Zeit des Kolonialismus. Im deutschen Reich war der Hamburger Carl Hagenbeck ein Großunternehmer in diesem Gewerbe. Seine Anwerber begaben sich in Kolonien und abgelegene Weltgegenden und versuchten, möglichst große Gruppen der dortigen Einwohner zu einem Aufenthalt in Europa zu bewegen – mit Überredungskraft, finanziellen Anreizen und auch mittels Druck. Carl Hagenbeck eröffnete seine erste Menschenausstellung mit Lappländern 1874 in Hamburg, dann folgten Berlin und Leipzig. 1876 kamen drei „Nubier“ nach Deutschland. 1880 folgten die Inuit, von deren Aufenthalt die untenstehenden Schriftquellen stammen (Siehe auch „Zeitgenosse“ Abraham Urikab). 1884 organsierte Hagenbeck eine „Kalmücken“ (richtig Oiraten ) – Schau, darauf folgte eine Ceylonschau. Alle Schauen wurden so inszeniert, dass künstliche Gebäude im „Stil“ des Herkunftslands als Behausungen zu sehen waren und die Fremden „ihre“ Handwerke, Gesänge und Tänze vorführten. Den ganzen Tag lang wurden sie bei einem künstlich wiedererschaffenen Alltagsleben angeschaut. Hagenbecks Erfolg war überragend. 1908 konnte er den Zoo in -
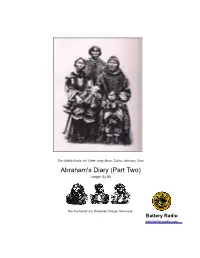
Abraham's Diary (Part Two) Length: 52.00
The Ulrikab family: (l-r) Ulrike, baby Maria, Tobias, Abraham, Sara Abraham's Diary (Part Two) Length: 52.00 The Fox family: (l-r) Terrianiak, Paingo, Nachasak Battery Radio www.batteryradio.com SYNOPSIS: This is a story about the gulf in comprehension between white Europeans and North American Inuit, a gulf which spans more than two centuries. In 1880, two Inuit families from Labrador were exhibited in European zoos. While European spectators gaped at them, the Inuit gazed back. And one of them kept a diary. It is the earliest known Inuit autobiography. Late 19th century Europe fostered scientific racism, and spectators who flocked to the zoo exhibit expected to gape at "exotics" from some "primitive race". What they found instead were Labradorimiut who had been schooled by German missionaries for a century, spoke 3 languages, played German hymn tunes on violin, and who were keeping their own ethnographic notes on the "uncivilised" Europeans. The feature ends with a 21st-century journey by Canadian Inuit who find European attitudes surprisingly unchanged in 130 years. ABRAHAM'S DIARY broadcast as a 2-part series. Part One describes the relationship between Labrador Inuit and German Moravian missionaries which began in the 18th century. The missionaries brought their music, and banned the indigenous Inuit music as “heathen”. Berlin Zoo poster, 1880 A century later, many Labradorimiut spoke some German, played German brass and string music, and had adopted the Moravian protestant religion. In August 1880, despite the missionaries' protests, a German zoo agent convinced two Labrador Inuit families to sail to Europe to participate in “ethnographic shows.” They were to be paid and provided passage back to Labrador the following Spring. -
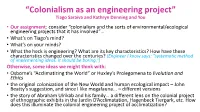
Colonialism As an Engineering Project Presentation
“Colonialism as an engineering project” Tiago Saraiva and Kathryn Denning and You • Our assignment: consider “colonialism and the sorts of environmental/ecological engineering projects that it has involved”… • What’s on Tiago’s mind? • What’s on your minds? • What the heck is engineering? What are its key characteristics? How have these characteristics changed over the centuries? {Engineer I know says: “systematic method of implementing ideas. It should be boring.”} Otherwise, some ideas we might think with: • Osborne’s “Acclimatizing the World” or Huxley’s Prolegomena to Evolution and Ethics • the original colonization of the New World and human ecological impact – John Beatty’s suggestion, and since I like megafauna... – different versions • the story of Abraham Ulrikab and his family… a different lens on the colonial project of ethnographic exhibits in the Jardin D’Acclimatation, Hagenbeck Tierpark, etc. How does this illuminate the colonial engineering project of acclimatization? Osborne, “Acclimatizing the World: A History of the Paradigmatic Colonial Science”, Osiris 2001 vol 15, 135. Osborne, “Acclimatizing the World: A History of the Paradigmatic Colonial Science”, Osiris 2001 vol 15, 137. “Acclimatization”… Osborne, “Acclimatizing the World: A History of the Paradigmatic Colonial Science”, Osiris 2001 vol 15, 139. Osborne, “Acclimatizing the World: A History of the Paradigmatic Colonial Science”, Osiris 2001 vol 15, 143 Osborne, “Acclimatizing the World: A History of the Paradigmatic Colonial Science”, Osiris 2001 vol 15, 144 Osborne, “Acclimatizing the World: A History of the Paradigmatic Colonial Science”, Osiris 2001 vol 15, 151 Conclusion…. T.H. Huxley's "Evolution and Ethics -- Prolegomena" (1894) "The process of colonization presents analogies to the formation of a garden which are highly instructive. -

THE DIARY of ABRAHAM ULRIKAB: TEXT and in Essays at the Beginning and End of the Book, Profes- CONTEXT
330 • REVIEWS Research Center at Ohio State University, are well cap- see them. Soon after their arrival in Germany, both fami- tioned. Unfortunately, they do not include identifying lies came to regret their decision to spend a year abroad. catalogue numbers. Abraham wrote that the Inuit found the crowds unpleasant, Nasht’s book has deservedly been selected by the South tired of their duties, suffered mistreatment at the hands of Australia Big Book Club as its April 2006 Book-of-the- their employers, caught a variety of ailments, and were Month Club Selection. I heartily recommend it to all who desperately homesick. are interested in Arctic and Antarctic explorers, explora- Professor Lutz and his students located a number of tion, and history. other documents that provide additional information about this sad chapter in Inuit-Western history. The documents Stuart E. Jenness include Moravians’ letters expressing concern about the 9-2051 Jasmine Crescent Hagenbeck arrangement, newspaper articles reporting on Ottawa, Ontario, Canada the Inuit exhibition, the physician Rudolf Virchow’s paper K1J 7W2 detailing physical and behavioral attributes of individual family members, and clothing advertisements making ref- (Stuart E. Jenness is the author of The Making of an erence to the Inuit’s attire. These documents, along with Explorer: George Hubert Wilkins and the Canadian Arctic Abraham’s letters and diary, have been translated into Expedition, 1913–1916, published by McGill Queen’s English and form the body of the publication. Historic University Press in 2004.) drawings and photographs of the eight Inuit and Alootook Ipellie’s cover artwork complement the text and reinforce Abraham’s first-person voice. -

2005 the Diary of Abraham Ulrikab
Document généré le 25 sept. 2021 05:46 Études/Inuit/Studies LUTZ, Hartmut (ed.), 2005 The Diary of Abraham Ulrikab: Text and Context, Translated by Hartmut Lutz and students from the University of Greifswald, Germany, Ottawa, University of Ottawa Press, 100 pages. Peter C. Evans Problématiques des sexes Gender issues Volume 30, numéro 1, 2006 URI : https://id.erudit.org/iderudit/016164ar DOI : https://doi.org/10.7202/016164ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Association Inuksiutiit Katimajiit Inc. Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones (CIÉRA) ISSN 0701-1008 (imprimé) 1708-5268 (numérique) Découvrir la revue Citer ce compte rendu Evans, P. C. (2006). Compte rendu de [LUTZ, Hartmut (ed.), 2005 The Diary of Abraham Ulrikab: Text and Context, Translated by Hartmut Lutz and students from the University of Greifswald, Germany, Ottawa, University of Ottawa Press, 100 pages.] Études/Inuit/Studies, 30(1), 201–205. https://doi.org/10.7202/016164ar Tous droits réservés © La revue Études/Inuit/Studies, 2006 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ les sciences sociales. Laugrand montre clairement que la réception du christianisme par les Inuit a été le résultat d'un long processus dynamique, complexe et multidimensionnel. -

Mitiarjuk's Sanaaq and the Politics of Translation in Inuit Literature
Arctic Solitude: Mitiarjuk’s Sanaaq and the Politics of Translation in Inuit Literature Keavy Martin erhaps it is the influence of the grant writing that scholars are obliged to do in order to earn our bread and butter, but it seems that much of our energy in literary studies goes into advo- Pcating for the reading that we have most recently been doing. We thrive on identifying gaps in the critical literature, and then on zealously draw- ing other people’s attention to these oversights. “Too often,” we say, or “for too long, the work of (insert author here) has gone unrecognized!” This kind of tactic, however — what might be called remedial or salvage literary criticism — is arguably quite valid when informed by the appro- priate political framework: for instance, when the oversight that we are protesting has happened as the result of shortsightedness or prejudice or Eurocentrism in the academy. What we read, after all, and what we choose to canonize (and finance) by inclusion on university reading lists says much about our values — and those of our institutions. The process of opening up the canon to include, first, works by Canadian writers (itself, at one time, a radical move) and, later, works by Canadian writers belonging to demographics other than the two “founding” French and English nations has been an important agent in the rise of both multiculturalism and the Aboriginal1 rights move- ment. Today, almost any Canadian literature course will include at least one text by an Aboriginal writer: generally by Thomas King, Eden Robinson, or Tomson Highway. -

90 • REVIEWS Shortly Afterwards, Leffingwell Interrupted His Studies To
90 • REVIEWS Shortly afterwards, Leffingwell interrupted his studies a shotgun. The America, the converted whaler that carried to serve the United States Navy as a seaman during the 1898 him on the Baldwin – Ziegler Expedition, forms the Spanish – American War. As a gunner on the battleship background, with a dog-sled team in between. USS Oregon, he participated in the decisive naval victory at The book is well furnished with maps, but, as is very Santiago de Cuba. often the case, these can only serve as a taster, because of We learn how Leffingwell began his Arctic journey the constraints of the page size. Fortunately, large-scale at the age of 26 when he was employed as chief scientific images of Leffingwell’s superb cartography can be easily officer on the chaotic 1901 Baldwin – Ziegler North Pole found on the website of the United States Geological Expedition, but it was the northern coastal region of Survey, along with the full text of his master work, “The Alaska that would be the theatre of Leffingwell’s greatest Canning River Region, Northern Alaska” (Professional achievements between 1906 and 1914. Paper 109, 1919). I found that the pleasure of reading this The coastline had originally been delineated by Sir book was enhanced by having the full-sized maps on the John Franklin in 1826 during his second overland Arctic screen in front of me. expedition. While Franklin had descended the Mackenzie In summary, this is a well-written account of an River and “hastily traversed” the coast in two small boats, interesting and significant figure of the era, which has been Leffingwell performed his geodesic survey with an almost called the Heroic Age of Polar Exploration.