Kommunales Jahrbuch 2017
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Übersicht Hilfensangebote Für Risikogruppen
ÜBERSICHT HILFENSANGEBOTE FÜR RISIKOGRUPPEN Stand: 26.03.2020 Hier finden Sie eine Übersicht über Hilfeangebote für Senioren, kranke und psychisch beeinträchtigte Personen sowie für Menschen mit Behinderung im Landkreis Traunstein anlässlich der Coronakrise (Liste wird laufend aktualisiert) Anbieter Region Dienste Ansprechpartner Kontaktdaten Malteser Hilfsdienst Landkreis Einkaufsdienst Peter Volk 0861/986600 Traunstein Bayerisches Rotes Landkreis Einkaufsdienst, Anna Schneider 0861/989 73 44 Kreuz Traunstein Besorgungsdienst, [email protected] (Mo – Fr von 8 bis 12 Spaziergänge, Uhr) Betreuungsdienst, Lieferdienst, BRK WuS TSV Altenmarkt Altenmarkt Einkaufen, Gang zur Philip Mix 0176/307 401 56 Apotheke oder andere Walter Andrasch [email protected] Erledigungen EDEKA Pfeilstetter Bergen Lebensmittellieferservice EDEKA-Markt 08662/488 555 Pfeilstetter [email protected] Soziale Bürgerhilfe Bergen Einkaufsdienst, Sozialbüro 08662/3157 Bergen-Vachendorf Besorgungsdienst (soziale [email protected] Hilfen in Notlagen) VdK und Chieming Einkaufsdienst Barbara Sailer 0170/4465450 Pfarrgemeinderat Chieminger Chieming Lebensmittellieferdienst Maria Naglschmidt 08664/9274 265 Dorfladen Pfarrgemeinderat Engelsberg Einkaufsdienst Pfarrgemeinderat 08634/7353 (Mo – Fr von 10 bis 14 Uhr) Engelsberg Engelsberg Burschen- und Fridolfing Einkaufsdienst für Lenz Johannes 0151/673 03 328 Arbeiterverein Senioren Fridolfing-Pietling e.V. Gemeinde Grabenstätt Einkaufsservice 08661/9887-23 Grabenstätt (u.a. mit EDEKA -
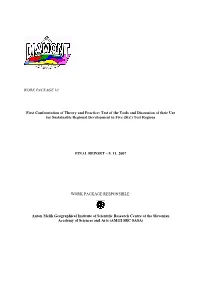
Part Report for Each Region Was Prepared
WORK PACKAGE 10 First Confrontation of Theory and Practice: Test of the Tools and Discussion of their Use for Sustainable Regional Development in Five (Six!) Test Regions FINAL REPORT – 9. 11. 2007 WORK PACKAGE RESPONSIBLE: Anton Melik Geographical Institute of Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (AMGI SRC SASA) CONTENT I. Introduction II. Methodology III. Searching for sustainable regional development in the Alps: Bottom-up approach IV. Workshops in selected test regions 1. Austria - Waidhofen/Ybbs 1.1. Context analysis of the test region 1.2. Preparation of the workshop 1.2.1. The organizational aspects of the workshop 1.3. List of selected instruments 1.4. List of stakeholders 1.5. The structure of the workshop 1.5.1. Information on the selection of respected thematic fields/focuses 1.6. Questions for each part of the workshop/ for each instrument 1.7. Revised answers 1.8. Confrontation of the context analysis results with the workshop results 1.9. Starting points for the second workshop 1.10. Conclusion 2. France – Gap 2.1. Context analysis of the test region 2.2. Preparation of the workshop 2.2.1. The organizational aspects of the workshop 2.3. List of selected instruments 2.4. List of stakeholders 2.5. The structure of the workshop 2.5.1. Information on the selection of respected thematic fields/focuses 2.6. Questions for each part of the workshop/ for each instrument 2.7. Revised answers 2.8. Confrontation of the context analysis results with the workshop results 2.9. Starting points for the second workshop 2.10. -
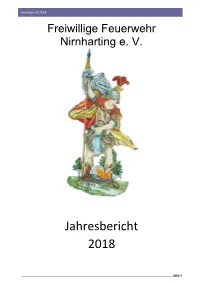
Jahresbericht Für Das Jahr 2018
Jahresbericht 2018 Freiwillige Feuerwehr Nirnharting e. V. Jahresbericht 2018 Seite 1 Jahresbericht 2018 Aktiver Mitgliederstand zum 31. Dezember 2018 63 Aktive, davon 14 Feuerwehranwärter Seite 2 Jahresbericht 2018 Einsätze 2018 Baum über Fahrbahn am 21.01.2018 um 8:58 Uhr Einsatzort: Dobelgraben, Eigene Einsatzkräfte: 5 Einsatzdauer: 1 Stunde, Eingesetzte Fahrzeuge: MZF VU mit Sattelzug 26.03.2018 um 12:43 Uhr Einsatzort: TS23 höhe Streulach, Eigene Einsatzkräfte: 8 Einsatzdauer: 6 Stunden, Eingesetzte Fahrzeuge: LF 10/6, MZF Weitere Einsatzkräfte: FF Petting, FF Waging, Rettungsdienst, Polizei Die Freiwillige Feuerwehr Nirnharting wurde zur Unterstützung der Feuerwehr Petting zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW alarmiert. Hauptaufgaben waren dabei die Verkehrsregelung, das Reinigen der Fahrbahn und das Umräumen der Ladung des LKWs. Personensuche in Waging am 23.04.2018 um 23:12 Uhr Einsatzort: Waging, Eigene Einsatzkräfte: 14 Einsatzdauer: 3 Stunden, Eingesetzte Fahrzeuge: LF 10/6, MZF Weitere Einsatzkräfte: FF Waging am See, FF Gaden, Rettungsdienst, Polizei Fahrbahnreinigung nach Wildunfall am 27.04.2018 um 0:17 Uhr Einsatzort: TS27 Höhe Buch, Eigene Einsatzkräfte: 14 Einsatzdauer: 1 Stunde, Eingesetzte Fahrzeuge: LF 10/6, MZF Weitere Einsatzkräfte: Polizei Brand Nebengebäude bei Angerpoint am 20.05.2018 um 16:51 Uhr Einsatzort: Angerpoint, Eigene Einsatzkräfte: 15 Einsatzdauer: 2,5 Stunden, Eingesetzte Fahrzeuge: LF 10/6, MZF Weitere Einsatzkräfte: FF Gaden, FF Waging, FF Taching, FF Tettenhausen, Rettungsdienst, Polizei Zur Unterstützung -

Überarbeitete Fassung 02.04.20
LAG „Traun-Alz-Salzach“ Lokale Entwicklungsstrategie LEADER 2014 - 2020 Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Überarbeitete Fassung vom 02.04.2020 Seite 1 LAG „Traun-Alz-Salzach“ Inhaltsverzeichnis Seite A Inhalte des Evaluierungsberichts Leader 2007-2013 entfällt B Inhalte der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) 1. Festlegung des LAG-Gebiets 4 2. Lokale Aktionsgruppe 6 2.1 Rechtsform, Zusammensetzung und Struktur 6 2.2 Aufgaben und Arbeitsweise 10 2.3 LAG-Management 11 3. Ausgangslage und SWOT-Analyse 13 3.1 Beschreibung Ausgangslage und Analyse Entwicklungsbedarf und -potenziale 13 3.1.1 Landschaft und Umwelt 13 3.1.2 Klimaschutz 15 3.1.3 Land- und Forstwirtschaft 16 3.1.4 Bevölkerung und demographischer Wandel 18 3.1.5 Siedlungsentwicklung, Versorgung und Soziales 21 3.1.6 Verkehr und Mobilität 22 3.1.7 Kultur, Tourismus und Freizeit 23 3.1.8 Wirtschaft und Bildung 25 3.2 Bestehende Planungen und Initiativen 26 3.3 Bürgerbeteiligung 28 4. Ziele der Entwicklungsstrategie und ihre Rangfolge 30 4.1 Innovativer Charakter für die Region 30 4.2 Beitrag zu den übergreifenden ELER-Zielsetzungen 30 4.3 Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen des demographischen Wandels 31 4.4 Mehrwert durch Kooperationen 31 4.5 Regionale Entwicklungsziele 33 4.6 Beschreibung der Ziele und Indikatoren 35 4.7 Finanzplanung 47 5. LAG-Projektauswahlverfahren 48 5.1 Regeln für das Projektauswahlverfahren und Förderhöhe -

Grund- Und Mittelschulen Im Landkreis Traunstein Schulanschrift Schul-Nr
Staatliches Schulamt im Landkreis Traunstein Grund- und Mittelschulen im Landkreis Traunstein Schulanschrift Schul-Nr. Schulkontaktdaten Schulleitung Grundschule Altenmarkt 2882 GS Tel.: 08621 1720 Schwan Sabine (Rin) Schulweg 15 2914 MS Fax: 08621 63635 Zehentmaier Gertraud (StRGS/STV) 83352 Altenmarkt [email protected] Frau Geerk (VA) Grundschule Bergen 1277 GS Tel.: 08662 8306 Mitterer Monika (Rin) Tannhäuserweg 10 2915 MS Fax: 08662 419723 Leitenstorfer Christine (L/STV) 83346 Bergen [email protected] Frau Gehmacher (VA) Grund- und Mittelschule Chieming 1278 GS Tel.: 08664 9849-0 Röhr Sabine (Rin) Josef-Heigenmooser-Straße 45 2916 MS Fax: 08664 9849-22 n. n. 83339 Chieming [email protected] Frau Wimmer (VA) Grundschule Engelsberg 2917 GS Tel.: 08634 620730 Unterforsthuber Christine (Rin) Raiffeisenplatz 6 Fax: 08634 620750 Brüche Christine (L/STV) 84549 Engelsberg [email protected] Frau Hamberger (VA) Grund- und Mittelschule Salzachtal in Fridolfing 2869 GS Tel.: 08684 240 Stehböck Thomas (R) Schulweg 6 2919 MS Fax: 08684 9194 Baumann Wolfgang (KR) 83413 Fridolfing [email protected] Frau Stettmeier (VA), Frau Mörtl (VA) Grundschule Grabenstätt 2920 GS Tel.: 08661 241 Zeitel Johannes (R) Am Eichbergfeld 11 Fax: 08661 8058 Gebert-Schwarm Birgit (StRGS/STV) 83355 Grabenstätt [email protected] Frau Ganser (VA) Grund- und Mittelschule Grassau 1279 GS Tel.: 08641 2125 Tischler Georg (KR 1/SLei) Birkenweg 12 2921 MS Fax: 08641 697552 n. n. 83224 Grassau [email protected] -

Projekt ‚Solidarische Landwirtschaft
Donnerstag, 24. Mai 2018 LOKALES SWA Nummer 118 27 Projekt „Solidarische Landwirtschaft“ Verbraucher unterstützen bei Tettenberg Gärtnerei durch feste Abnahmegarantien – „Acker-Frühstück“ am Samstag Von Hans Eder Wochen noch leeren Felder be- Sauerkirschen. Die Auswahl an reits teilweise von allerlei Pflan- Obst und auch an Beeren wird im Otting. Bei der Ortschaft Tet- zen bedeckt sind – gefördert durch Laufe der nächsten Jahre noch zu- tenberg in der Nähe von Otting die nach wochenlanger Trocken- nehmen. Johannisbeeren aller- entsteht auf einer 1,3 Hektar gro- heit jetzt doch endlich eingetroffe- dings sind bereits reichlich vor- ßen Anbaufläche ein gemein- nen Regenfälle. Es sind vor allem handen, da sie schon vor einigen schaftlich getragenes Gemüse- verschiedene Salatsorten sowie Jahren gepflanzt wurden. Auch bau-Projekt der „Solidarischen Radieschen und einige Kräuter, Kräuter und Teepflanzen werden Landwirtschaft“ (SoLaWi). Wer die inzwischen bereits geerntet angebaut. sich daran beteiligt, kann sich Wo- werden können. Die beiden Ver- Demnächst werden noch zwei che für Woche mit einem breit ge- teilungsstellen sind im ehemali- Gewächshäuser aufgebaut, die fächerten Gemüse-Paket versor- gen Rossstall am Ottinger Pfarr- zunächst hauptsächlich für Toma- gen. Inhaberin ist Demeter-Land- hof und an der Zentrale des Kreis- ten gedacht sind, in denen dann wirtin Kristine Rühl aus Siegsdorf; bildungswerks im Campus St. Mi- aber in der kalten Jahreszeit die Elfriede Brenner ihre Nichte Karoline Widur und chael an der Kardinal-Faulhaber- winterharten Salate und Gemüse- eine Gruppe von weiteren freiwil- Straße in Traunstein. sorten angebaut werden sollen. wird heute 89 ligen Helfern arbeiten dabei mit. Das Konzept dieses biodynami- Was aktuell in den kommenden schen Gemüsebau-Projekts: In- Wochen vor allem geerntet wer- Waging am See. -

Die Erzeuger in Der Ökomodellregion
DIE ERZEUGER IN DER ÖKOMODELLREGION hier steckt regionale Bioqualität drin ABOKISTE GEMÜSE Hans Lecker Niederheining 1 83410 Laufen 08682 953224 [email protected] BIER Privatbrauerei Wieninger Poststraße 1 83317 Teisendorf 08666 8020 [email protected] Schlossbrauerei Stein Schlosshof 2 83373 Stein an der Traun 08621 983226 [email protected] BROT/SEMMELN Bäckerei Neumeier Marktstraße 13 83317 Teisendorf 08666 267 [email protected] Bäckerei Seidl Stadtplatz 45 84529 Tittmoning 08683 7898 Bäckerei Wahlich Laufener Straße 24 83416 Saaldorf-Surheim 08654 7795474 [email protected] Matthias Spiegelsperger Wimmern 20 83317 Teisendorf 08666 1527 [email protected] BUTTER Andechser Molkerei Scheitz Biomilchstraße 1 82346 Andechs 08152 3790 [email protected] Molkerei Berchtesgadener Land Hockerfeld 5-8 83451 Piding 08651 70040 [email protected] EIER Andreas und Katharina Buchwinkler Haberland 12 83416 Saaldorf-Surheim 08654 65270 [email protected] Andreas Maier Waldering 3 84529 Tittmoning 08683 1346 [email protected] Hans Lecker Niederheining 1 83410 Laufen 08682 953224 [email protected] Hans Glück Grassach 15 84529 Tittmoning 08683 932 [email protected] Leonhard Martl Gröbn 1 84556 Kastl 08679 6928 [email protected] Robert Zeilinger Niederstockham 1 84529 Tittmoning 08687 633 [email protected] Sebastian Kettenberger Kettenberg 1 84529 Tittmoning 08687 468 [email protected] FLASCHLBROT MIT LAUFENER LANDWEIZEN Jessica Romstötter Am Sandberg 36 83329 Waging am See -

Einzelhandelskonzept Für Die Marktgemeinde Waging Am See
München Stuttgart Forchheim Einzelhandelskonzept für die Marktgemeinde Köln Leipzig Lübeck Ried(A) Waging am See CIMA Beratung + Management GmbH Brienner Straße 45 80333 München T 089-55 118 154 F 089-55 118 250 [email protected] www.cima.de Stadtentwicklung Marketing Regionalwirtschaft Einzelhandel Wirtschaftsförderung Citymanagement Untersuchungsbericht Immobilien Organisationsberatung Bearbeiter: Dipl.-Geogr. Achim Gebhardt (Projektleitung) B.Sc. Geogr. Christoph Rohrmeier Kultur Tourismus München, März 2017 Einzelhandelskonzept für die Marktgemeinde Waging am See CIMA Beratung + Management GmbH Es wurden Fotos, Grafiken u.a. Abbildungen zu Layoutzwecken und als Platzhalter verwendet, für die keine Nutzungsrechte vorliegen. Jede Weitergabe, Vervielfältigung oder gar Veröffentlichung kann Ansprüche der Rechteinhaber auslösen. Wer diese Unterlage -ganz oder teilweise- in welcher Form auch immer weitergibt, vervielfältigt oder veröffentlicht übernimmt das volle Haftungsrisiko gegenüber den Inhabern der Rechte, stellt die CIMA Beratung+ Management GmbH von allen Ansprüchen Dritter frei und trägt die Kosten der ggf. notwendigen Abwehr von solchen Ansprüchen durch die CIMA Beratung+ Management GmbH. Der Auftraggeber kann die vorliegende Unterlage für Druck und Verbreitung innerhalb seiner Organisation verwenden; jegliche - vor allem gewerbliche - Nutzung darüber hinaus ist nicht gestattet. Diese Entwurfsvorlagen und Ausarbeitungen usw. fallen unter §2, Abs. 2 sowie § 31, Abs. 2 des Gesetzes zum Schutze der Urhe- berrechte. Sie sind -

SALZBURG- Austria GERMANY
320000 330000 340000 350000 360000 370000 380000 12°40'0"E 12°50'0"E 13°0'0"E 13°10'0"E 13°20'0"E 13°30'0"E Oichten Hilprechtsham Burgkirchen Schweiber EU TARANIS 2013 Activation ID: EMSN-005 Trostberg Kirchberg bei Mattighofen Kolming Thalhausen Eglsee Unterweiß au Product N.: 01 Salzburg, v1 Gumperding Aug Zipf Engertsham Abtenham Trimmelkam Schönberg Wendling Oberweißau Riedersbach Rudersberg Teichstätt Höcken SALZBURG- Austria 0 Dorfbeuern Bergham 0 0 Weilham Pietling Bergham 0 0 Michaelbeuern Scherschham Schneegattern 0 0 Hinterbuch 0 Bach Friedburg Mittererb Fornach 2 Breitenlohe 2 EU TARANIS 2013 N Krenwald " 3 Palting Untererb 3 0 5 Törring Ainhausen 5 ' Lindach Altenmarkt an der Alz Vorau Sankt Ulrich Pfaffing 0 Wildshut ° Sankt Pantaleon Reith REFERENCE Map - Overview 8 Palling Intenham Holz Kühbichl 4 Perw ang am Grabensee Fridolfing Lochen am See Lengau Forstern Production date: 25/06/2013 Lauterbach Stullerding Czech Republic Tengling Au Feldbach Ameisberg Bergham Berndorf bei Salzburg Utzweih Plain N Fasanenjäger Sankt Georgen bei Salzburg " Burg Vöcklamarkt 0 Anning Berndorf bei Salzburg ' Slovakia Lamprechtshausen 0 Germ any Reitsberg Pinswag Igelsberg Pöndorf ° Stein an der Traun Stein Schwöll 8 Offling Kirchham 4 Bürmoos Maierhof Tannberg Brunn Untergeisenfelden Eisping Austr ia Irsing Katzwalchen Untermühlham Hungary St. Georgen Weisbrunn Frankenmarkt Mollstätten Untereching Holzleiten Reitsham Schwaigern Haßmoning Oberwalchen Straßwalchen Steinbach Switzerland Obereching Hainbach Groß enegg Traunreut Altsberg Eck Slovenia -

Amtsblatt Für Den Landkreis Traunstein
AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS TRAUNSTEIN Herausgegeben vom Landratsamt Traunstein 83278 Traunstein, 15.03.2019 Zu beziehen unmittelbar beim Landratsamt Traunstein oder über die Gemeindeverwaltung sowie unter www.traunstein.bayern Erscheint in der Regel wöchentlich. Nr. 14 Seite 65 Inhaltsverzeichnis: Kraftfahrzeugverkehr im Landschaftsschutzgebiet „Waginger und Tachinger See“ 32/19 Sturmwarndienst für den Chiemsee und den Waginger-/Tachinger See 33/19 Vollzug der Baugesetze; Neubau von einem Mehrfamilienhaus "Theresienpark Siegsdorf" Bauabschnitt 1, Gebäude 1 auf dem Grundstück 44/1 der Gemarkung Obersiegsdorf, Gemeinde Siegsdorf 34/19 Sitzung des Zweckverbandes Holzknechtmuseum Ruhpolding am Donnerstag, 03.04.2019, um 10.00 Uhr im Haus des Gastes, Sitzungszimmer (DG), Rathausplatz 2, 83324 Ruhpolding 35/19 Seite 66 Amtsblatt für den Landkreis Traunstein Nr. 14 32/19 Az.: 1742.08-190011 Kraftfahrzeugverkehr im Landschaftsschutzgebiet „Waginger und Tachinger See“ Bekanntmachung Nach § 3 Abs. 1 Nr. 14 der Verordnung zum Schutze des Waginger und Tachinger Sees und der umliegenden Landschaft in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.03.1980 (Amtsblatt für den Landkreis Traunstein, Seite 25) ist es verboten, im Schutzgebiet ohne Erlaubnis mit Kraftfahrzeugen aller Art außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Plätze zu fahren und zu parken. Von den Beschränkungen ist der land- und forstwirtschaftliche Verkehr ausgenommen. Zur Durchführung notwendiger und rechtlich zulässiger Arbeiten, die das Fahren und Parken mit dem Kraft- fahrzeug im Landschaftsschutzgebiet erfordern, wird hiermit für die Monate April und Oktober 2019 allge- mein eine naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung vom Fahr- und Parkverbot zugelassen. Die Gemeinden Kirchanschöring, Petting, Taching am See und Waging am See werden hiermit ermächtigt, hinsichtlich der im Landschaftsschutzgebiet gelegenen und nach der StVO für den allgemeinen Kfz-Verkehr gesperrten öffentlichen Wege entsprechend zu verfahren. -

Immobilienmarktbericht Gewerbe 2012
2012 - 2015 2 Chiemgau – unsere Heimat SEHR GEEHRTE LESERIN, SEHR GEEHRTER LESER, die Verfügbarkeit verlässlicher Daten des Immobilienmarktes ist ein wichtiger Standortfaktor. Der Gutachterausschuss gibt hier einen Überblick über Preise für Gewerbebauland im Landkreis Traunstein. Außerdem finden Sie in diesem Bericht Verkaufszahlen, Geldumsätze und Informationen zur räumlichen Verteilung von Gewerbebaulandverkäufen. Der vorliegende Immobilienmarktbericht zum Gewerbebauland umfasst die Jahre 2012 bis Mitte 2015. Anliegen des Berichtes ist es, - Verkäufern und Käufern, - Banken, Versicherungen, Steuerberatern, Firmen, Behörden und Bewertungssach - verständigen verlässliche Zahlen zum baureifen Gewerbe- bauland anzubieten. Dieser Bericht wird kostenfrei im Internet zum Ansehen und zum Selbstausdruck zur Verfügung gestellt. Ihr Siegfried Walch Landrat des Landkreises Traunstein 3 Inhalt 1. Gutachterausschuss und Geschäftsstelle 4 1.1 Ziele und Aufgaben 4 1.2 Mitglieder des Gutachterausschusses am Landratsamt Traunstein 4 1.3 Geschäftsstelle im Landratsamt 5 1.4 Vorbemerkung zur Auswertung 5 1.5 Datenbasis, Datenschutz 6 2. Verkaufszahlen, Umsätze bei Gewerbebauland 6 3. Private und kommunale Verkäufe, 2012 - 2015 7 4. Marktreaktionen auf bezahlte/nicht bezahlte Erschließung 8 5. Flächengröße - Preis - Relation 9 6. Regionale Strukturdaten, Landkreis Traunstein 11 7. Räumliche Verteilung der Kaufverträge, 2012 - 2015 12 8. Allgemeines, wertbildende Standortfaktoren für Gewerbebauland 14 9. Standortbeurteilung durch vorhandene Betriebe 14 10. -

Hebammenliste (Stand: August 2020)
HEBAMMENLISTE KoKi – Netzwerk frühe Kindheit Stand: August 2020 Anrede Vorname Nachname Straße PLZ Ort Telefon Mobil E-Mail Sonstiges Frau Petra Rausch Weiglpoitner Str. 3 83352 Altenmarkt 0160 93591058 [email protected] Frau Katharina Leitner Kirchplatz 4 83224 Grassau 0160 8062092 [email protected] Frau Anna Schaufler Ecker Str. 59 a 83334 Inzell 0179 5431427 [email protected] Frau Laura Hanft 83119 Obing 0157 72726042 / Frau Sabina Träger Eschenauer Str.2a 83132 Pittenhart 08624 8204987 [email protected] Frau Adina Müller 83324 Ruhpolding 0175 1177008 / Frau Angelika Bredl Lärchenweg 20 83362 Surberg 01590 1489675 [email protected] Frau Irmgard Zureig-Kohlpaintner Zellerstr. 4 83362 Surberg-Lauter 0171 2096960 [email protected] Frau Lisa Rehmann-Zauner Achenstr. 5 b 83342 Tacherting 08621 62427 0171 7416347 [email protected] Frau Felizitas Riesemann 83373 Taching 0179 2671489 / Frau Veronika Stampfl Wallmoning 2 84529 Tittmoning 08634 9867040 0157 56101358 [email protected] Frau Sonja Enderle 84529 Tittmoning 08683 891659 / Frau Annette Weisky Traunwalchner Str. 1 83301 Traunreut 08669 3609929 0172 2640625 / Praxis Yamuna Hebammen- und Heilpraktikerpraxis Frau Ulrike Bayer St.-Georgs-Platz 11 83301 Traunreut 0861 90949050 0151 17356549 [email protected] Hebammenpraxis Traunreut „Herztöne“ Frau Gabi Friese-Miesgang 83368 St. Georgen 0151 20615000 / Frau Ulrike Bayer Brunnenweg 50 83278 Traunstein 0861 90949050 0151 17356549 [email protected] Frau Barbara Knapp 83278 Traunstein 0170 6360457 / Frau Alessandra Habicht 83278 Traunstein 0160 2579227 / Frau Petra Heyn Bahnhofstr. 31 83278 Traunstein 0861 60068 0171 9941390 [email protected] 08664 928540 Frau Susanne Deckert 83278 Traunstein 0176 45837324 / Frau Katja Schindlbeck 83278 Traunstein 0152 34356580 [email protected] Praxis Dr.