Bromus) Riparia (Poaceae
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bioscience Research
Available online freely at www.isisn.org Bioscience Research Print ISSN: 1811-9506 Online ISSN: 2218-3973 Journal by Innovative Scientific Information & Services Network RESEARCH ARTICLE BIOSCIENCE RESEARCH, 2019 16(2):1337-1353. OPEN ACCESS Role of biochar soil amendment for alleviation of adverse effects of water stress on Dimorphotheca ecklonis plants Soha E.Khalil and Fatma M. Seleem 1Department of Water Relations and Field Irrigation, National Research Centre, Dokki, Cairo, Egypt Department of 2Ornamental Horticulture, Horticulture Research Centre, Cairo, Egypt. *Correspondence: [email protected] Accepted: 12 Apr 2019 Published online 09 May. 2019 Water is a key factor for plant growth and development. Plants need an adequate amount of soil moisture for their optimum growth and yield. It plays very important role in building up plant metabolism. Soil amendment is one of the important methods that use to overcome water stress conditions. Biochar has been the most amendment, which used due to its potential role in many fields such as increasing microbial activity, better crop yield, C sequestration and increasing soil carbon. In the present study, two field experiments were established at the Experimental Farm of El-Kassasin Horticultural Research Station, Ismailia Governorate, Egypt, during the two successive seasons of 2015/2016 and 2016/2017.The objective of this research was to determine the effect of three soil moisture levels (W1=50, W2=35 andW3= 20% depletion of the available soil water) and three amounts of biochar (Bio1= 0.5, Bio2= 1and Bio3=1.5 ton biochar/fed) on growth and flowering characters as well as some biochemical characters of Dimorphotheca ecklonis (cape marigold) plant. -

Filipe Aragão Lima, José Fabrício De Lima Silva
CURSO DE AGRONOMIA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE MARGARIDA-AFRICANA (DIMORPHOTHECA ECKLONIS ) EM DIFERENTES PERÍODOS DE ARMAZENAMENTO ASSESSMENT OF THE PHYSIOLOGICAL QUALITY OF AFRICAN-DAISY (DIMORPHOTHECA ECKLONIS ) SEEDS IN DIFFERENT STORAGE PERIODS Como citar esse artigo: Filipe Aragão Lima Lima FA, Silva JFL, Maximiano CV. Avaliação da qualidade fisiológica de sementes de margarida-africana (DIMORPHOTHECA ECKLONIS) em diferentes períodos de José Fabrício de Lima Silva armazenamento. Anais do 13 Simpósio de TCC e 6 Seminário de IC da Faculdade ICESP. 2018(13); 258-264 Christian Viterbo Maximiano Resumo A margarida-africana (Dimorphotheca ecklonis ) é uma cultura que possui um grande potencial econômico como planta ornamental, visto que a floricultura tem se mostrado um mercado em expansão no Brasil. Este trabalho teve como objetivo central avaliar a qualidade fisiológica das sementes de margarida-africana ( Dimorphotheca ecklonis ) em diferentes períodos de armazenamento. O presente trabalho foi conduzido no laboratório de análises de sementes da UnB (Universidade de Brasília). Os lotes das sementes utilizadas foram da Feltrin sementes (Industrializada no Brasil) e foram armazenadas sob temperatura controlada de 16 ºC. Foram utilizados no estudo quatro tratamentos, são eles os seguintes grupos de sementes: 2011/2011, 2013/2013, 2014/2015 e testemunha 2018/2018. O lote da testemunha foi o único do estudo não submetido a longos períodos de armazenamento. O delineamento experimental utilizado no experimento foi o DIC (Delineamento Inteiramente Casualizado). Foram realizados os seguintes métodos de avaliação da qualidade fisiológica das sementes: TPG (Teste padrão de germinação), CP (Comprimento de Plântulas), CE (Condutividade elétrica), MS (Massa Seca) e EC (Emergência de plântulas em campo). -
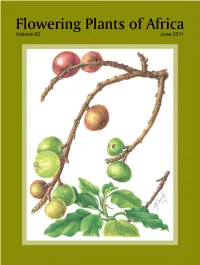
Albuca Spiralis
Flowering Plants of Africa A magazine containing colour plates with descriptions of flowering plants of Africa and neighbouring islands Edited by G. Germishuizen with assistance of E. du Plessis and G.S. Condy Volume 62 Pretoria 2011 Editorial Board A. Nicholas University of KwaZulu-Natal, Durban, RSA D.A. Snijman South African National Biodiversity Institute, Cape Town, RSA Referees and other co-workers on this volume H.J. Beentje, Royal Botanic Gardens, Kew, UK D. Bridson, Royal Botanic Gardens, Kew, UK P. Burgoyne, South African National Biodiversity Institute, Pretoria, RSA J.E. Burrows, Buffelskloof Nature Reserve & Herbarium, Lydenburg, RSA C.L. Craib, Bryanston, RSA G.D. Duncan, South African National Biodiversity Institute, Cape Town, RSA E. Figueiredo, Department of Plant Science, University of Pretoria, Pretoria, RSA H.F. Glen, South African National Biodiversity Institute, Durban, RSA P. Goldblatt, Missouri Botanical Garden, St Louis, Missouri, USA G. Goodman-Cron, School of Animal, Plant and Environmental Sciences, University of the Witwatersrand, Johannesburg, RSA D.J. Goyder, Royal Botanic Gardens, Kew, UK A. Grobler, South African National Biodiversity Institute, Pretoria, RSA R.R. Klopper, South African National Biodiversity Institute, Pretoria, RSA J. Lavranos, Loulé, Portugal S. Liede-Schumann, Department of Plant Systematics, University of Bayreuth, Bayreuth, Germany J.C. Manning, South African National Biodiversity Institute, Cape Town, RSA A. Nicholas, University of KwaZulu-Natal, Durban, RSA R.B. Nordenstam, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden B.D. Schrire, Royal Botanic Gardens, Kew, UK P. Silveira, University of Aveiro, Aveiro, Portugal H. Steyn, South African National Biodiversity Institute, Pretoria, RSA P. Tilney, University of Johannesburg, Johannesburg, RSA E.J. -

1 Recent Incursions of Weeds to Australia 1971
Recent Incursions of Weeds to Australia 1971 - 1995 1 CRC for Weed Management Systems Technical Series No. 3 CRC for Weed Management Systems Technical Series No. 3 Cooperative Research Centre for Weed Management Systems Recent Incursions of Weeds to Australia 1971 - 1995 Convened by R.H. Groves Appendix compiled by J.R. Hosking Established and supported under the Commonwealth Government’s Cooperative Research Centres 2 Program. Recent Incursions of Weeds to Australia 1971 - 1995 CRC for Weed Management Systems Technical Series No.3 January 1998 Groves, R.H. (Richard Harrison) Recent incursions of weeds to Australia 1971 - 1995 ISBN 0 9587010 2 4 1. Weeds - Control - Australia. I. Hosking, J.R. (John Robert). II. Cooperative Research Centre for Weed Management Systems (Australia). III. Title. (Series: CRC for Weed Management Systems Technical Series; No. 3) 632.5 Contact address: CRC for Weed Management Systems Waite Campus University of Adelaide PMB1 Glen Osmond SA 5064 Australia CRC for Weed Management Systems, Australia 1997. The information advice and/or procedures contained in this publication are provided for the sole purpose of disseminating information relating to scientific and technical matters in accordance with the functions of the CRC for Weed Management Systems. To the extent permitted by law, CRC for Weed Management Systems shall not be held liable in relation to any loss or damage incurred by the use and/or reliance upon any information advice and/or procedures contained in this publication. Mention of any product in this publication is for information purposes and does not constitute a recommendation of any such product either expressed or implied by CRC for Weed Management Systems. -

Flore Des Mascareignes (La Réunion, Maurice, Rodrigues)
FLORE DES MASCAREIGNES LA RÉUNION, MAURICE, RODRIGUES 109. COMPOSÉES FLORE DES MASCAREIGNES LA RÉUNION, MAURICE, RODRIGUES COMITÉ DE RÉDACTION J. BOSSER J. GUÉHO, C. JEFFREY 109. COMPOSÉES PRÉPARÉE SOUS LA DIRECTION DE R. ANTOINE J. BOSSER LK. FERGUSON PUBLIÉE PAR THE SUGAR INDUSTRY RESEARCH INSTITUTE, MAURITIUS L'INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT EN COOPÉRATION (ORSTOM), PARIS THE ROYAL BOTANIC GARDENS, KEW Décembre 1993 Mise en page: Renée LECOUFFE 109. COMPOSÉES Photo J. Cylindrocline commersonii Casso Endémique de Maurice. Photo w. Stralnn. Photo 2. Fauj acia salicifolia (Pcrx.) Jeffrey. Endémique de la Réunion. Photo J. Bosser. 109. COMPOSÉES FLORE DES MASCAREIGNES 109. COMPOSÉES par D. J. N. Hind*, C. Jeffrey* et A. J. Scott* Herbes, sous-arbrisseaux, arbrisseaux ou moins souvent arbres, parfois lianes, rarement plantes aquatiques ou épiphytes, parfois plantes succulentes. Tissus à canaux schizogènes résineux ou à laticifères articulés. Très souvent présence de polyfructosanes (en particulier de l'inuline), de polyacétylènes et de lactones ses quiterpéniques; certaines espèces à alcaloïdes pyrrolizidiques. Feuilles alternes ou opposées, rarement verticillées, généralement simples mais souvent lobées ou divi sées. Inflorescence, un capituleentouré par un involucre formé d'une ou de plusieurs séries de bractées protectrices, les capitules solitaires parfois au sommet de tiges aphylles (scapes) ou en petit nombre ou très nombreux en inflorescences cymeuses, ou souvent corymbiformes, de types variés, -

Weed Categories for Natural and Agricultural Ecosystem Management
Weed Categories for Natural and Agricultural Ecosystem Management R.H. Groves (Convenor), J.R. Hosking, G.N. Batianoff, D.A. Cooke, I.D. Cowie, R.W. Johnson, G.J. Keighery, B.J. Lepschi, A.A. Mitchell, M. Moerkerk, R.P. Randall, A.C. Rozefelds, N.G. Walsh and B.M. Waterhouse DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY Weed categories for natural and agricultural ecosystem management R.H. Groves1 (Convenor), J.R. Hosking2, G.N. Batianoff3, D.A. Cooke4, I.D. Cowie5, R.W. Johnson3, G.J. Keighery6, B.J. Lepschi7, A.A. Mitchell8, M. Moerkerk9, R.P. Randall10, A.C. Rozefelds11, N.G. Walsh12 and B.M. Waterhouse13 1 CSIRO Plant Industry & CRC for Australian Weed Management, GPO Box 1600, Canberra, ACT 2601 2 NSW Agriculture & CRC for Australian Weed Management, RMB 944, Tamworth, NSW 2340 3 Queensland Herbarium, Mt Coot-tha Road, Toowong, Qld 4066 4 Animal & Plant Control Commission, Department of Water, Land and Biodiversity Conservation, GPO Box 2834, Adelaide, SA 5001 5 NT Herbarium, Department of Primary Industries & Fisheries, GPO Box 990, Darwin, NT 0801 6 Department of Conservation & Land Management, PO Box 51, Wanneroo, WA 6065 7 Australian National Herbarium, GPO Box 1600, Canberra, ACT 2601 8 Northern Australia Quarantine Strategy, AQIS & CRC for Australian Weed Management, c/- NT Department of Primary Industries & Fisheries, GPO Box 3000, Darwin, NT 0801 9 Victorian Institute for Dryland Agriculture, NRE & CRC for Australian Weed Management, Private Bag 260, Horsham, Vic. 3401 10 Department of Agriculture Western Australia & CRC for Australian Weed Management, Locked Bag No. 4, Bentley, WA 6983 11 Tasmanian Museum and Art Gallery, GPO Box 1164, Hobart, Tas. -

The Naturalized Vascular Plants of Western Australia 1
12 Plant Protection Quarterly Vol.19(1) 2004 Distribution in IBRA Regions Western Australia is divided into 26 The naturalized vascular plants of Western Australia natural regions (Figure 1) that are used for 1: Checklist, environmental weeds and distribution in bioregional planning. Weeds are unevenly distributed in these regions, generally IBRA regions those with the greatest amount of land disturbance and population have the high- Greg Keighery and Vanda Longman, Department of Conservation and Land est number of weeds (Table 4). For exam- Management, WA Wildlife Research Centre, PO Box 51, Wanneroo, Western ple in the tropical Kimberley, VB, which Australia 6946, Australia. contains the Ord irrigation area, the major cropping area, has the greatest number of weeds. However, the ‘weediest regions’ are the Swan Coastal Plain (801) and the Abstract naturalized, but are no longer considered adjacent Jarrah Forest (705) which contain There are 1233 naturalized vascular plant naturalized and those taxa recorded as the capital Perth, several other large towns taxa recorded for Western Australia, com- garden escapes. and most of the intensive horticulture of posed of 12 Ferns, 15 Gymnosperms, 345 A second paper will rank the impor- the State. Monocotyledons and 861 Dicotyledons. tance of environmental weeds in each Most of the desert has low numbers of Of these, 677 taxa (55%) are environmen- IBRA region. weeds, ranging from five recorded for the tal weeds, recorded from natural bush- Gibson Desert to 135 for the Carnarvon land areas. Another 94 taxa are listed as Results (containing the horticultural centre of semi-naturalized garden escapes. Most Total naturalized flora Carnarvon). -

Tribu Cardueae Hurrell, Julio Alberto Plantas Cultivadas De La Argen
FamiliaFamilia Asteraceae Asteraceae - Tribu- Tribu Calenduleae Cardueae Hurrell, Julio Alberto Plantas cultivadas de la Argentina : asteráceas-compuestas / Julio Alberto Hurrell ; Néstor D. Bayón ; Gustavo Delucchi. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Hemisferio Sur, 2017. 576 p. ; 24 x 17 cm. ISBN 978-950-504-634-8 1. Cultivo. 2. Plantas. I. Bayón, Néstor D. II. Delucchi, Gustavo III. Título CDD 580 © Editorial Hemisferio Sur S.A. 1a. edición, 2017 Pasteur 743, C1028AAO - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Telefax: (54-11) 4952-8454 e-mail: [email protected] http//www.hemisferiosur.com.ar Reservados todos los derechos de la presente edición para todos los países. Este libro no se podrá reproducir total o parcialmente por ningún método gráfico, electrónico, mecánico o cualquier otro, incluyendo los sistemas de fotocopia y fotoduplicación, registro magnetofónico o de alimentación de datos, sin expreso consentimiento de la Editorial. Hecho el depósito que prevé la ley 11.723 IMPRESO EN LA ARGENTINA PRINTED IN ARGENTINA ISBN 978-950-504-634-8 Fotografías de tapa (Pericallis hybrida) y contratapa (Cosmos bipinnatus) por Daniel H. Bazzano. Esta edición se terminó de imprimir en Gráfica Laf S.R.L., Monteagudo 741, Villa Lynch, San Martín, Provincia de Buenos Aires. Se utilizó para su interior papel ilustración de 115 gramos; para sus tapas, papel ilustración de 300 gramos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Septiembre de 2017. 152 Plantas cultivadas de la Argentina Plantas cultivadas de la Argentina Asteráceas (= Compuestas) Julio A. Hurrell Néstor D. Bayón Gustavo Delucchi Editores Editorial Hemisferio Sur Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2017 153 FamiliaFamilia Asteraceae Asteraceae - Tribu- Tribu Calenduleae Cardueae Autores María B. -
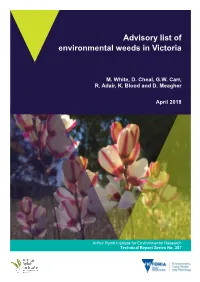
Technical Report Series No. 287 Advisory List of Environmental Weeds in Victoria
Advisory list of environmental weeds in Victoria M. White, D. Cheal, G.W. Carr, R. Adair, K. Blood and D. Meagher April 2018 Arthur Rylah Institute for Environmental Research Technical Report Series No. 287 Arthur Rylah Institute for Environmental Research Department of Environment, Land, Water and Planning PO Box 137 Heidelberg, Victoria 3084 Phone (03) 9450 8600 Website: www.ari.vic.gov.au Citation: White, M., Cheal, D., Carr, G. W., Adair, R., Blood, K. and Meagher, D. (2018). Advisory list of environmental weeds in Victoria. Arthur Rylah Institute for Environmental Research Technical Report Series No. 287. Department of Environment, Land, Water and Planning, Heidelberg, Victoria. Front cover photo: Ixia species such as I. maculata (Yellow Ixia) have escaped from gardens and are spreading in natural areas. (Photo: Kate Blood) © The State of Victoria Department of Environment, Land, Water and Planning 2018 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Australia licence. You are free to re-use the work under that licence, on the condition that you credit the State of Victoria as author. The licence does not apply to any images, photographs or branding, including the Victorian Coat of Arms, the Victorian Government logo, the Department of Environment, Land, Water and Planning logo and the Arthur Rylah Institute logo. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/au/deed.en Printed by Melbourne Polytechnic, Preston Victoria ISSN 1835-3827 (print) ISSN 1835-3835 (pdf)) ISBN 978-1-76077-000-6 (print) ISBN 978-1-76077-001-3 (pdf/online) Disclaimer This publication may be of assistance to you but the State of Victoria and its employees do not guarantee that the publication is without flaw of any kind or is wholly appropriate for your particular purposes and therefore disclaims all liability for any error, loss or other consequence which may arise from you relying on any information in this publication. -
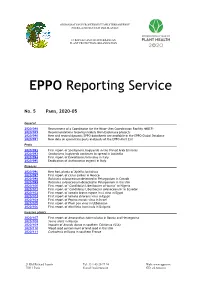
EPPO Reporting Service
ORGANISATION EUROPEENNE ET MEDITERRANEENNE POUR LA PROTECTION DES PLANTES EUROPEAN AND MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION EPPO Reporting Service NO. 5 PARIS, 2020-05 General 2020/088 Recruitment of a Coordinator for the Minor Uses Coordination Facility (MUCF) 2020/089 Recommendations to policy makers from Euphresco projects 2020/090 New and revised dynamic EPPO datasheets are available in the EPPO Global Database 2020/091 New data on quarantine pests and pests of the EPPO Alert List Pests 2020/092 First report of Spodoptera frugiperda in the United Arab Emirates 2020/093 Spodoptera frugiperda continues to spread in Australia 2020/094 First report of Euwallacea fornicatus in Italy 2020/095 Eradication of Anthonomus eugenii in Italy Diseases 2020/096 New host plants of Xylella fastidiosa 2020/097 First report of citrus canker in Mexico 2020/098 Ralstonia solanacearum detected in Pelargonium in Canada 2020/099 Ralstonia solanacearum detected in Pelargonium in the USA 2020/100 First report of ‘Candidatus Liberibacter africanus’ in Nigeria 2020/101 First report of ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ in Ecuador 2020/102 First report of tomato brown rugose fruit virus in Egypt 2020/103 First report of tomato chlorosis virus in Egypt 2020/104 First report of Pepino mosaic virus in Israel 2020/105 First report of Plum pox virus in Uzbekistan 2020/106 First report of Monilinia fructicola in Bulgaria Invasive plants 2020/107 First report of Amaranthus tuberculatus in Bosnia and Herzegovina 2020/108 Senna alata in Mexico 2020/109 Impacts of Arundo donax in southern California (USA) 2020/110 Weed seed contaminant of bird seed in the USA 2020/111 Cortaderia selloana in southern France 21 Bld Richard Lenoir Tel: 33 1 45 20 77 94 Web: www.eppo.int 75011 Paris E-mail: [email protected] GD: gd.eppo.int EPPO Reporting Service 2020 no. -

Checklist of the Vascular Plants of San Diego County 5Th Edition
cHeckliSt of tHe vaScUlaR PlaNtS of SaN DieGo coUNty 5th edition Pinus torreyana subsp. torreyana Downingia concolor var. brevior Thermopsis californica var. semota Pogogyne abramsii Hulsea californica Cylindropuntia fosbergii Dudleya brevifolia Chorizanthe orcuttiana Astragalus deanei by Jon P. Rebman and Michael G. Simpson San Diego Natural History Museum and San Diego State University examples of checklist taxa: SPecieS SPecieS iNfRaSPecieS iNfRaSPecieS NaMe aUtHoR RaNk & NaMe aUtHoR Eriodictyon trichocalyx A. Heller var. lanatum (Brand) Jepson {SD 135251} [E. t. subsp. l. (Brand) Munz] Hairy yerba Santa SyNoNyM SyMBol foR NoN-NATIVE, NATURaliZeD PlaNt *Erodium cicutarium (L.) Aiton {SD 122398} red-Stem Filaree/StorkSbill HeRBaRiUM SPeciMeN coMMoN DocUMeNTATION NaMe SyMBol foR PlaNt Not liSteD iN THE JEPSON MANUAL †Rhus aromatica Aiton var. simplicifolia (Greene) Conquist {SD 118139} Single-leaF SkunkbruSH SyMBol foR StRict eNDeMic TO SaN DieGo coUNty §§Dudleya brevifolia (Moran) Moran {SD 130030} SHort-leaF dudleya [D. blochmaniae (Eastw.) Moran subsp. brevifolia Moran] 1B.1 S1.1 G2t1 ce SyMBol foR NeaR eNDeMic TO SaN DieGo coUNty §Nolina interrata Gentry {SD 79876} deHeSa nolina 1B.1 S2 G2 ce eNviRoNMeNTAL liStiNG SyMBol foR MiSiDeNtifieD PlaNt, Not occURRiNG iN coUNty (Note: this symbol used in appendix 1 only.) ?Cirsium brevistylum Cronq. indian tHiStle i checklist of the vascular plants of san Diego county 5th edition by Jon p. rebman and Michael g. simpson san Diego natural history Museum and san Diego state university publication of: san Diego natural history Museum san Diego, california ii Copyright © 2014 by Jon P. Rebman and Michael G. Simpson Fifth edition 2014. isBn 0-918969-08-5 Copyright © 2006 by Jon P. -

Studies on Tolerance of Some Ornamental Plants to Soil Pollution with Some Combinations of Heavy Metals
Middle East Journal of Agriculture Volume : 06 | Issue : 03 | July-Sept. | 2017 Research Pages:819-827 ISSN 2077-4605 Studies on tolerance of some ornamental plants to soil pollution with some combinations of heavy metals. I. The European black elderberry (Sambucus nigra L.) 1Emam S. Nofal, 2Sayed M. Shahin, 1Ahmed M. El-Tarawy and 2Sohair H. M. Omar 1Hort. Dept., Fac. Agric., Kafr El-Sheikh Univ., Egypt. 2Botanic Gards. Res. Dept., Hort. Res. Inst., ARC, Giza, Egypt. Received: 15 July 2017 / Accepted: 30 August 2017 / Publication date: 17 Sept. 2017 ABSTRACT This investigation was performed under the full sun at Orman Botanical Garden, Giza, Egypt during 2015 and 2016 seasons to reveal the response of one-year-old transplants of black elderberry (Sambucus nigra L.) grown in 20-cm-diameter polyethylene black bags filled with about 3 kg/bag of an equal mixture of sand and clay (1:1, v/v) to toxicity of lead (Pb), cadmium (Cd) and nickel (Ni) when added as acetates to the soil mixture in combinations at concentrations of 00.00 ppm for each metal as a control, 500 ppm Pb + 50 ppm Cd + 25 ppm Ni for combination number one (T1) and 2-, 3- and 4- fold of these concentrations for combinations number two (T2), three (T3) and four (T4), respectively. The results of this experiment showed that no mortality was occurred among the plants, as the survival % was 100 % for plants cultivated in unpolluted or polluted soil. However, a progressive reduction in the means of top and root growth traits was observed as the concentration of the three heavy metals was increased to reach the minimal values by T3 and T4 combinations, with the inferiority of T4 one which gave the least records at all in both seasons.