BEAT FURRER Phaos (2006) Für Orchester 15'
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
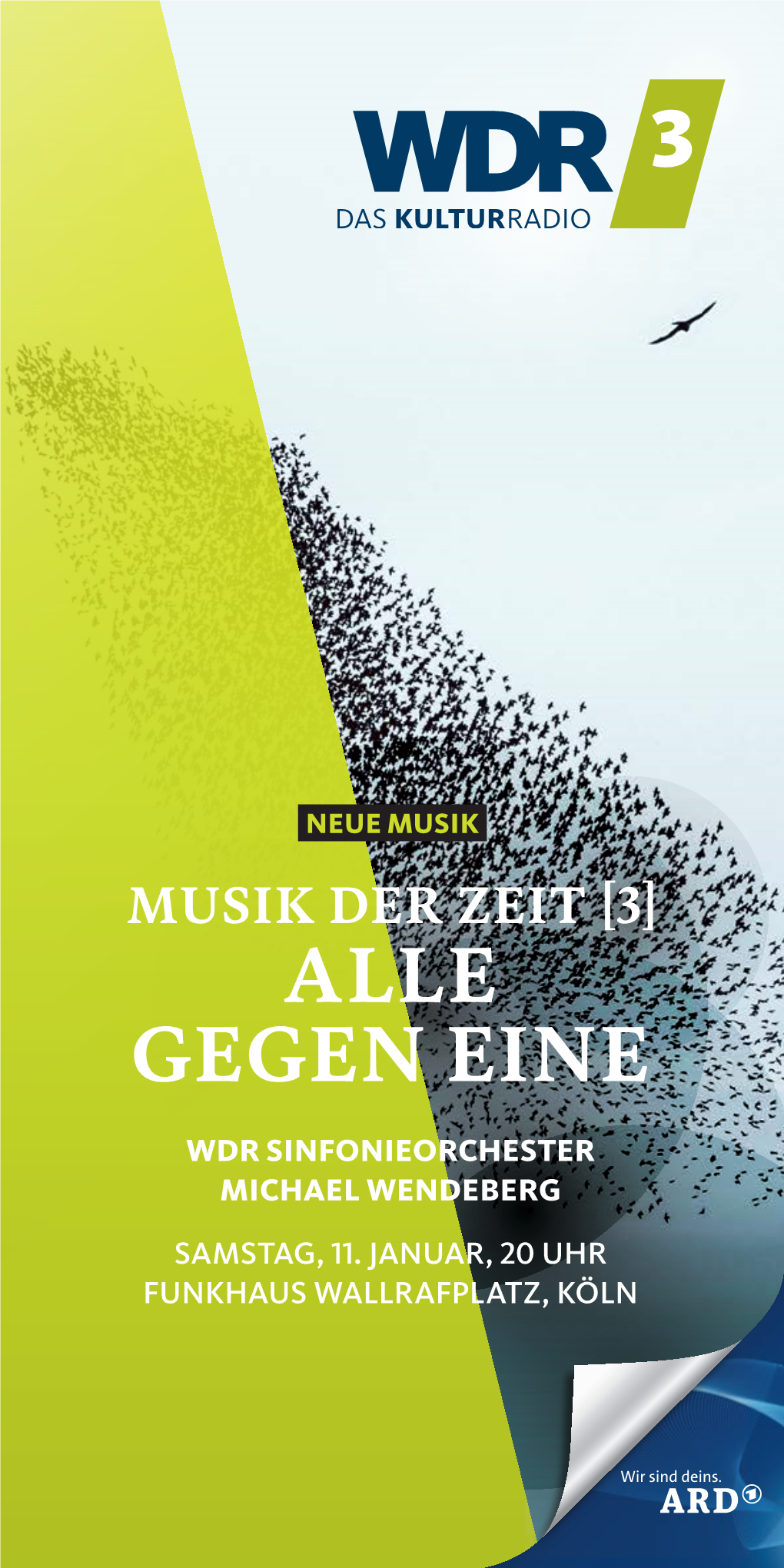
Load more
Recommended publications
-

Klsp2018iema Broschuere.Indd
KLANGSPUREN SCHWAZ INTERNATIONAL ENSEMBLE MODERN ACADEMY IN TIROL. REBECCA SAUNDERS COMPOSER IN RESIDENCE. 15TH EDITION 29.08. – 09.09.2018 KLANGSPUREN INTERNATIONAL ENSEMBLE MODERN ACADEMY 2018 KLANGSPUREN SCHWAZ is celebrating its 25th anniversary in 2018. The annual Tyrolean festival of contemporary music provides a stage for performances, encounters, and for the exploration and exchange of new musical ideas. With a different thematic focus each year, KLANGSPUREN aims to present a survey of the fascinating, diverse panorama that the music of our time boasts. KLANGSPUREN values open discourse, participation, and partnership and actively seeks encounters with locals as well as visitors from abroad. The entire beautiful region of Tyrol unfolds as the festival’s playground, where the most cutting-edge and modern forms of music as well as many young composers and musicians are presented. On the occasion of its own milestone anniversary – among other anniversaries that KLANGSPUREN SCHWAZ 2018 will be celebrating this year – the 25th edition of the festival has chosen the motto „Festivities. Places.“ (in German: „Feste. Orte.“). The program emphasizes projects and works that focus on aspects of celebrations, festivities, rituals, and events and have a specific reference to place and situation. KLANGSPUREN INTERNATIONAL ENSEMBLE MODERN ACADEMY is celebrating its 15th anniversary. The Academy is an offshoot of the renowned International Ensemble Modern Academy (IEMA) in Frankfurt and was founded in the same year as IEMA, in 2003. The Academy is central to KLANGSPUREN and has developed into one of the most successful projects of the Tyrolean festival for new music. The high standards of the Academy are vouched for by prominent figures who have acted as Composers in Residence: György Kurtág, Helmut Lachenmann, Steve Reich, Benedict Mason, Michael Gielen, Wolfgang Rihm, Martin Matalon, Johannes Maria Staud, Heinz Holliger, George Benjamin, Unsuk Chin, Hans Zender, Hans Abrahamsen, Wolfgang Mitterer, Beat Furrer, Enno Poppe, and most recently in 2017, Sofia Gubaidulina. -

Diana Soh Composer
Diana Soh Composer Described as “a composer to follow” (France Musique), Diana Soh is one of today’s most exciting young artists. A multi- disciplinary Singaporean composer based in Paris, she has written for a wide range of instrumentation from chamber music, to orchestra, dance, film, choral and vocal music, and multi-media site-specific works. Diana’s musical interest is directed at exploring performance interactivity as well as obtaining specific sound colours from the intimate collaboration with performers. Known for integrating the use of technology and interested in theatre, she often surprises her audiences and finds ways to address social issues of our times in her work and “composes the impossible” (Concert Classic). Notable highlights include A is for Aiyah with soprano Elise Chauvin as the soloist, which was premiered in Singapore by the Singapore Symphony Orchestra (2018) as well as her string quartet sssh by the Mettis Quartet at the Aix en Provence Festival (2018). Her upcoming seasons see her venturing into the music theatre world with 2 operas: Façon Tragique de Tuer une Femme which will be premiered in 2023, and The Carmen Case the season after. Her adventure in vocal writing continues with a mono-drama for Opera de Lyon and a commission from the Maîtrise de Radio France, Parisce and a solo voice piece titled La Ville-Zizi. In addition, of smaller things will be presented in Austria by Schallfeld Ensemble in 2021 and Of the spaces between by Ensemble Æquilibrium in Singapore in 2022. Since establishing herself in Paris, Diana was Composer-in-Residence for 2 years (2012 / 2013) at the National Centre for Creation - La Muse en Circuit, concluded with a one-hour monographic concert of her works during the 2013 Festival Extension. -
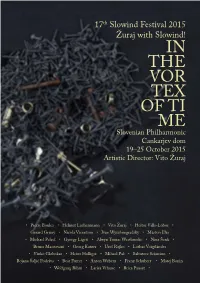
In the Vor Tex of Ti Me
17th Slowind Festival 2015 Žuraj with Slowind! IN THE VOR TEX OF TI Slovenian PhilharmonicME Cankarjev dom 19–25 October 2015 Artistic Director: Vito Žuraj • Pierre Boulez • Helmut Lachenmann • Vito Žuraj • Heitor Villa-Lobos • Gérard Grisey • Nicola Vicentino • Ivan Wyschnegradsky • Márton Illés • Michael Pelzel • György Ligeti • Alwyn Tomas Westbrooke • Nina Šenk • Bruno Mantovani • Georg Katzer • Uroš Rojko • Lothar Voigtländer • Vinko Globokar • Heinz Holliger • Mihael Paš • Salvatore Sciarrino • Bojana Šaljić Podešva • Beat Furrer • Anton Webern • Franz Schubert • Matej Bonin • Wolfgang Rihm • Larisa Vrhunc • Brice Pauset • Valued Listeners, It is no coincidence that we in Slowind decided almost three years ago to entrust the artistic direction of our festival to the penetrating, successful and (still) young composer Vito Žuraj. And it is precisely in the last three years that Vito has achieved even greater success, recently being capped off with the prestigious Prešeren Fund Prize in 2014, as well as a series of performances of his compositions at a diverse range of international music venues. Vito’s close collaboration with composers and performers of various stylistic orientations was an additional impetus for us to prepare the Slowind Festival under the leadership of a Slovenian artistic director for the first time! This autumn, we will put ourselves at the mercy of the vortex of time and again celebrate to some extent. On this occasion, we will mark the th th 90 birthday of Pierre Boulez as well as the 80 birthday of Helmut Lachenmann and Georg Katzer. In addition to works by these distinguished th composers, the 17 Slowind Festival will also present a range of prominent composers of our time, including Bruno Mantovani, Brice Pauset, Michael Pelzel, Heinz Holliger, Beat Furrer and Márton Illés, as well as Slovenian composers Larisa Vrhunc, Nina Šenk, Bojana Šaljić Podešva, Uroš Rojko, and Matej Bonin, and, of course, the festival’s artistic director Vito Žuraj. -

0012322KAI.Pdf
BEAT FURRER (*1954) 1 Aria 13:54 for soprano and ensemble (1998-99) 2 Solo 22:46 for violoncello (2000) 3 Gaspra 15:45 for ensemble (1988) TT: 52:52 Petra Hoffmann, soprano Lucas Fels, violoncello ensemble recherche Coverfoto: © Philippe Gontier 2 ensemble recherche Martin Fahlenbock flute 3 Shizuyo Oka clarinet 1 , 3 Melise Melliger violin 1 , 3 Barbara Maurer viola 1 , 3 Lucas Fels violoncello 1 , 3 Christian Dierstein percussion 1 , 3 Klaus Steffes-Holländer piano 1 , 3 3 4 Björn Gottstein dich, nach den Wohnungen der Menschen, nach „Stimme – Zentrum des Klanges ...“ der tröstlichen Sprache des Windes im Geäst, ebenso wie es mich gelüstet. Höre nicht auf dein Das Ohr auf den Schreibtisch legen. Mit einem Herz und verstopfe mit Wachs deine Ohren, – denn Bleistift eine kreisende Bewegung auf der Holzplatte nie wirst du das erreichen, was du ersehnst. Nicht nachzeichnen. Den Veränderungen des kreiselnden hier und nirgendwo. Aber geh weiter, kehre nie Rauschklangs nachhorchen. Oder: Einen Ton zurück! Deine Einsamkeit verdoppelt die meine.“ auf der Geige spielen. Den Bogen langsam (nach Günter Eich Geh nicht nach El Kuhwehd) zum Steg führen. Den Ton zum Geräuschklang Die Protagonistin trennt und löst sich in diesem modulieren. Die Bewegungsmodelle, mit denen kurzen Text – Furrer nennt ihn „einen Ab- Beat Furrer arbeitet, sind einfach und vertraut. Es schiedsbrief“ – von ihrem Geliebten. Sie vollzieht sind musikalische Gesten, die einer alltäglichen den Prozess von unmittelbarer Nähe bis zur Handbewegung gleichen. Für sich genommen vollständigen Isolation. Diese Entwicklung wird erzählen diese Gesten nichts. Wo sie aber, in Aria zunächst und vor allem in der Vokalpartie wie in Aria, in einen szenisch-dramatischen greifbar. -

Alarm Will Sound Mizzou New Music Eight World Premieres Mizzou
Mizzou International Composers Festival July 21-26, 2014 Photo Credit: Carl Socolow Alarm Will Sound Mizzou New Music Eight World Premieres Mizzou International Composers Festival July 22 – 27, 2013 <AWS Photo> <Use individual primary color boxes for each event like the poster>We’re Blazing New Trails with Alarm Will Sound the Hottest New Music… !ursday, July 25, 2013 * 7:30 PM Missouri !eatre All Thanks to Your Cool Support Mizzou New Music Ensemble Friday, July 26, 2013 * 7:30 PM Missouri !eatre Eight World Premieres Saturday, July 27, 2013 *7:30 PM Missouri !eatre Congratulations and many thanks to Dr. Jeanne and Rex SLAY & Sinquefield, Sinquefield Charitable Foundation and the ASSOCIATES University of Missouri – Columbia for their www.slayandassociates.com vision and commitment in bringing this festival to Missouri. 2014 Mizzou International Composers Festival +VMZ t'FTUJWBM4DIFEVMF .POEBZ +VMZ 9:00 AM-12:00 PM: Fine Arts Building Room 145 on the MU Campus – Resident Composer Presentations – Open to the Public 1:30 PM-3:30 PM: Fine Arts Building Room 145 on the MU Campus – Resident Composer Presentations – Open to the Public 5VFTEBZ +VMZ 9:00 AM-12:00 PM: Missouri !eatre – Alarm Will Sound Rehearsal – Open to the Public 1:30 PM-4:30 PM: Fine Arts Building Room 145 on the MU Campus – Resident Composer Presentations – Open to the Public 7:00 PM: Fine Arts Building Room 145 on the MU Campus – Nico Muhly, Guest Composer Presentation – Open to the Public 8:30 PM: Fine Arts Building Room 145 on the MU Campus – Stefan Freund, MU Faculty Composer Presentation – Open to the Public 8FEOFTEBZ +VMZ 1:30 PM-4:30 PM: Missouri !eatre – Alarm Will Sound Rehearsal – Open to the Public 7:00 PM: Fine Arts Building Room 145 on the MU Campus – Zhou Long, Guest Composer Presentation – Open to the Public 8:30 PM: Fine Arts Building Room 145 on the MU Campus – W. -

Ensemble Intercontemporain Matthias Pintscher, Music Director
Friday, November 6, 2015, 8pm Hertz Hall Ensemble intercontemporain Matthias Pintscher, Music Director PROGRAM Marco Stroppa (b. 1959) gla-dya. Études sur les rayonnements jumeaux (2006–2007) 1. Languido, lascivo (langoureux, lascif) 2. Vispo (guilleret) 3. Come una tenzone (comme un combat) 4. Lunare, umido (lunaire, humide) 5. Scottante (brûlant) Jens McManama, horn Jean-Christophe Vervoitte, horn Frank Bedrossian (b. 1971) We met as Sparks (2015) United States première Emmanuelle Ophèle, bass flute Alain Billard, contrabass clarinet Odile Auboin, viola Éric-Maria Couturier, cello 19 PROGRAM Beat Furrer (b. 1954) linea dell’orizzonte (2012) INTERMISSION Kurt Hentschläger (b. 1960)* Cluster.X (2015) Edmund Campion (b. 1957) United States première Kurt Hentschläger, electronic surround soundtrack and video Edmund Campion, instrumental score and live processing Jeff Lubow, software (CNMAT) * Audiovisual artist Kurt Hentschläger in collaboration with composer Edmund Campion. Ensemble intercontemporain’s U.S. tour is sponsored by the City of Paris and the French Institute. Additional support is provided by the FACE Foundation Contemporary Music Fund. This performance is made possible, in part, by Patron Sponsor Ross Armstrong, in memory of Jonas (Jay) Stern. Hamburg Steinway piano provided by Steinway & Sons of San Francisco. Cal Performances’ – season is sponsored by Wells Fargo. PLAYBILL ORCHESTRA ROSTER ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN Emmanuelle Ophèle flute, bass flute Didier Pateau oboe Philippe Grauvogel oboe Jérôme Comte clarinet Alain -
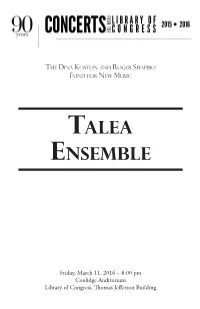
Talea Ensemble
THE DINA KOSTON AND ROGER SHAPIRO fUND fOR nEW mUSIC TALEA ENSEMBLE Friday, March 11, 2016 ~ 8:00 pm Coolidge Auditorium Library of Congress, Thomas Jefferson Building THE DINA KOSTON AND ROGER SHAPIRO FUND FOR NEW MUSIC Endowed by the late composer and pianist Dina Koston (1929-2009) and her husband, prominent Washington psychiatrist Roger L. Shapiro (1927-2002), the DINA KOSTON AND ROGER SHAPIRO FUND FOR NEW MUSIC supports commissions and performances of contemporary music. "LIKE" us at facebook.com/libraryofcongressperformingarts loc.gov/concerts The commissions and premieres on this evening's program will be available at q2music.org/libraryofcongress, as part of the ongoing collaboration between the Library of Congress and Q2 Music. Please request ASL and ADA accommodations five days in advance of the concert at 202-707-6362 or [email protected]. Latecomers will be seated at a time determined by the artists for each concert. Children must be at least seven years old for admittance to the concerts. Other events are open to all ages. • Please take note: Unauthorized use of photographic and sound recording equipment is strictly prohibited. Patrons are requested to turn off their cellular phones, alarm watches, and any other noise-making devices that would disrupt the performance. Reserved tickets not claimed by five minutes before the beginning of the event will be distributed to stand-by patrons. Please recycle your programs at the conclusion of the concert. The Library of Congress Coolidge Auditorium Friday, March 11, 2016 — 8:00 pm THE DINA KOSTON AND ROGER SHAPIRO fUND fOR nEW mUSIC TALEA ENSEMBLE BARRY CRAWFORD, FLUTE STUART BRECZINSKI, oBOE MARIANNE GYTHFELDT, cLARINET RANE MOORE, cLARINET ADRIAN MOREJON, bASSOON JOHN GATTIS, hORN ERIK CARLSON, vIOLIN LAUREN CAULEY, vIOLIN ELIZABETH WEISSER, vIOLA CHRIS GROSS, cELLO GREG CHUDZIK, dOUBLE bASS STEPHEN GOSLING, pIANO ALEX LIPOWSKI, pERCUSSION MATTHEW GOLD, pERCUSSION NUIKO WADDEN, hARP DAVID ADAMCYK, eLECTRONICS JANE SHELDON, sOPRANO JAMES BAKER, cONDUCTOR 1 Program ANTHONY CHEUNG (b. -

Michael Pelzel Is a Composer and Organist. He Was Born in Rapperswil (Switzerland) in 1978
Michael Pelzel is a composer and organist. He was born in Rapperswil (Switzerland) in 1978. After passing his school-leaving exam “Matura” at the Canton school of Wattwil, from 1998 to 2009 he went on to study at the Lucerne, Basel, Stuttgart, Berlin and Karlsruhe academies of music. Amongst other things, he studied piano under Ivan Klánsky, organ under Jakob Wittwer, Martin Sander, Ludger Lohmann and Guy Bovet and composition under Dieter Ammann, Detlev Müller- Siemens, Georg-Friedrich Haas, Hanspeter Kyburz and Wolfgang Rihm as well as music theory under Roland Moser and Balz Trümpy. He attended various composition master classes given by Tristan Murail, Beat Furrer, Michaël Jarrell, Klaus Huber, Brian Ferneyhough, György Kurtàg and Helmut Lachenmann. From 2004 to 2010 he attended the Darmstadt Summer Courses, as well as masterclasses at the Acanthes Festival in Metz and Royaumont Festival in Paris and was a member of Akademie Musiktheater heute. As an organist Pelzel was hosted at various churches and cathedrals, for instance in San Francisco, Los Angeles, Sydney and Cape Town. His compositions are performed by bodies of musicians like ensemble recherche klangforum wien, quatuor diotima, Arditti Quartet, ensemble intercontemporain or the Symphony Orchestra of the Bavaria Broadcasting Corporation. His works are played at festivals like the Darmstadt Summer Courses for New Music, Donaueschingen Music Festival, Wien Modern, Klangspuren (Schwaz, Tyrol), Tremplin (Paris), Lucerne Festival and Art on Main (Johannesburg). He also teaches music theory at music academies and holds composition workshops at the University of the Witwatersrand in Johannesburg (South Africa). He has received numerous prizes and awards. -

Erinnerungen an Herbert Von Karajan
DailyNr. 18, 15./16. August 2008 Erinnerungen an Herbert von Karajan Geheimnisse eines Großen SALZBURGER FESTSPIELE 2008 Herbert von Karajan,Herbert von Foto: S. Institut Karajan und Herbert Lauterwasser / Eliette von SALZBURGER FESTSPIELE 2008 Daily Nr. 18, 15./16. August 2008 auberflöten-Freuden. Riccardo Muti und sein Team flatterten beschwingt nach der bejubel- ten Premiere von Mozarts Zauberflöte nur wenige Meter Luftlinie weiter. Im Stiftskeller ZSt. Peter war der Tisch gedeckt. Die Gäste erwartete ein mindestens so reiches Mahl wie den unglücklichen Papageno auf der Suche nach seinem Weibchen. Und so wie die Zauberflöte ein Teil der Salzburger Identität ist, gehört auch der bereits im Jahr 803 erwähnte Stiftskeller zu den tra- ditionsreichen und gerne besuchten Institutionen der Stadt. Koch und Mundschenk machten ihre Sache jedenfalls gut. Sänger und Musiker erholten sich somit rasch von überstandenen Feuer- und Wasserproben, die sie in den herrlich farbenfrohen Bühnenbildern des großen, 2006 verstor- benen Karel Appel und unter Anleitung von Regisseur Pierre Audi zu bestehen hatten. Auch wenn es am Ende der Zauberflöte heißt: „Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht“, hielt das bunte Zauberflöten-Ensemble dann trotzdem nicht bis zum Morgengrauen durch. he Joys of Die Zauberflöte. After the celebrated premiere of Mozart’s Zauberflöte, Riccardo Muti and his team alighted cheerfully just a few meters down the road. The tables had been set Tat the Stiftskeller St. Peter. The guests were greeted by a meal at least as sumptuous as the one offered to the unhappy Papageno in search of his wife. And just as Die Zauberflöte is part of Salz- burg’s identity, the Stiftskeller, first mentioned in records in 803, is one of the most traditional and popular institutions of the city. -

Felix Mendelssohn Bartholdy Dafür Danken, Dass Er Bach Wieder Entdeckt Hat.«
leidenschaft hat viele stimmen. chor des bayerischen rundfunks 2018|2019 chor des bayerischen rundfunks 2018|2019 Abonnementkonzerte Konzerte mit den Orchestern des Bayerischen Rundfunks Gastkonzerte Mariss Jansons chefdirigent Howard Arman künstlerischer leiter Susanne Vongries management 9 | Abonnementkonzerte 27 | Weitere Konzerte 63 | Pressestimmen, Besetzung, Chefdirigent, Künstlerischer Leiter, CDs 83 | Abonnements, Kartenvorverkauf, Sitzpläne Chor des Bayerischen Rundfunks | Konzertübersicht 2018/2019 Sa 19|05|18 Salzburger Pfingstfestspiele Bruckner | Pange lingua et Tantum ergo Jérémie Rhorer So 03|02|19 München | Herkulessaal Fuoco di gioia! – Große Opernchöre Ivan Repuˇsi´c Mozarteum Brahms | Ein deutsches Requiem Fr 15|02|19 Dresden | Frauenkirche Dvoˇrák | Stabat mater Christoph Eschenbach Fr 22|06|18 Richard-Strauss-Festival Purcell | Dido and Aeneas Alexander Liebreich Do 21|02|19 München | Philharmonie Beethoven | Symphonie Nr. 9 Bernard Haitink Garmisch, Alpspitzhalle Meeres Stille und Glückliche Fahrt Fr 22|02|19 So 22|07|18 Salzburger Festspiele Liszt | Ave verum corpus | Via crucis Howard Arman Mozarteum Sa 23|02|19 Sa 28|07|18 Salzburger Festspiele Mahler | Symphonie Nr. 2 Andris Nelsons Sa 02|03|19 München | Prinzregententheater Abo 4 | Dvoˇrák | Stabat mater (Klavierfass.) Howard Arman Großes Festspielhaus (Auferstehungssymphonie) ˇ So 29|07|18 Cekovská (UA) | Pärt | And I Heard (dt. EA) Fr 08|03|19 München | Herkulessaal musica viva | Porträtkonzert Beat Furrer Rupert Huber Fr 24|08|18 Lucerne Festival im Sommer Ravel | Daphnis et Chloé Riccardo Chailly Peter Rundel Kultur- und Kongresszentrum Debussy | Trois Nocturnes Do 27|09|18 München | Herkulessaal Mendelssohn | Paulus Masaaki Suzuki Do 21|03|19 Rotterdam | De Doelen Schostakowitsch | Symphonie Nr. 13 (Babi Jar) Yannick Nézet-Séguin Fr 28|09|18 Fr 22|03|19 So 30|09|18 Ottobeuren | Basilika Mendelssohn | Paulus Masaaki Suzuki Sa 23|03|19 Paris | Théâtre des Champs-Élysées Do 04|10|18 Katowice (Kattowitz) Szymanowski | Symphonie Nr. -

Rebecca Saunders Awarded Roche Commission to Write New Piano Concerto for Nicolas Hodges
Rebecca Saunders awarded Roche Commission to write new piano concerto for Nicolas Hodges 30 October, Wigmore Hall 12 January, Glasgow City Halls Lutyens, Clarke, ThomallaWORLD PREMIERES Steen-Andersen Piano ConcertoUK PREMIERE 24 November, Lucerne Festival 2 March, Barbican Tsukamoto, Ciurlo, HilliWORLD PREMIERES Ligeti Piano Concerto 29 August 2020, Lucerne Festival Rebecca Saunders Piano ConcertoWORLD PREMIERE On 29 August 2020, the prolific contemporary pianist Nicolas Hodges will inaugurate the world premiere performance of Rebecca Saunders’ Piano Concerto at the Lucerne Festival. Roche, in collaboration with the Lucerne Festival and the Lucerne Festival Academy, has awarded Rebecca Saunders their prestigious Roche Commission to enable her to compose a piano concerto for Hodges, who breaks new ground in 2018-19 with a series of world and UK premieres, including three premieres at the Wigmore Hall on 30 October and the UK premiere of Simon Steen-Andersen’s Piano Concerto on 12 January. The biannual Roche Commissions have previously been awarded to several high-profile composers, including Sir Harrison Birtwistle and Sir George Benjamin. Rather than commissioning works that will cater to mainstream fashions, Roche Commissions enables musical works to venture beyond the conventional and provide intellectual stimulation. Saunders will interact with leading scientists over the following two years and in 2020 the newly-developed commission will be premiered at the Lucerne Summer Festival. With piano soloist Hodges, the work will be performed by the Orchestra of the Lucerne Festival Academy conducted by previous Roche Commissions award-winner Matthias Pintscher. Nicolas Hodges is an ideal collaborator for Saunders’ commission. Never shying away from challenging new writing, Hodges continues to push the boundaries of modern piano music with bold and incisive performances. -

2009) 22:53 Abandoned Time (2004–06
DAI FUJIKURA (*1977) 1 Sparks (2011) 1:25 4 Abandoned Time (2004–06) 8:57 for solo guitar for solo electric guitar and ensembles 281907 2 ice (2009–10) 21:17 5 I dreamed on singing !owers (2012) 4:22 for ensemble for prerecorded electronics 3 Phantom Splinter (2009) 22:53 6 Sparking Orbit (2013) 17:18 for ensemble and live electronics for solo electric guitar and live electronics 120010 International Contemporary Ensemble · Daniel Lippel solo guitar Jayce Ogren · Matthew Ward TT: 1:16:12 9 Recording: 1 Ryan Streber, Daniel Lippel; 2 Ryan Streber, Jacob Greenberg, Dai Fujikura; 0013302KAI 3 Joachim Haas, Thomas Hummel, Teresa Carasco; 4 Ryan Streber DAI FUJIKURA D D D 5 Dai Fujikura; 6 Michael Acker, Dai Fujikura Recording venues: 1, 2 Oktaven Audio, Yonkers, New York, USA; 3, 6 SWR, Freiburg, Germany LC 10488 (EXPERIMENTALSTUDIO of the SWR); 4 Sweeney Auditorium, Smith College, Northampton, Massachusetts, USA Recording dates: 1 17 March 2013; 2 8 June 2012; 3 16–17 March 2011; 4 26 August 2007; 6 28 February 2013 Session Producers: 1 Ryan Streber; 2 Jacob Greenberg; 3 Michael Acker, Dai Fujikura 4 Jacob Greenberg; 6 Dai Fujikura ice Editing producers: 1 Daniel Lippel, 2 Jacob Greenberg; 3 Dai Fujikura; 4 Daniel Lippel; 6 Dai Fujikura, Daniel Lippel Recording engineers: 1, 2, 4 Ryan Streber; 3, 6 Michael Acker Mastering/cut: 1 – 6 Ryan Streber Final mastering: Ryan Streber – Oktaven Audio www.oktavenaudio.com Post production/digital editor: 2, 4°9`HU:[YLILY"3°+HP-\QPR\YH Mix supervision: 2°1HJVI.YLLUILYN+HUPLS3PWWLS"3°+HP-\QPR\YH" 4 Daniel Lippel; 6°+HP-\QPR\YH+HUPLS3PWWLS;OVTHZ/\TTLS Executive Producers: International Contemporary Ensemble (ICE), 0013302KAI Barbara Fränzen, Peter Oswald Includes detailed booklet This recording was made possible through a generous grant from the Augustine Foundation, with texts by Daniel Lippel a foundation committed to the repertoire growth and promotion of the classical guitar.