Bericht Vernetzungsprojekt Bassersdorf, 1. Phase 2016
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
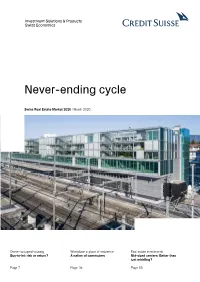
Never-Ending Cycle
Investment Solutions & Products Swiss Economics Never-ending cycle Swiss Real Estate Market 2020 | March 2020 Owner-occupied housing Workplace ≠ place of residence Real estate investments Buy-to-let: risk or return? A nation of commuters Mid-sized centers: Better than just middling? Page 7 Page 18 Page 55 Imprint Publisher: Credit Suisse, Investment Solutions & Products Nannette Hechler-Fayd’herbe Head of Global Economics & Research +41 44 333 17 06 nannette.hechler-fayd’[email protected] Fredy Hasenmaile Head Real Estate Economics +41 44 333 89 17 [email protected] Cover picture Building: Gleis 0, Aarau. Directly next to Aarau railway station: this residential and office building sets ecological, economic and social standards. Building owner: A real estate fund of Credit Suisse Asset Management. Printing FO-Fotorotar, Gewerbestrasse 18, 8132 Egg bei Zürich Copy deadline February 3, 2020 Publication series Swiss Issues Immobilien Orders Directly from your relationship manager, from any branch of Credit Suisse. Electronic copies via www.credit-suisse.com/realestatestudy. Internal orders via MyShop quoting Mat. No. 1511454. Subscriptions quoting publicode ISE (HOST: WR10). Visit our website at www.credit-suisse.com/realestatestudy Copyright The publication may be quoted providing the source is indicated. Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG and/or affiliated companies. All rights reserved. References Unless otherwise specified, the source of all quoted information is Credit Suisse. Authors Fredy Hasenmaile, +41 44 333 89 17, [email protected] Alexander Lohse, +41 44 333 73 14, [email protected] Thomas Rieder, +41 44 332 09 72, [email protected] Dr. -

Gemeinderat Status Öffentlich Stossrichtung 1 Wohnkleinstadt Im Grünen / 3 Verkehrsentlastung
Archiv 37.08 gemeinde bassersdorf Geschäft 2021-060 gemeinderat Status öffentlich Stossrichtung 1 Wohnkleinstadt im Grünen / 3 Verkehrsentlastung Beschluss des Gemeinderates vom 13. April 2021 ZVV-Verbundfahrplan 2022 - 2023 Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auflage vom 8. bis 28. März 2021 Ausgangslage Mit Schreiben vom 8. Februar 2021 wurden die Gemeinden aufgefordert, zum ZVV-Verbundfahrplanprojekt 2022 - 2023 (Fahrplanwechsel per Dezember 2021) zuhanden der marktverantwortlichen Verkehrsunternehmen bis zum 19. April 2021 Stellung zu nehmen. Die öffentliche Auflage erfolgte zwischen dem 8. und 28. März 2021. Änderungsbegehren der Bevölkerung und des Gewerbes waren bis zum 29. März 2021 an die Standortgemeinde zu richten. Änderungen S-Bahnen Die S-Bahnen S7 und S24 erfahren mit vorliegendem Fahrplanprojekt aus Sicht Bassersdorf untergeordnete Ver- änderungen. Der Halt der S7 in Kemptthal wird aus Gründen der Fahrplanstabilität bis 21:00 gestrichen, die S24 übernimmt deren Erschliessungsleistung. Eine weitere Optimierung der S-Bahn-Verbindungen von / nach Zürich und Winterthur ist derzeit nicht geplant (kein "Viertelstundentakt" durch die Zugfolgen S7 und S24 mit passenden Anschlüssen an die IR/IC-Anschlüsse in Zürich / Winterthur resp. Flughafenbahnhof Kloten). Dieses Anliegen wurde dem ZVV mehrmals schon über- mittelt. Die Gemeinde wurde jeweils dahingehend verwiesen, dass Optimierungen möglich sind, wenn der Brüt- tenertunnel in Betrieb genommen sein wird. Erst dann werden auf der Stammlinie Kapazitäten frei für zusätzliche S-Bahnverkehre. Die Nachtzugverbindung SN7 erfährt keine Veränderung. Änderungen Busse Bassersdorf ist vom Fahrplanprojekt 2022 – 2023 im Bereich des Busverkehrs wie folgt betroffen. _ Bus 765 Keine Änderungen Die Umsteigezeiten von / auf die S7 im Bahnhof Bassersdorf betragen rund 5 – 9 Mi- nuten, je nach Tageszeit und Wochentag. -

Angebote Für Eltern Mit Kleinen Kindern Bezirk Bülach
Angebote für Eltern mit kleinen Kindern Bezirk Bülach Oktober 2020 bis September 2021 Liebe Mütter und Väter Sie sind Eltern geworden – zur Geburt Ihres Kindes wünschen wir Ihnen alles Gute! Suchen Sie nach Tipps zur Ernährung, Ent- wicklung und Erziehung Ihres Babys oder Kleinkindes? Möchten Sie sich mit anderen Müttern und Vätern austauschen oder suchen Sie einen Betreuungs- oder Spiel- gruppenplatz? Diese Broschüre verschafft Ihnen einen informativen Überblick über die zahlreichen Möglichkeiten zur Gestaltung des Familien- und Erziehungsalltags. Hier finden Sie In- spiration zu Begegnung, Bildung, Betreuung, Gesundheit und Erziehung Ihrer Kinder. Haben wir etwas übersehen? Wissen Sie von einem neuen Angebot oder gibt es eine Änderung? Wir freuen uns über Ihren Beitrag: [email protected] Freundliche Grüsse Dorothe Wiesendanger, Geschäftsführerin Amt für Jugend und Berufsberatung Geschäftsstelle der Bezirke Bülach und Dielsdorf Information und Beratung Entwicklungs-, Erziehungs- und Familien fragen ab Geburt 4 Erste Wochen mit dem Baby 6 Paarbeziehung 8 Vaterschaft, Unterhalt und elterliche Sorge 8 Weiterführende Links und Angebote für den Erziehungsalltag 9 Angebote für belastende Familiensituationen 10 Angebote für Familien mit knappem Budget 12 Lebensräume für Familien gestalten mithilfe der Gemeinwesenarbeit 13 Begegnung und Austausch Treffpunkte 14 Teilen und Ausleihen 17 Singen, Malen, Basteln 18 Von Eltern mit Eltern 20 Spiel und Bewegung Spielgruppen 21 Spielplätze 26 Schwimmen, Turnen, Tanzen 29 Betreuung und Entlastung Tagesbetreuung (Tageweise Betreuung) 34 Stundenweise Betreuung 39 Unterstützung zu Hause 40 Medizinische Versorgung und Soforthilfe Kinderarzt 42 Notfälle 43 Für Fremdsprachige eignen sich besonders die mit gekennzeichneten Angebote. Information und Beratung Entwicklungs-, Erziehungs- und Familien- fragen ab Geburt Ob Durchschlafprobleme, Trotzalter oder Streit und Eifersucht unter Geschwistern – Eltern sind immer wieder aufs Neue mit allerlei Fra- gen konfrontiert. -

Eine Schweiz, Zwei Welten
Dienstag, 18. Mai 2021 Jahrgang 4 / Nr. 2 / Auflage: 73 000 Exemplare Die offizielle Gewerbezeitung des Bezirksgewerbeverbandes Bülach, Gewerbe- und Industrieverein Bachenbülach, Gewerbeverein Bassersdorf Nürensdorf, Gewerbe Bülach, gewerbe industrie dietlikon, Gewerbeverein Eglisau, Gewerbeverein Embrachertal, Gewerbeverein Höri, Gewerbe Kloten, Gewerbeverein Opfikon-Glattbrugg, Gewerbeverein Wallisellen und Gewerbeverein Winkel. Corona-Pandemie: eine Schweiz, Gewerbe Kloten 4 gewerbeverein opfikon-glattbrugg zwei Welten Gewerbeverein Opfikon-Glattbrugg 5 Es ist schon eine verrückte Zeit, mit sitäten des Staatspersonals wurden an- ganz besonderen Umständen, in der wir scheinend höher gewertet als eine rasche, nun schon seit über einem Jahr leben. mögliche und wirksame Verfügbarkeit Ein kleiner Virus hat die Welt funda- von Impfstoffen. Gewerbeverein Wallisellen 6 mental in Geisselhaft genommen. Der Umgang mit der Pandemie zeigt sich Die Entscheidungen, die getroffen wer- auch auf einer anderen Ebene besorgnis- den, getroffen werden müssen, sind so erregend. Die kommunalen Verwaltun- oder so falsch. So macht es jedenfalls den gen haben sich auf ganz unterschiedliche Anschein, wenn man die Zeitungen liest, Art und Weise auf den Umgang mit der den Parteien zuhört und den Wissen- Bevölkerung und Einwohner eingestellt. Gewerbeverein Bassersdorf Nürensdorf 7 schaftlern Glauben schenken will, wenn Es gibt Gemeinden in unserem Bezirk, in der Bundesrat sich für Verschärfungen, denen es schwieriger geworden ist, in ein Lockerungen, breit abgestützte Tests aus- Gemeindehaus einzutreten, als aus dem spricht. Mit der föderalen Kakofonie von Gefängnis Pöschwies herauszukommen. allen Seiten wird aber klar aufgezeigt, wie Gemeindehäuser wurden zu Bollwerken, divergent in der Schweiz gedacht, gehan- Burgen, regelrechten Hochsicherheits- delt, gefordert oder verboten wird. Viele trakten mit nicht erwünschten Kunden- Gewerbe Bülach 8 vergessen dabei, um was es eigentlich und Einwohnerkontakten. -

Mitteilungen 5/19 Gemeinde Eglisau |
Mitteilungen 5/19 Gemeinde Eglisau | www.eglisau.ch Themenschwerpunkte: Inhalt: Röm. Kath. Kirche 28 Tag der offenen Deponie 3 Editorial 3 Kultur 35 Polit. Gemeinde 5 Senioren 42 Schule 23 Ortsvereine 46 Evang. Ref. Kirche 26 Impressum Herausgeber: Gemeinde Eglisau Redaktion: Gemeindeverwaltung Auflage: 2500 Ex. erscheint 12 x jährlich Fotos: Gemeindeverwaltung/Thomi Heller Layout/Druckdaten: atelierheller.ch Druck: OS Druck Eglisau Gedruckt auf 100 % Altpapier Redaktionsschluss: 17. Mai 2019 Mitteilungen 5/19 Gemeinde Eglisau | www.eglisau.ch Editorial Schwanental, 15. Juni: Tag der offenen Deponie Liebe Eglisauerinnen, liebe Eglisauer Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das Wort «Deponie» hören? Vermutlich nicht sehr viel Positives. In den Medien erscheinen Depo- nien meistens mit negativen Schlagzeilen. Prominentes Beispiel ist etwa die Sondermülldeponie Kölliken, die in einem aufwändigen Pro- zess saniert wird, was gegen 1 Mrd Franken kosten wird. Politik und Gesellschaft haben aus diesem unrühmlichen Fall viel gelernt; heute werden Deponien kontrolliert und mit einem hohen Risikobewusst- sein geführt. Im Gebiet Schwanental (Grenzbereich Eglisau/Buchberg) werden von der privaten Arbeitsgemeinschaft ARGE Deponie Schwanental Inert- stoffe abgelagert. Inertstoffe sind gesteinsähnliche Materialien, die keine chemischen Reaktionen eingehen. Dazu zählen z.B. Abbruch- (Steine, Beton, Ziegel) und Aushubmaterialien. Solche Materialien werden grundsätzlich aufbereitet und stofflich wiederverwertet. Sind sie durch chemisch stabile Metalle, Textilien oder Kunststoffe verun- reinigt, müssen sie deponiert werden. Im Kanton Zürich sind jährlich rund 0.3 Mio Kubikmeter Inertstoffe abzulagern. Die heute in Betrieb stehenden Deponien haben noch ein Restvolumen von ca. 1.1 Mio Kubikmetern. Das bedeutet, dass in einigen Jahren neue Deponievolumina benötigt werden. Der Re- gierungsrat des Kantons Zürich hat die Absicht geäussert, im Schwa- nental durch eine Vergrösserung der Deponie den Standort besser auszuschöpfen. -

Gebietsplanung Bassersdorf Dietlikon Wangen-Brüttisellen
Kanton Zürich Volkswirtschaftsdirektion Baudirektion Gebietsplanung Bassersdorf Dietlikon Wangen-Brüttisellen Öffentlichkeitsveranstaltung 2019 Bassersdorf, 20. Juni 2019 3 Kanton Zürich Agenda Volkswirtschaftsdirektion Baudirektion Begrüssung und Überblick M. Traber, Chef Amt für Verkehr (AFV) Vorhaben des Bundes Brüttenertunnel, inkl. Verlegung der G. Steiner (SBB) Stammstrecke Glattalautobahn O. Noger (ASTRA) Vorhaben der Gemeinden Vorhaben Bassersdorf D. Meier-Kobler (Bassersdorf) Vorhaben Dietlikon E. Zuber, Ph. Flach (Dietlikon) (betreffen z.T. auch Nachbargemeinden) Vorhaben des Kantons Verlegung Kantonsstrasse Bassersdorf Ch. Dasen (AFV) Neue Veloverbindungen V. Herzog (AFV) Gestaltung Landschaftsraum Eich M. Brunschwiler (ARE) Fragen und Diskussion Publikum, Fachleute Moderation M. Gerber (AFV) Schlusswort W. Natrup, Chef Amt für Raumentwicklung (ARE) Apéro 1 Amt für Verkehr Ausgangslage mittleres Glattal . Grosse Bundesinfrastrukturen: Brüttenertunnel Glattalautobahn . zentraler Wachstumsraum, zunehmende Urbanisierung und Verdichtung . Landschaftsraum Eich: Erholung, Landwirtschaft, Naturschutz, Gewässerschutz 2 Kanton Zürich Gebietsplanung mit Volkswirtschaftsdirektion Absichtserklärung Juli 2017 Baudirektion Partner erklären mit Unterschrift ihre Absicht, (1) die Massnahmen des Handlungsprogramms im Rahmen ihrer Zuständigkeiten voranzutreiben, (2) sich an der Finanzierung im Rahmen ihrer Interessen, Möglichkeiten und Zuständigkeiten zu beteiligen. Vorbehalten bleiben die gesetzlich vorgesehenen Entscheide (Exekutiven, -

Strategie Infrastruktur Kloten-Bassersdorf
Amt für Verkehr Kanton Zürich Strategie Infrastruktur Kloten-Bassersdorf Stand, 27.04.2020 Strategie Infrastruktur Kloten-Bassersdorf / Stand, 27.04.2020 Projektteam Stephan Erne (ewp) Stefan Riedi (ewp) Karin Bächli (EBP) Samuel Graf (EBP) EBP Schweiz AG Mühlebachstrasse 11 8032 Zürich Schweiz Telefon +41 44 395 16 16 [email protected] www.ebp.ch Druck: 27. April 2020 2020-04-27-Strategie Infrastruktur Kloten-Bassersdorf_def.docx Projektnummer: 219399 Seite 2 Strategie Infrastruktur Kloten-Bassersdorf / Stand, 27.04.2020 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 4 1.1 Ausgangslage 4 1.2 Auftrag und Ziel 5 2. Wirkungsanalyse 7 3. Synthese der Wirkungen 37 3.1 Wichtigste Wechselwirkungen 37 3.2 Südumfahrung kurz – Verbindungs- oder Erschliessungsfunktion? 40 4. Fazit 42 Seite 3 Strategie Infrastruktur Kloten-Bassersdorf / Stand, 27.04.2020 1. Einleitung 1.1 Ausgangslage Der Raum Kloten-Bassersdorf ist Teil des dynamischen Entwicklungsraums Dynamischer Entwicklungsraum Flughafen-Glattal. Die Gemeinden Kloten und Bassersdorf setzen sich aktiv Flughafen-Glattal mit dieser Entwicklung auseinander und machen sich Gedanken zur Abstimmung von Siedlung und Verkehr. Im Zuge der Realisierung des Brüttenertunnels wird die Baltenswilerstrasse unterbrochen. Dies führt zu Anpassungen am Strassennetz im Raum Basserdorf/Baltenswil. Die Kantonsstrasse zwischen Baltenswil und Basserdorf muss verlegt werden und Zugänge und Unterführungen im Bereich des Bahnhofs müssen neu organisiert werden. Im Rahmen der ZMB «Korridorstudie: Verlegung Baltenswilerstrasse Geprüfte Varianten für Verlegung Bassersdorf» wurden im Mai 2019 verschiedene Varianten geprüft und Baltenswilerstrasse evaluiert. Dabei kristallisierten sich die beiden Varianten «Lückenschluss Süd» und «Südumfahrung kurz» als mögliche Ersatzverbindungen heraus: Der Lückenschluss Süd ist eine Verbindungsstrasse zwischen der Bassersdorferstrasse und der Zürichstrasse südlich der Bahngleise. -

Répartition Des Zones Dans Le Canton De Zürich Répartition Des Zones
Répartition des zones dans le canton de Zürich Répartition des zones dans le canton de Zürich par ordre alphabétique des localités Zone 2004 - www.assurance-info.com par ordre alphabétique des localités Zone 2004 - www.assurance-info.com NPA Localité Région NPA Localité Région NPA Localité Région NPA Localité Région 8607 Aathal-Seegräben 3 8627 Binzikon 3 8489 Ehrikon 3 8468 Girsberg 3 8345 Adetswil 3 8309 Birchwil 3 8405 Eidberg 2 8467 Gisenhard 3 8452 Adlikon 3 8903 Birmensdorf ZH 3 8353 Elgg 3 8152 Glattbrugg 2 8106 Adlikon b.Regensdf 2 8307 Bisikon 3 8548 Ellikon a d Thur 3 8192 Glattfelden 3 8134 Adliswil 2 8494 Bliggenswil 3 8464 Ellikon am Rhein 3 8301 Glattzentrum 2 8134 Adliswil 1 2 8493 Blitterswil 3 8352 Elsau 3 8044 Gockhausen 2 8134 Adliswil 2 2 8906 Bonstetten 3 8424 Embrach 3 8700 Goldbach ZH 2 8492 Aegetswil 3 8113 Boppelsen 3 8423 Embrach-Embraport 3 8458 Goldenberg 3 8904 Aesch 3 8309 Breite 3 8133 Emmat 2 8625 Gossau ZH 3 8127 Aesch b. Maur 2 8483 Brünggen 3 8620 Emmetschloo 3 8405 Gotzenwil 2 8412 Aesch b.Neftenbach 3 8311 Brütten 3 8181 Endhöri 3 8310 Grafstal 3 8914 Aeugst am Albis 3 8306 Brüttisellen 2 8102 Engstringen 3 8415 Gräslikon 3 8914 Aeugstertal 3 8608 Bubikon 3 8103 Engstringen 3 8606 Greifensee 2 8910 Affoltern am Albis 3 8544 Buch 3 8703 Erlenbach ZH 2 8627 Grüningen 3 8046 Affoltern b. Zch 1 8414 Buch am Irchel 3 8340 Erlosen 3 8624 Grüt (Gossau ZH) 3 8308 Agasul 3 8107 Buchs ZH 3 8180 Eschenmosen 3 8127 Guldenen 2 8135 Albis 3 8180 Bülach 3 8315 Eschikon 3 8322 Gündisau 3 8915 Albisbrunn 3 8183 Bülach -

Sectoral Aviation Infrastructure Plan (SAIP)
Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications DETEC Federal Office of Civil Aviation FOCA 23.08.2017 Sectoral Aviation Infrastructure Plan (SAIP) Part IIIC Project Plan Zurich Airport Adjustment Imprint Publisher Federal Office of Civil Aviation FOCA Federal Office for Spatial Development ARE Maps reproduced with the consent of Federal Office for Civil Protection FOCP, Inventory of Cultural Goods Federal Office of Culture FOC Federal Office of Topography swisstopo, © 2017 swisstopo Federal Statistical Office FSO Federal Office for the Environment FOEN Maps and graphic design SIRKOM GmbH, 3184 Wünnewil Procurement source In electronic form: www.sil-zuerich.admin.ch 08.2017 Sectoral Aviation Infrastructure Plan (SAIP) 23.08.2017 Part IIIC Sectoral Plan content Infrastructure-specific goals and procedures ZH-1 Project Plan Project Plan Zurich Airport Contents INITIAL SITUATION General information and technical data 13 Purpose of the installation, function in the network (existing situation) 14 Arrangement with Germany 14 Status of planning, coordination 15 DETERMINATIONS 1 Intended purpose 20 2 General conditions relating to operation 20 3 Operating regulations 22 4 Harmonisation with regional development 22 5 Area subject to noise effects 23 6 Evidence of noise pollution 23 7 General conditions in relation to the infrastructure 24 8 24 9 Airport perimeter 25 10 26 11 28 EXPLANATIONS 1 Intended purpose 30 2 General conditions relating to operation 30 3 Operating regulations 32 4 Harmonisation with regional -
Tickets and Prices
Valid 13.12.2020 to 11.12.2021 Tickets and prices GET ON BOARD. GET AHEAD. 3 Find your bearings Networked and interconnected Table of contents Get in, get around, get there ZVV fares from zone to zone 5 Thank you for your interest in public transport within the greater Single tickets 6 Zurich area. 9 O’Clock Day Pass 7 Multiple tickets 8/9 In the Zurich Transport Network, tickets and travelcards are NetworkPass 10/11 purchased according to zones. The zone-based fare system is 9 O’Clock Pass 12/13 explained on page 5. BonusPass 14 Z-Pass 15 Would you like to travel on public transport without studying Zone upgrades 17 zone maps or calculating fares? Then we recommend the check-in First-class upgrades 18 feature of our ticket app, which automatically gives you the right Groups 19 ticket. More information can be found on page 32. Nighttime network 20 Albis 24h tickets 20 Need a personal consultation? We would be glad to assist you in Zürich Card 21 our customer centre or advise you over the phone. Bicycles on board 22 Children and young people 23 Wishing you a pleasant journey! SwissPass 25 Travellers with disabilities and guide or working dogs 26 Animals 26 For destinations elsewhere in Switzerland 27 National tickets, passes and discount cards 27 www.zvv.ch Mobility Carsharing 28 Ticket inspections 29 ZVV timetable 31 0848CHF 9880.08/min. 988 Sales channels 32/33 ZVV-Contact 34 4 5 The green light in space and time ZVV fares from zone to zone The Zurich Transport Network (ZVV) is divided into zones. -

Final Report No. 1793 by the Aircraft Accident Investigation Bureau
Büro für Flugunfalluntersuchungen Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici Uffizi d'investigaziun per accidents d'aviatica Aircraft accident investigation bureau Final Report No. 1793 by the Aircraft Accident Investigation Bureau concerning the accident to the aircraft AVRO 146-RJ100, HB-IXM, operated by Crossair under flight number CRX 3597, on 24 November 2001 near Bassersdorf/ZH Bundeshaus Nord, CH-3003 Berne Final Report HB-IXM (CRX 3597) General remarks to this report In accordance with the agreement on International Civil Aviation (ICAO Annex 13) the sole objec- tive of the investigation of an accident or incident shall be the prevention of accidents and inci- dents. It is not the purpose of this activity to apportion blame or liability. According to art. 24 of the Swiss Air Navigation Law the legal assessment of accident/incident causes and circumstances is no concern of the investigation. The masculine form is used exclusively in this report regardless of gender for reasons of data pro- tection. If not otherwise stated, all times in this report are indicated in universal time coordinated (UTC). At the time of the accident, the Central European Time (CET) was valid for the area of Switzerland. This CET was equal to the local time (LT). The relation between LT, CET and UTC is: LT = CET = UTC + 1 h. The german-language version of this report is authoritative. The Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) of Switzerland would like to thank the authori- ties and other organizations -

The Organic Market in Switzerland and the European Union Overview and Market Access Information for Producers and International Trading Companies
The Organic Market in Switzerland and the European Union Overview and market access information for producers and international trading companies Research Institute of Organic Agriculture sippo (Forschungsinstitut swiss import für biologischen Landbau) promotion programme We put your projects on track Project and feasibility studies Training and advice Pilot and demonstration trials Conversion planning Support for import and label certifi cation Set-up of inspection and certifi cation programmes Market surveys, marketing concepts and organic produce sourcing Research Institute of Organic Agriculture Frick (Switzerland): Postfach, CH-5070 Frick, Tel. +49 (0)62 865 72 72, Fax +49 (0)62 865 72 73, www.fi bl.org Imprint Publisher SIPPO Swiss Import Promotion Programme Stampfenbachstr. 85, CH-8035 Zürich Switzerland Tel. +41-1-365-52-00 Fax +41-1-365-52-02 www.sippo.ch [email protected] Research Institute of Organic Agriculture (Forschungsinstitut für Biologischen Landbau, FiBL) Ackerstrasse, CH-5070 Frick Switzerland Tel. +41-62-865-72-72 Fax +41-62-865-72-73 www.fibl.org [email protected] Authors Lukas Kilcher, Ranjana Khanna, Beate Huber, Toralf Richter, Otto Schmid (FiBL), Franziska Staubli (SIPPO) Collaboration/Revision Hans Ramseier (BIO SUISSE), Stefan Schönenberger (Swiss Federal Office for Agriculture – Bundesamt für Landwirtschaft) Translation Übersetzungsbüro für Umweltwissenschaften, D-64297 Darmstadt, Germany [email protected] Design bootzgrolimundbootzbonadei, CH-8037 Zürich Press Druckzentrum Sellenbüren AG, CH-8143 Sellenbüren-Stallikon,