Dimension Der Zukunft Nanotechnologie in Dresden
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Final Program November 7 - 10, 2011 San Jose, Ca
2011 FINAL PROGRAM NOVEMBER 7 - DESIGN10, TOOLS ASIC 2011 ENGINEERING VERIFICATION STRUCTURE ESDA SAN JOSE,PLANS CA CHIP EFFICIENCY INNOVATION DESIGN SIGNAL MIXED MIXED OPPORTUNITY CAD LOGIC SYNTHESIS COMPLEXITY MANUFACTURING IEEE/ACM TEMPLATES APPLIED SCIENCE PATTERN FPGA EDA AUTOMATION INTERNATIONAL METHODOLOGIES TECHNOLOGY EXHIBITCONFERENCE ON ADVANCEMENT STANDARDS CONCEPTION COMPLIANCE PIONEERING MECHANICS COMPUTER-AIDED CIRCUITS NETWORKING WORKFLOWDESIGN ELECTRONIC DESIGN2011 www.ICCAD.com www.iccad.com 2011 ICCAD continues to be the premier conference devoted to technical innovations in design automation. ICCAD’s program of technical papers, tutorials, panels, and keynote highlight ICCAD continues to host one‑day topical workshops providing focused the most important current and future research challenges. A day of coverage of topics of emerging and current interest. This year, four workshops, workshops on hot topics caps a week of non‑stop technical excitement. And on lithography, variability modeling/characterization, constraints in formal as always, a large number of side meetings and social events provide plenty of verification and adaptive power management will take place on Thursday, opportunities for networking and meeting colleagues and friends. November 10. This year’s CANDE workshop will also be co‑located with ICCAD in San Jose, and held in parallel with ICCAD workshops on Thursday, November 10. This year’s ICCAD starts on Monday, November 7 and continues through Wednesday, November 9. You will find up‑to‑date details on the conference website, http://www.iccad.com. Finally, ICCAD 2011 is privileged to have a keynote address from Dr. Georg Sigl of Technische Univ. München. Prof. Sigl will provide unique insights into the design of secure hardware systems, and asks what role EDA will play in the The core of ICCAD has always been the contributed research paper program. -

Energy Saxony
ing·Working·Learning·RESEARCHING·PRODUCING·INVENTING·TRANSPORTING· THIN SAxony! INVENTING·LiVING·THINKINGA Place·Li in MotionVing·RESEARCHING·DeVeLoPING·LiVING·Learning LiVING·TRANSPORTING·LiVing·Working·Learning·reSearching·PRODUCING ·DeVeLoPING·Learning·THINKING·INVENTING·TransporTing·LiVing· a·PRODUCING·RESEARCHING·Working·LiVing·DeVeLoPING·Learning ·Learning·RESEARCHING·TransporTing·INVENTING·PRODUCING·THINKING·DeVeLoPING· ing·RESEARCHING·DeVeLoPING·LiVING·Learning·RESEARCHING·Working· Mobile DynaMic Flexible active vivacious Passionate 28 Infrastructure & Economy & Education, Training Research & Culture, Nature Location 6 Industry Sectors 9 & Qualification 14 Cooperation 18 & Recreation 23 Infrastructure – »Autoland Saxony« 10 Universities with Vibrant Research 19 Where Classic Meets Facts and Figures 8 Tradition 16 Cult 24 The Cradle of Science – Facts and Exceptional Studies 16 Custom-made Logistics 8 German Mechanical Figures 19 Vibrant Cities 25 Engineering 11 Practice-oriented (Cultural) Landscapes Vocational Training 16 Excellent University Economy – Facts and Research 20 26 Figures 12 Research as an Incen- From Water to »Silicon Saxony« 12 tive for Investments 20 Winter Sports 27 Environmental Focusing on the Technology and Future 22 Life Sciences 13 Source: Saxony Economic Development Corporation (WFS – Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH) Company/Institution URL Company/Institution URL Infrastructure & Location Research & Cooperation DHL Leipzig Hub www.dp-dhl.de/leipzig AZZURRo Semiconductors AG www.azzurro-semiconductors.com -
Advance Programme
ADVANCE PROGRAMME follow us on www.date-conference.com Design, Automation and Test in Europe March 14 – 18, 2016, Dresden, Germany DATE16 DATE 2016 SPONSORS PROGRAMME GUIDE Media Partners 002 Welcome 004 DATE16 General Information 010 March 14 KEYNOTE SPEAKERS European Design and Automa- Electronic Design Automation Luc Van den hove, imec, BE 006 tion Association Consortium Antun Domic, Synopsys, Inc., US 007 Patrick Leteinturier, Infineon Technologies AG, DE 008 – 18, 2016, 18, Walden C. Rhines, Mentor Graphics Corporation, US 009 EXECUTIVE TRACK 013 Dresden, Germany Yervant Zorian, Synopsys, US IEEE Council on Electronic De- European Electronic Chips & Dresden, Germany sign Automation Systems design Initiative AUTOMOTIVE SYSTEMS 014 Samarjit Chakraborty, TU Munich, DE Wolfgang Ecker, Infineon Technologies, DE 2016, 18, – SECURE SYSTEMS 015 Ingrid Verbauwhede, KU Leuven and UCLA, BE Matthias Schunter, Intel, DE ACM Special Interest Group Russian Academy of Sciences on Design Automation March 14 SPECIAL SESSIONS 016 Giovanni De Micheli, EPFL, CH TECHNICAL CO-SPONSORS Marco Casale-Rossi, Synopsys, IT — IEEE Computer Society test technology technical Council (tttC) DATE 2016 – AT A GLANCE 018 — IEEE Solid-State Circuits Society (SSCS) A brief overview of the event — International Federation for Information Processing (IFIP) MONDAY TUTORIALS 027 Ten half-day tutorials EVENT SPONSORS OPENING PLENARY & AWARDS 040 Free for exhibition visitors TECHNICAL SESSIONS 041 Full listing of DATE technical programme, special sessions FRIDAY WORKSHOPS 094 Eight full-day workshops EXHIBITION THEATRE PROGRAMME 112 Free for exhibition visitors UNIVERSITY BOOTH 118 FRINGE MEETINGS & 123 COMMERCIAL SPONSORS CO-LOCATED WORKSHOPS EXHIBITION GUIDE 129 Committees 15 4 Detailed Index 15 8 Venue Plan C04 www.date-conference.com www.date-conference.com 1 DATE16 MEDIA PARTNERS MEDIA PARTNERS The DATE organisation and sponsors would like to extend their warmest gratitude to all press journalists who give DATE coverage in the editorial EE Times Europe DATE16 pages. -

IEEE 2011 SCD Flyer
2011 Semiconductor Conference Dresden Technology, Design, Packaging, Simulation and Test International Conference, Workshop and Table-top Exhibition September 27 to 28, 2011 - Dresden, Germany „Meet Leading Players and Experts at the SCD in Dresden, Germany“. The Largest Microelectronic Centre in Europe! Supported by and EDS Chapter Germany Welcome Note from Chair of SCD 2011 Dear Friends and Colleagues, it is a big pleasure for me to welcome you to the IEEE Semiconductor Conference Dresden (SCD) 2011. This year, the program includes plenary sessions, technical papers, poster presentations, a student event and an exhibition. The program covers circuit and system design, packaging, simulation and modeling, measuring and testing, semiconductor materials, technologies and fabrication. You have the opportunity to meet leading players and experts from all over the world. Dresden is well known as one of the largest microelectronic centers in the world. However, Dresden offers much more than sophisticated technologies. Do not miss to visit the beautiful old city centre and other sightseeing highlights such as the Elb-Schloesser, Meissen, Schloss Pillnitz or Schloss Moritzburg. If you have time you may go for an event in one of the concert halls or a hiking trip in the Saechsische Schweiz (30 min by train). Let’s meet for a drink during the social event! I’m glad that one of the most talented jazz bands in Saxony will present their latest album. I would like to thank all the persons who have contributed to the successful organization of this event. My special thanks go to Georg Schmidt, Joachim Burghartz, Robert Weigel, Thomas Geßner, Gerhard Fettweis and Dietmar Kissinger for their strong commitments. -

SAENA KA IVS 3 Aufl ENG 210817.Indd
ATLAS OF COMPETENCE in Intelligent Transport Systems in Saxony Published by: Saxon State Ministry of Economic Affairs, EDITION Labour and Transport (SMWA) rd New edition Press Office P.O. Box 10 03 29 Driver assistance systems 2017 01073 Dresden R e Germany v n Efficiency is io ed it www.smwa.sachsen.de a ed Data fusionnd d Edited by: (highly) automated driving updated 3r Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH Sensor systems [email protected] Congestion prevention Data security www.ivs-sachsen.de Electric mobility Big Data Mobility Layout: Traffic safety Traffic Tracking technologies büro quer kommunikationsdesign Value creation Innovation Real time Printed by: Stoba-Druck, Lampertswalde Data protection Copy deadline: 3rd edition, August 2017 Circulation: 1,500 Vehicle2X grounds Testing Proofreading: driverless Energy saving The featured companies/institutions/organisations Translation: Connectivity Sustainability Information exchange SprachUnion Chemnitz Orders/downloads: www.ivs-sachsen.de protection Environmental Emissions reduction management parking space Intelligent Safety Know-how Copyright Telematics This publication is protected by copyright. All rights reserved, including the right to reprint excerpts Accident prevention www.smwa.sachsen.de and to make photomechanical reproductions. procedures Test Communication systems Traffic management Standardisation intermodal Multimodal applications MAP ATLAS OF COMPETENCE INTELLIGENT IN TRANSPORT SYSTEMS SAXONY IN – 3 Atlas of Competence in Intelligent Transport Systems in Saxony Words of -
Faktum Engl.Pdf
History Elector Friedrich August I (Augustus the Strong) Merchants’ settlement and margravate seat, then electoral and royal re- sidence and later state capital of Saxony – Dresden is one of Germany’s cultural-historical pearls. It can look back over a more than 800-year history. 1206 First documented mention of Dresden 1216 First designation as a town 1485 Division of the Wettin estates and decision by Duke Albrecht to adopt Dresden as his residence 1547 Duke Moritz acquires the title of Elector; Dresden becomes capital and electoral seat of the Protestant Electorate of Saxony 1549 Incorporation of “Altendresden” (today’s Neustadt) by Elector Moritz; joint administrative offices on the left bank of the River Elbe 1685 Fire destroys Altendresden; first building plans for a whole city dis- trict (Wolf Caspar von Klengel) 1697 Elector Friedrich August I (Augustus the Strong), in power since 1694, converts to the Catholic faith and acquires the Polish crown as King August II. 1708 Invention of porcelain by Johann Friedrich Böttger and Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (Jungfernbastei, Dresden fortress) 1710 Building work begins on the Zwinger (Matthäus Daniel Pöppelmann); completed in 1732 1720 Building regulations of Governor Count Wackerbarth come into force; shaping of the Baroque townscape 1726 Foundation stone laid for the Frauenkirche Church (George Bähr); completed in 1743 1732 Altendresden is first described as the “Neue Stadt” (today Neustadt, New Town); consequently the district on the left bank, until now New-Dres- den, is also -

Integrated Device Technology, Inc
2016 Annual Report NOTICE OF ANNUAL MEETING AND PROXY To Our Shareholders I would like to thank our customers, employees, and investors for the Revenue Growth* strong support that allowed us to deliver an exceptional year in our fiscal 2016. ($ millions) We once again substantially outperformed the semiconductor industry in all $200 key metrics. $175 Our total fiscal year 2016 revenue was $697M, which represents a 22% $150 increase over fiscal year 2015. Significant improvements were realized in $125 our business model for the third consecutive year, resulting in EPS rising $100 $75 from $0.61 in the prior year to $1.32 in fiscal 2016. We now have one of the $50 highest leverage earnings models in the technology industry, and deliver 0 that consistently. 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY15 FY16 FY16 FY16 FY16 During this past fiscal year, our board approved a substantial increase to our share buyback program and we utilized $422M to repurchase IDT shares. Cash returned to shareholders through buybacks was 240% of annual free cash flow, while shares outstanding were reduced by 10%. Operating Margins* In December 2015, we purchased ZMDI, a respected and well-established ($ millions) automotive and sensor company headquartered in Dresden, Germany. This $60 acquisition has integrated smoothly with the rest of IDT to produce a very $50 potent combination. IDT’s automotive business is well established at major $40 customers all over the globe, revenue is already growing, and new design $30 wins in this key market are up sharply. We are very pleased with the strategic $20 fit and rapid progress of this business and its people. -

Präsentationsvorlagen Im CD Der TU Dresden
Welcome and Information Meeting Master‘s Program Nanoelectronic Systems (NES) Welcome and general information Get to know each other Useful information for your studies Welcome Meeting Master‘s Program Nanoelectronic Systems Thomas Mikolajick | Manuela Tetzlaff | Benjamin Max Folie 2 Dresden, 08.10.2019 Welcome by dean of studies Prof. Dr.-Ing. Thomas Mikolajick Welcome Meeting Master‘s Program Nanoelectronic Systems Thomas Mikolajick | Manuela Tetzlaff | Benjamin Max Folie 3 Dresden, 08.10.2019 Initiated by Cool Silicon cluster Cool Silicon: Leading-Edge Cluster with the goal of energy efficiency in the information and communications technology (ICT) sector Welcome Meeting Master‘s Program Nanoelectronic Systems Thomas Mikolajick | Manuela Tetzlaff | Benjamin Max Folie 4 Dresden, 08.10.2019 Nanoelectronics in Saxony Technology • GLOBALFOUNDRIES • Infineon Design • X-FAB • IDT (former ZMDI) • … • DMOS GmbH • Productivity Engineering GmbH Silicon Saxony • … • 2,300 companies with about 60.000 employees • among them more than 300 companies with about 20,000 employees active in microelectronics • 4 billion Euros revenue • Training/Research: • 4 Universities, • 5 Universities of Applied Sciences, • 9 Fraunhofer-, 3 Leibniz-,2 Max-Planck-Institutes,Applications and 1 Helmholtz-Center • TechniSat • National Instruments (former Signalion) • … Welcome Meeting Master‘s Program Nanoelectronic Systems Thomas Mikolajick | Manuela Tetzlaff | Benjamin Max Folie 5 Dresden, 08.10.2019 Nanoelectronics in research „Advancing Electronics“ New perspectives -
The Hub Where Business Meets Science Nine Reasons High-Tech Meets Savoir Vivre to Choose Dresden
To Know How creates Know-How Business Dresden - the hub where business meets science Nine reasons High-tech meets savoir vivre to choose Dresden. Dresden is ... http://invest.dresden.de Dresden counts as one of the stron- Dresden, a city of longing more scientific gest economic locations in Germa- more networked ny: this is the heart of the European Not only successful, but also beauti- more technological microelectronics industry, and from ful: Dresden, the capital of the Free more practical here, innovations in the areas nano- State of Saxony, is enlivened by its more helpful technology, new-generation mate- culture, its orchestras, its museums, more talented rials, and life sciences unlock the and its architecture... The splendor more relevant markets of the future. This includes of the reborn “Florence of the Elbe” more livable numerous companies with rich tra- shines throughout the world. Dresden more dynamic ditional history that have made a is a European city that must be seen, name for themselves in areas from and the German newspaper DIE ZEIT mechanical engineering and aircraft has written that it has what it takes to construction to food production and become “a city of longing”. cultural industries. This richly facet- The Italian writer Umberto Eco ed diversity was and is a significant stated after visiting Dresden that “the reason for the success of Dresden‘s people of Dresden don‘t ask you, if economy and its sustainable growth. you think that the city is beautiful, Companies domiciled here are con- they tell you that it is.” A rich culture, stantly expanding their capacities, fascinating nature just beyond the and German companies and com- city gates, and the best conditions panies from around the world are for work and research make it a place setting up branch offices here. -

Dear Muneda Friends & Users, Schematic Porting Between
Improve Design Performance & Yield Program-Announcement MUGM 2011 MunEDA User Group Meeting 2011 – Nov 24th & 25th Munich Dear MunEDA Friends & Users, We are pleased to announce the program for our next MunEDA User Group Meeting. MUGM 2011 will take place on November 24th &25th (Thu/Fri), 2011 at Westin Grand Munich, Germany. The goal of the event is an intensive exchange of knowledge by experienced industrial users. MUGM provides an open forum for all technologists interested in MunEDA´s EDA software tools. In addition to other contributions, one main focus of the MunEDA User Group Meeting 2011 is the special topic: Schematic Porting between Different Processes, Assessment & Sizing Flow Date: November 24 & 25 (Thu-Fri), 2011 Location: Westin Grand Munich Arabellastr. 6 81925 Munich - Germany Registration open at: www.muneda.com/registration Selection of Technical & Presentation Topics of MUGM & MTF Past MUGM 2011: & Future Forums: Ò Munich 2011 Ò SPT Schematic Porting Ò Taiwan 2011 Ò Handling Design Contraints & Sizing Rules Ò Seoul 2011 Ò IP Porting & Technology Migration Ò Munich 2010 Ò Yokohama 2010 Ò Design Performance & Specification Analysis Ò Munich 2009 Ò Response Surface Modelling & Model Generation Ò Yokohama 2009 Ò Circuit Design Optimization & Verification Ò Munich 2008 Ò Statistical Circuit Analysis & Optimization Ò Boston 2008 Ò Anaheim 2008 Ò Multi-Testbench Environment & Corner-Based Optimization Ò Taiwan 2007 Ò Worst-Case Distance Analysis & Optimization Ò Munich 2007 Ò Design Shrink & Nano-scale Circuit optimization -
Network Thinking Microelectronics in Dresden from Pizza Wafers to Software Solutions
Network Thinking Microelectronics in Dresden From Pizza Wafers to Software Solutions Silicon wafer produced by GLOBALFOUNDRIES n Made in Saxony: World-Class Technologies Now home to 1,500 companies and around Silicon Saxony is recognized and valued in Germany, Europe and 48,000 employees in the sector, Dresden has throughout the world as an outstanding location for high technology in truly emerged as Europe’s leading location for the ICT sector (information and communication technology). In addition microelectronics and information technology. to its strong semiconductor industry, the region also boasts expertise in Business activities at local companies cover the fields of microelectronics and microsystems, mobile communica- the entire value creation chain, with the goods tions, software, photovoltaics and future-oriented organic semiconduc- produced ranging from chips to end user tor technology (OLEDs). In all these fields, world-leading concerns such products. as GLOBALFOUNDRIES, Infineon, Siltronic, SolarWorld, Heliatec and This broad spectrum of companies of all sizes n Pizza Wafers for Chips Novaled have settled here in order to benefit from seamless integration fosters both the exchange of knowledge and Most chips are produced on 300 mm silicon into a high-tech landscape characterized by strong partners. Based in establishment of service and supply networks. wafers. After processing, these innovative Dresden, the Silicon Saxony e. V. association is named after this dynam- “pizza wafers” create cost advantages of over ic region and represents Europe’s largest microelectronics network. It 30 percent for chip foundries. They are devel- systematically promotes partnerships and bolsters existing competen- oped and produced close to Dresden in the city cies by supporting unique cooperative interplay between manufacturers, of Freiberg, where Siltronic AG – the world’s suppliers, service providers, universities and scientific institutes across third-largest wafer producer – has constructed Saxony. -
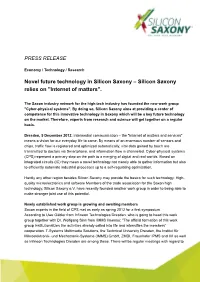
"Cyber-Physical Systems". [Pdf, 145.44
PRESS RELEASE Economy / Technology / Research Novel future technology in Silicon Saxony – Silicon Saxony relies on "Internet of matters". The Saxon industry network for the high-tech industry has founded the new work group "Cyber-physical systems". By doing so, Silicon Saxony aims at providing a center of competence for this innovative technology in Saxony which will be a key future technology on the market. Therefore, experts from research and science will get together on a regular basis. Dresden, 5 December 2012. Intermedial communication – the "Internet of matters and services" means a vision for our everyday life to come. By means of an enormous number of sensors and chips, traffic flow is registered and optimized automatically, vital data gained by touch are transmitted to doctors via Smartphone, and information flow is channeled. Cyber-physical systems (CPS) represent a primary step on the path to a merging of digital and real worlds. Based on integrated circuits (IC) they mean a novel technology not merely able to gather information but also to efficiently automate industrial processes up to a self-regulating optimization. Hardly any other region besides Silicon Saxony may provide the basics for such technology: High- quality microelectronics and software Members of the trade association for the Saxon high technology, Silicon Saxony e.V. have recently founded another work group in order to being able to make stronger joint use of this potential. Newly established work group is growing and awaiting members Saxon experts in the field of CPS met as early as spring 2012 for a first symposium. According to Uwe Gäbler from Infineon Technologies Dresden, who is going to head this work group together with Dr.