Beate Weifenbach
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

SAHRA-Annual-Report-2007.Pdf
SAHRA Ann Rep Cover 2007 repro Monday, August 27, 2007 1:21:22 PM Table of Contents SAHRA’S VISION AND MISSION STATEMENT 2 LETTER FROM THE CHAIRPERSON 3 THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER’S FOREWORD AND MESSAGE 4 APPLICABLE ACTS AND OTHER INFORMATION 7 STATEMENT OF RESPONSIBILITY 8 CORPORATE AFFAIRS 9 Human Resources Management 10 Information and Auxiliary Services 25 HERITAGE RESOURCES MANAGEMENT 27 Head Office Units Archaeology, Palaeontology and Meteorites Unit 28 Architectural Heritage Landscape Unit 34 Burial Grounds and Graves Unit 38 Grading and Declarations Unit 44 Heritage Objects Unit 48 Living Heritage Unit 54 Maritime Archaeology Unit 62 National Inventory Unit 72 Provincial Offices Eastern Cape 76 Free State 80 Gauteng 80 Kwa-Zulu Natal 92 Limpopo 94 Mpumalanga 98 North West 102 Northern Cape 110 Western Cape 116 LEGAL UNIT 128 FINANCIAL STATEMENTS 131 SAHRA OFFICES AND STAFF 161 SAHRA’S VISION SAHRA’s vision is to provide for the identification, conservation, protection and promotion of our heritage resources for present and future generations. SAHRA’S MISSION As custodians of our national estate our mission is: ° to coordinate and monitor the identification of our national heritage resources; ° to set norms and standards and maintain the management of heritage resources nationally; ° to encourage co-operative conservation of our national estate; ° to enable and facilitate the development of provincial structures; ° to control the export and import of nationally significant heritage resources; ° to develop policy initiative for the promotion and management of our heritage; ° to nurture an holistic celebration of our history; ° to set national policy for heritage resources management, i.e. -

Bremen (Germany) No 1087
buildings (36ha), surrounded by an outer protection zone (376ha). The town hall has two parts: the Old Town Hall Bremen (Germany) initially built in 1409 on the north side of the market place, renovated in the early 17th century, and the New Town Hall No 1087 that was built in the early 20th century as an addition facing the cathedral square. The Old Town Hall is a two-storey hall building with a rectangular floor plan, 41.5 x 15.8m. It is described as a 1. BASIC DATA transverse rectangular Saalgeschossbau (i.e. a multi-storey State Party: Federal Republic of Germany construction built to contain a large hall). It has brick walls and wooden floors structures. The exterior is in exposed Name of property: The town hall and Roland on the brick with alternating dark and light layers; the decorative marketplace of Bremen elements and fittings are in stone. The roof is covered by Location: The City of Bremen green copper. The ground floor is formed of one large hall with oak pillars; it served for merchants and theatrical Date received: 22 January 2002 performances. The upper floor has the main festivity hall of the same dimensions. Between the windows, there are Category of property: stone statues representing the emperor and prince electors, In terms of the categories of cultural property set out in which date from the original Gothic phase, integrated with Article 1 of the 1972 World Heritage Convention, this is a late-Renaissance sculptural decoration symbolising civic monument. It is a combination of architectural work and autonomy. -

Germany (EXPORT) Demurrage 2019
Germany (EXPORT) Demurrage 2019 Dry containers (Seaport) 20'DRY 40'DRY Day 1-7 Free Day 8-14 60 EUR 75 EUR Day 15-21 75 EUR 120 EUR Day 22-28 120EUR 170 EUR Day 29 onwards 140 EUR 190 EUR Refrigerated containers and special equipment (Seaport) 20' REEF and 40' REEF and SPECIAL SPECIAL Day 1-5 Free Day 6-12 120 EUR 140 EUR Day 13-19 150 EUR 180 EUR Day 20-26 190 EUR 240 EUR Day 27 onwards 230 EUR 280 EUR IMO containers (Seaport) 20'IMO 40'IMO Day 1-5 Free Day 6-12 120 EUR 140 EUR Day 13-19 150 EUR 180 EUR Day 20-26 190 EUR 240 EUR Day 27 onwards 230 EUR 280 EUR Classification: Internal Germany (EXPORT) Detention 2019 Dry and IMO containers 20'DRY and IMO 40'DRY and IMO Day 1-5 Free Day 6-12 45 EUR 55 EUR Day 13-19 55 EUR 70 EUR Day 20-26 65 EUR 85 EUR Day 27 onwards 75 EUR 100 EUR Refrigerated containers and special equipment 20' REEF and 40' REEF and SPECIAL SPECIAL Day 1-5 Free Day 6-12 85 EUR 105 EUR Day 13-19 95 EUR 115 EUR Day 20-26 105 EUR 125 EUR Day 27 onwards 125 EUR 150 EUR Classification: Internal Container Pick-up Location –Depot 20' Dry 40' Dry 40' High 45' High Augsburg - Augsburg,Kloiber 100 EUR 175 EUR 175 EUR n/a Berlin -Großbeeren, DBI 50EUR 125 EUR 125 EUR n/a Bielefeld -Bobe, Bad Salzuflen 25 EUR 75 EUR 75 EUR n/a Bonn -Am Zehnhoff-Söns 50EUR 75 EUR 75 EUR n/a GmbH Bremen -Roland 25EUR 75 EUR 75 EUR n/a Dortmund -CTD - Cont. -
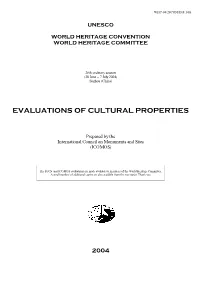
Evaluations of Cultural Properties
WHC-04/28COM/INF.14A UNESCO WORLD HERITAGE CONVENTION WORLD HERITAGE COMMITTEE 28th ordinary session (28 June – 7 July 2004) Suzhou (China) EVALUATIONS OF CULTURAL PROPERTIES Prepared by the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) The IUCN and ICOMOS evaluations are made available to members of the World Heritage Committee. A small number of additional copies are also available from the secretariat. Thank you 2004 WORLD HERITAGE LIST Nominations 2004 I NOMINATIONS OF MIXED PROPERTIES TO THE WORLD HERITAGE LIST A Europe – North America Extensions of properties inscribed on the World Heritage List United Kingdom – [N/C 387 bis] - St Kilda (Hirta) 1 B Latin America and the Caribbean New nominations Ecuador – [N/C 1124] - Cajas Lakes and the Ruins of Paredones 5 II NOMINATIONS OF CULTURAL PROPERTIES TO THE WORLD HERITAGE LIST A Africa New nominations Mali – [C 1139] - Tomb of Askia 9 Togo – [C 1140] - Koutammakou, the Land of the Batammariba 13 B Arab States New nominations Jordan – [C 1093] - Um er-Rasas (Kastron Mefa'a) 17 Properties deferred or referred back by previous sessions of the World Heritage Committee Morocco – [C 1058 rev] See addendum: - Portuguese City of El Jadida (Mazagan) WHC-04/28.COM/INF.15A Add C Asia – Pacific New nominations Australia – [C 1131] - Royal Exhibition Building and Carlton Gardens 19 China – [C 1135] - Capital Cities and Tombs of the Ancient Koguryo Kingdom 24 India – [C 1101] - Champaner-Pavagadh Archaeological Park 26 Iran – [C 1106] - Pasargadae (Pasargad) 30 Japan – [C 1142] - Sacred Sites -

Entering a New Era with a Pioneering Spirit Telecommunications for the World 2 OHB MAGAZINE | 2017 // CONTENTS / EDITORIAL / PUBLISHING DETAILS 03
Issue 2017 OHB Magazine The customer magazine of the OHB Group Anniversary: 35 years of OHB PLATO, JUICE & Co. New Space@OHB The incredible success story of an OHB is currently involved in many Promoting new business ideas for the aerospace company which started off as exciting ESA scientific missions international spaceflight market a minor ship supplier Entering a new era with a pioneering spirit Telecommunications for the world 2 OHB MAGAZINE | 2017 // CONTENTS / EDITORIAL / PUBLISHING DETAILS 03 Intro 04 The Next Big Step – OHB’s fi rst SmallGEO is perfectly operating in its geostationary orbit News from the OHB Group 08 The Hispasat 36W-1 satellite, based The latest news from OHB companies on the SmallGEO platform, lifted off on a Soyuz rocket from Europe’s Spaceport in Kourou, French Guiana. Project Stories SmallGEO is Europe’s response to Small GEO, major performance 14 the market demand for more flexible, Dear Customers, modular telecommunications plat- Five questions for Torben Gille forms. It marks the first time the Business Partners and OHB System AG have been the prime contractor for a telecommunications A new star in the sky 20 Friends of OHB, satellite mission. The impressive career of a nanosatellite called Max Valier As one of the three major European space system integrators, it is a tradition for us to show our PLATO, JUICE & Co. 24 skills as a group. The best occasion to get in touch Publishing details OHB is currently involved in many ESA with our customers and friends is an exhibition Published by scientifi c missions and we are proud to meet you here again. -

Clubs Missing a Current Year Club Officer OFF0021
Run Date: 4/11/2020 8:41:00AM Lions Clubs International Clubs Missing Club Officer for 2019-2020(Only President, Secretary,Treasurer, Membership Chair) Undistricted Club Club Name Title (Missing) 27947 MALTA HOST (MALTA) Membership Chair 27947 MALTA HOST (MALTA) President 27947 MALTA HOST (MALTA) Treasurer 27949 PAPEETE (TAHITI) Membership Chair 27952 MONACO (PRIN OF MONACO) Membership Chair 38921 MANILA CENTRUM (PHILIPPINES) Membership Chair 38921 MANILA CENTRUM (PHILIPPINES) President 38921 MANILA CENTRUM (PHILIPPINES) Secretary 38921 MANILA CENTRUM (PHILIPPINES) Treasurer 44697 ANDORRA DE VELLA (PRINCIPAT D'ANDORRA) Membership Chair 47478 DUMBEA (NEW CALEDONIA) Secretary 53760 LIEPAJA (REP OF LATVIA) Membership Chair 54276 BOURAIL LES ORCHIDEES (NEW CALEDONIA) Membership Chair 54276 BOURAIL LES ORCHIDEES (NEW CALEDONIA) Secretary 55216 MDINA (MALTA) Membership Chair 57412 ALUKSNE (REP OF LATVIA) Membership Chair 60727 PHNOM PENH OBAYKHOM (CAMBODIA,KINGDOM OF) Membership Chair 62548 VALMIERA (REP OF LATVIA) Membership Chair 63267 SVETLOGORSK (BELARUS REP.) Membership Chair 63886 ULAANBAATAR KHERLEN (MONGOLIA) Membership Chair 68947 SARAJEVO CENTAR (BOSNIA & HERZEGOVINA) President 68947 SARAJEVO CENTAR (BOSNIA & HERZEGOVINA) Secretary 78634 TBILISI GEORGIAN (REP OF GEORGIA) Membership Chair 78634 TBILISI GEORGIAN (REP OF GEORGIA) President 78634 TBILISI GEORGIAN (REP OF GEORGIA) Secretary 78634 TBILISI GEORGIAN (REP OF GEORGIA) Treasurer 99266 SOFIA VITOSHA (BULGARIA) Membership Chair OFF0021 © Copyright 2020, Lions Clubs International, -

31. Antiquaria 2017 26.–28.1.2017 Graphik Autographen Bücher Fremd Inderfremdefremd ? Peregrina – 1 Quaria I R a U Iq T N a 31
Musikhalle Ludwigsburg Donnerstag, 26.01.2017 15 – 20 Uhr 31. A n t iq u a r i a Freitag, 27.01.2017 11 – 19 Uhr Samstag, 28.01.2017 11 – 17 Uhr Peregrina Antiquariatsmesse Ludwigsburg www.antiquaria-ludwigsburg.de Antiquaria31. 2017 Bücher Autographen Graphik 26.–28.1.2017 Peregrina – fremd in der Fremde ? Veranstaltungsort / Location: Messeregel / Sales regulations Musikhalle, 71638 Ludwigsburg Bahnhofstr. 19 – gegenüber dem Bahnhof Alle Angebote dieses Katalogs müssen bei der Eröff- www.musikhalle-ludwigsburg.com nung der Antiquaria am Donnerstag, 15 Uhr zum Verkauf bereitliegen und dürfen nicht vorher verkauft oder fest Messezeiten / Opening Hours: reserviert werden. Verkäufe aus dem Messekatalog sind erst Donnerstag, 26. Januar 2017 15 – 20 Uhr 45 Minuten nach Eröffnung der Antiquaria zulässig. Sollte Freitag, 27. Januar 2017 11 – 19 Uhr ein im Katalog angezeigtes Objekt mehrere Interessenten Samstag, 28. Januar 2017 11 – 17 Uhr finden, erfolgt die Vergabe nach Ablauf der 45 Minuten durch ein Losverfahren. Vorbestellungen können erst am Messeeintritt für drei Tage / folgenden Tag berücksichtigt werden. Die Preise sind in admission for three days: € 3,– Euro angegeben und beinhalten die gesetzliche Mehrwert- steuer. Ausgenommen sind diejenigen Objekte, die von den AusstellerInnen margenbesteuert angeboten werden. Näheres erfahren Sie bei den AusstellerInnen. Für die Zu- Kombiticket: Sie erhalten zusätzlich kosten los eine verlässigkeit der Angaben der Ware bürgt der Aussteller. Eintrittskarte für die Antiquariatsmesse Stuttgart. Die Redaktion der Beiträge liegt bei den jeweiligen Ausstel- (siehe Seite 147) lerInnen. The ticket is also valid for the Stuttgart Antiquarian Book fair. The objects announced in this catalogue must be avai- lable for sale at the opening of the Antiquaria and may not be sold or firmly reserved before the beginning of the trade fair. -

Club Health Assessment MBR0087
Club Health Assessment for District 102 W through April 2016 Status Membership Reports LCIF Current YTD YTD YTD YTD Member Avg. length Months Yrs. Since Months Donations Member Members Members Net Net Count 12 of service Since Last President Vice No Since Last for current Club Club Charter Count Added Dropped Growth Growth% Months for dropped Last Officer Rotation President Active Activity Fiscal Number Name Date Ago members MMR *** Report Reported Email ** Report *** Year **** Number of times If below If net loss If no report When Number Notes the If no report on status quo 15 is greater in 3 more than of officers that in 12 within last members than 20% months one year repeat do not have months two years appears appears appears in appears in terms an active appears in in brackets in red in red red red indicated Email red Clubs less than two years old 123200 Riviera Chablais 10/07/2014 Active 31 5 0 5 19.23% 25 0 2 S N/R Clubs more than two years old 117302 3 SEEN/LACS 06/30/2012 Active 28 0 0 0 0.00% 27 0 N P,S,T 0 36012 AARETAL L C 08/21/1978 Active 34 1 0 1 3.03% 33 0 N P,S 12 37068 BANTIGER L C 05/17/1979 Active 48 7 5 2 4.35% 46 37 0 N P,S,T 13 41992 BERN & BUMPLIZ 11/30/1982 Active 49 1 2 -1 -2.00% 50 22 0 N P,S,M 12 52392 BERN ESPRIT 01/14/1992 Active 33 0 0 0 0.00% 32 0 N P,S,T 4 30013 BERN GRAUHOLZ 12/09/1974 Active 37 2 1 1 2.78% 36 41 0 N P,S,T,M 3 83149 BERN KIRCHENFELD 07/13/2004 Active 31 1 1 0 0.00% 30 2 0 N P,S,T,M 1 104699 BERN METROPOLITAN 03/13/2009 Active 41 0 3 -3 -6.82% 44 4 0 N T 6 40148 BERN WOHLENSEE 06/28/1981 -

Club Health Assessment MBR0087
Club Health Assessment for District 111BN through April 2021 Status Membership Reports Finance LCIF Current YTD YTD YTD YTD Member Avg. length Months Yrs. Since Months Donations Member Members Members Net Net Count 12 of service Since Last President Vice Since Last for current Club Club Charter Count Added Dropped Growth Growth% Months for dropped Last Officer Rotation President Activity Account Fiscal Number Name Date Ago members MMR *** Report Reported Report *** Balance Year **** Number of times If below If net loss If no When Number Notes the If no report on status quo 15 is greater report in 3 more than of officers thatin 12 months within last members than 20% months one year repeat do not haveappears in two years appears appears appears in appears in terms an active red Clubs more than two years old S,T,M,VP,MC 77732 AISCHGRUND 11/28/2003 Active 28 0 0 0 0.00% 27 0 N/A SC S,T,M,VP,MC 44375 ALTMUEHLTAL 11/26/1984 Active 33 0 0 0 0.00% 33 0 3 SC Exc Award (06/30/2020) S,T,M,VP,MC 21886 AMORBACH MILTENBERG 04/23/1965 Active 32 0 0 0 0.00% 32 0 15 SC S,T,M,VP,MC 21885 ANSBACH 05/03/1971 Active 44 0 0 0 0.00% 44 0 24+ SC 115650 ANSBACH CHRISTIANE 12/01/2011 Active 38 4 0 4 11.76% 35 2 S,T,M,VP,MC 24+ CHARLOTTE SC Exc Award (06/30/2018) S,T,M,VP,MC 21714 ASCHAFFENBURG 11/22/1958 Active 56 1 2 -1 -1.75% 57 33 0 12 SC 65277 ASCHAFFENBURG 04/26/2002 Active 45 0 0 0 0.00% 45 1 S,T,M,VP,MC 24+ POMPEJANUM SC 108515 ASCHAFFENBURG 05/28/2010 Active 35 0 1 -1 -2.78% 36 11 2 S,T,M,VP,MC N/A SCHÖNTAL SC S,T,M,VP,MC 43522 ASCHAFFENBURG-ALZENAU 02/15/1984 -

Fotokatalog Photographic Catalogue Catalogo Fotografico
Fotokatalog Photographic Catalogue Catalogo fotografico Source: http://www.khi.fi.it/5201080/Fotokataloge Stable URL: http://wwwuser.gwdg.de/~fotokat/Fotokataloge/Stoedtner_1935_1_l.pdf Published by: Photothek des Kunsthistorischen Instituts in Florenz, Max-Planck-Institut http://www.khi.fi.it '~'IIööiI;"",msausgabe 1895-1935 Deutsche Kunst LIOHTBILDVERLAa Dr. FRANZ STOEDTNER BERLIN C 2 DEUTSCHE KUNST von den Anfä-nge'n bis zu -r Gegenwart Dieser Katalog enthält nur kunstgeschichtliche Werke. Für die übri• gen Abteilungen: Geschichte, Literatur, Religion, Mlr<:hen, Geogra phie, Ethnographie, Geologie, Pbystk, Astronomie, Zoologie, Biolo (BAUKUNST, PLASTIK, MALEREI UND GRAPHIK) gie, Botanik, TeChnologie, Maschinenbau, Elektrotechnik und Medi zin sind besondere Verseichnlaae bsW. Ansichtaalben erschienen. B URgewählt und ZURammeng •• telit von E. A. Langbein Außenaufnahmen werden vom StandPunkt des Beaebauers bezeich net; also: von SW. Innenaufnahmen immer in der BUckrlchtung; al8.o: nach O. LlOHTBILDVERLAG Dr. FRANZ STOEDTNER BERLIN c 2 Zum Geleit. .vierzig Ja~rel . Eine lange Zeit zielbewußten Schaffens. Als Ich 1895 bel memem alten Lehrer Hermann Grimm darauf drang, als Erster an der Berliner Universität mit einem deut Vorwort. sche.n Thema !.':ians Holbein d. ä.J in deutscher Sprache pro ~~vler~n zu durfen, und bald durch meine eigene Vortrags Aus dem Lichtbilderarchiv von Dr. franz Stoedtner sind t~hgkelt erkannte, daß erst die Grundlage für die Erkennt von Hunderttausenden von Aufnahmen deutscher Kunst 3502 niS deutscher Kunst - die gute photographische Durcharbeit Bilder zu diesem Katalog zusammengestellt worden. des ~eimischen .Kunstgutes geschaffen werden mUßte, da Der unerschöpfliche Reichtum deutscher Kunst erlaubt zog .!ch durch dIe deutschen Lande, spürte die kostbaren in jedem Fall nur eine Auswahl. -

Bremen Roland in Germany
Bremen Roland in Germany Bremen Roland : Statue of Roland in the market square of Bremen, Germany Bremen Roland is a famous statue of Roland in the market square, or Rathausplatz, of Bremen, Germany. Roland was a knight of the first Holy Roman Emperor Charlemagne, and a hero of the Battle of Roncevaux Pass, in which he died. Roland became a paladin of Charlemagne's court, one of 12 warriors found in French literature's "Matter of France." Roland stands in the center of the town, next to the town hall and the city cathedral. The statue depicts Roland as the protector of the city, as he valiantly holds a sword and a shield with the two-headed Imperial eagle, a symbol of Germany. The shield is inscribed with a declaration translating to: “I manifest your freedom, as granted to this city by Charlemagne and many other rulers. For this, be thankful to God, that is my counsel.” The Bremen Roland statue is a symbol for freedom and market rights, thus his location is adjacent to the marketplace. Though there are other similar Roland statues around Germany, the Bremen statue became a UNESCO World Heritage Site because of the exemplary style of the earliest of these statues. The dress of the young man portrayed in the statue along with long wavy hair is reminiscent of the 15th century fashion. A lute-playing angel rests on the catch of his belt. Roland's facing the cathedral, the seat of the archbishop has been an issue of dispute for centuries. It is because Ronald became the first Holy Roman Emperor over Bremen and symbolically challenged the clergy. -

Annual Report
FRAUNHOFER INSTITUTE OF OPTRONICS, SYSTEM TECHNOLOGIES AND IMAGE EXPLOITATION FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR OPTRONIK, SYSTEMTECHNIK UND BILDAUSWERTUNG IOSB KARLSRUHE FRAUNHOFERSTRASSE 1 76131 KARLSRUHE TELEFON +49 721 6091-0 ETTLINGEN GUTLEUTHAUSSTRASSE 1 76275 ETTLINGEN TELEFON +49 7243 992-0 ILMENAU INSTITUTSTEIL ANGEWANDTE SYSTEMTECHNIK (AST) AM VOGELHERD 50 98693 ILMENAU TELEFON +49 3677 461-0 GÖRLITZ INSTITUTSTEIL ANGEWANDTE SYSTEMTECHNIK (AST) AUSSENSTELLE GÖRLITZ ABTEILUNG ENERGIE BRÜCKENSTRASSE 1 02826 GÖRLITZ TELEFON +49 3581 7925354 LEMGO INSTITUTSTEIL FÜR INDUSTRIELLE AUTOMATION (INA) LANGENBRUCH 6 32657 LEMGO TELEFON +49 5261 94290-22 ANNUAL REPORT WWW.IOSB.FRAUNHOFER.DE Fraunhofer IOSB Annual Report 2017 / 2018 2017 / 2018 FRAUNHOFER UNITS IN GERMANY FRAUNHOFER IOSB IN A NUTSHELL Development of innovative cameras. Optimal use and networking of sensors. Processing and analyzing the resulting data streams according to the task at hand, leading to decision Funding support systems for humans or intelligent control mechanisms for autonomous systems. This comprehensive process and exploitation chain, which comprises and combines the core competences Optronics, System Technologies and Image Public sector Industrial sector 24,6% Exploitation, is our domain at Fraunhofer IOSB. 36,7% Our expertise comes to use in areas as diverse as automation, inspection or security. Like the Fraunhofer-Gesellschaft as a Others 5,9% whole, we are committed to application-oriented research Basic funding for the benefi t of society and economy. We shape the