Augsburger Volkskundliche Nachrichten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

II Congresso Internacional As Aves 2018
EVOLUÇÃO Revista de Geistória e Pré-História SÉRIE I, Nº. 2, VOLUME 1 LISBOA. MAIO. 2018 EVOLUÇÃO - Revista de Geistória e Pré-História. 2 (1).2018 CENTRO PORTUGUÊS DE GEO-HISTÓRIA E PRÉ-HISTÓRIA O Centro Português de Geo-História e Pré-História é uma associação sem fins lucrativos Fundada em 15 de fevereiro de 1995, é reconhecida como Entidade de Utilidade Pública desde 2017. Tem por objetivos o fomento e o desenvolvimento de atividades de investigação e de divulgação nos campos científicos da Geo- História e Pré-História. CONCELHO CIENTÍFICO DO CPGP: Paleontologia / Estratigrafia / Paleobotânica: Silvério Figueiredo; Mário Mendes; Pedro Proença Cunha; Ioanna Bachtsevanidou Strantzali Pré-História / Arte Rupestre: Telmo Pereira; Luís Raposo; Luiz Oosterbeek; Fernando Coimbra Geografia Rita Anastácio EVOLUÇÃO. REVISTA DE GEISTÓRIA E PRÉ-HISTÓRIA A Evolução. Revista de Geistória e Pré-História é uma revista de divulgação Científica, publicada pelo Centro Português de Geo-História e Pré-História e tem por objetivo principal contribuir para o desenvolvimento da divulgação científica, através da publicação de artigos e de trabalhos de investigação, divulgação e informação, de autores ou investigadores nacionais ou estrangeiros, nas áreas da Geistória e da Pré-História, podendo estes artigos ser de âmbito nacional ou internacional. CONCELHO EDITORIAL: Silvério Figueiredo; Fernando Coimbra; David Barão; Sofia Silvério; Fernanda Sousa; Ioanna Bachtsevanidou Strantzali; Marta Gomes. Depósito Legal: 189274/02 ISSN:1645-6297 Impressão: CWORLD (Pinhal Novo) Edição: Centro Português de Geo-História e Pré-História Periodicidade: anual Designe gráfico: Fernanda Sousa Sem autorização expressa do editor, não é permitida a reprodução parcial ou total dos artigos desta revista, desde que tal reprodução não decorra das finalidades específicas da divulgação e da crítica. -

El Profesorado De Universidad Del Tercer Milenio. El Nuevo Horizonte De Sus Funciones Y Responsabilidades
El profesorado de Universidad del Tercer Milenio. El nuevo… El profesorado de Universidad del Tercer Milenio. El nuevo horizonte de sus funciones y responsabilidades por José A. IBÁÑEZ-MARTÍN Universidad Complutense de Madrid 1. Introducción conjunto de amplias modificaciones lega- Una de las más grandes aportaciones les en el ámbito educativo, con el deseo de de Europa a la cultura universal ha sido la corregir las inadecuaciones, los errores y creación de la institución universitaria, cla- los efectos perversos de las leyes que desa- ramente más antigua que el Estado. Han rrollaron el artículo 27 de nuestra Consti- pasado muchos siglos, quizá podemos tución. Esas reformas eran urgentes y remontarnos a la Academia platónica y tal confío en que de ellas se obtengan frutos vez a la liga pitagórica, desde que apare- positivos. Ahora bien, las estructuras lega- año LIX, n.º 220, septiembre-diciembre 2001, 441-466 cieron los primeros lugares en los que se les no son suficientes para responder al pretendía proporcionar un saber superior gran reto ante el que encuentra hoy la Uni- —y libre de las imposiciones del poder po- versidad, ya que la cuestión más grave a lítico— a los jóvenes adultos. A partir de la que hemos de responder no es tanto la organización del gobierno universitario o entonces se fue configurando lo que hoy revista española de pedagogía llamamos Universidad, siguiendo una com- los sistemas de selección del profesorado, pleja evolución, que no siempre supo res- cuanto cómo avizorar los nuevos caminos ponder con acierto a los cambios sociales, que la Universidad debe seguir para res- pero sí tuvo la inteligencia imprescindible ponder acertadamente a las actuales cir- como para permitir su supervivencia y con- cunstancias sociales, muy distintas de las solidación. -

On the Months (De Mensibus) (Lewiston, 2013)
John Lydus On the Months (De mensibus) Translated with introduction and annotations by Mischa Hooker 2nd edition (2017) ii TABLE OF CONTENTS Abbreviations .......................................................................................... iv Introduction .............................................................................................. v On the Months: Book 1 ............................................................................... 1 On the Months: Book 2 ............................................................................ 17 On the Months: Book 3 ............................................................................ 33 On the Months: Book 4 January ......................................................................................... 55 February ....................................................................................... 76 March ............................................................................................. 85 April ............................................................................................ 109 May ............................................................................................. 123 June ............................................................................................ 134 July ............................................................................................. 140 August ........................................................................................ 147 September ................................................................................ -

Discentes Vol. 1 No. 1
Discentes Volume 1 Issue 1 Volume 1, Issue 1 Article 1 2016 Discentes Vol. 1 No. 1 Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/discentesjournal Part of the Ancient, Medieval, Renaissance and Baroque Art and Architecture Commons, Classics Commons, and the History Commons Recommended Citation . 2016. "Discentes Vol. 1 No. 1." Discentes 1, (1). https://repository.upenn.edu/discentesjournal/vol1/iss1/ 1 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/discentesjournal/vol1/iss1/1 For more information, please contact [email protected]. Discentes Vol. 1 No. 1 This full issue is available in Discentes: https://repository.upenn.edu/discentesjournal/vol1/iss1/1 DISCENTES December 2012 Discentes Vol. I, No. I December 2012 The undergraduate magazine for the Department of Classical Studies at the University of Pennsylvania Editors-in-Chief Carson Woodbury and Laura Santander Research Editor News Editor James Levy Alethea Roe Faculty Advisor James Ker Cover illustration by Laura Santander. 2 Contents from the editors 5 News 7 ResearcH Reconciling Physical Mortality with Literary Immortality: The Lyric Poets Sappho and Horace on Old Age By Charlotte Edelson 12 Recycling Homer in Greco-Roman Egypt: The Appreciation and Consumption of Homeric Papyri By Laura Santander 24 The Making of a Statesman: Demosthenes’ Philippics and the Education of James Madison By Madeleine Brown 37 The Survival of Winged Victory in Christian Late Antiquity By Jesse DuBois 42 Xenia Perverted: Guest-host Relationships in Apuleius’ Metamorphoses By Noreen Sit 59 Conversations Professor Jeremy McInerney 70 Darien Perez 78 3 Final Thoughts Aphrodite By Amy Conwell 80 Why I’m a Hellenist By James Levy 81 4 from the editors The idea for Discentes sprung from melancholy tidings. -

Prolegomena to the Automated Analysis of a Bilingual Poetry Corpus, with Particular Reference to an Annotated Edition of “The Cantos” of Ezra Pound
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2016 Prolegomena To The Automated Analysis Of A Bilingual Poetry Corpus, With Particular Reference To An Annotated Edition Of “the Cantos” Of Ezra Pound Robin Seguy University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the English Language and Literature Commons Recommended Citation Seguy, Robin, "Prolegomena To The Automated Analysis Of A Bilingual Poetry Corpus, With Particular Reference To An Annotated Edition Of “the Cantos” Of Ezra Pound" (2016). Publicly Accessible Penn Dissertations. 2576. https://repository.upenn.edu/edissertations/2576 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/2576 For more information, please contact [email protected]. Prolegomena To The Automated Analysis Of A Bilingual Poetry Corpus, With Particular Reference To An Annotated Edition Of “the Cantos” Of Ezra Pound Abstract Standing at the intersection of a theoretical investigation into the possibilities of applying the tools and methods of automated analysis to a large plurilingual poetry corpus and of a set of observables gleaned along the creation of a digitally annotated edition of The Cantos of Ezra Pound — a robust test-case for the TEI — the present dissertation can be read under different guises. One of them, for instance, would be that of a comedy, divina commedia or com�dia de Deus, in which the computer plays — Leibnizian harmonics! — the part of supreme intellect. A: The selva oscura is that of newly born “Digital Humanities” — burgeoning yet obscured already by two dominant paradigms. On the one hand, the constructivism inherited from poststructuralist theory; on the other, a na�ve return to the most trivial kind of linguistic realism. -

Thola Magazine V16.Pdf
VOLUME 16. 2013 / 14 SAFE HAVEN Claire Hodgkinson recounts the story of saving orphaned baboons and keeping Durban’s Centre for the Rehabilitation of Wildlife alive. BIRD’S EYE VIEW David Allan reveals the frightening decline in waterbirds in Durban Bay over the last 14 years. A museum about the earth, its history and life on earth, both past and present. (Photo: Charles Krebs – www.krebsmicro.com) thola VOLUME 16. 2013 / 14 3 Comments Page Letter from 4 Director’s Report the Editor 8 Pigeon Valley 10 SANBI Collaboration welcome 13 Library Department Thola first emerged as the Museum’s popular magazine in 2011. At that time, 14 Mammalogy Department I’d just finished serving a stint as ‘acting-director’ of the Museum. Well this year I drew a similar, but much less onerous, sentence as your ‘acting-editor’. As you 20 SAASTEC Conference 2013 will read elsewhere in this edition, our regular editor, Kirstin Williams, was on 22 Special Report: CROW a sabbatical completing her PhD and Allison Ruiters, our Director, asked me to steer Thola through to publication. I’ve edited the Museum’s scientific journal 26 Palaeontology Department Durban Natural Science Museum Novitates since I joined the Museum as long ago as 1996, so I’ve some experience with the pleasure and pain of the task. As 30 Exhibitions Department a popular product, Thola has been more fun to work with than the Novitates but 35 Wind Repowering Project its multi-faceted nature has rendered it equally challenging. In the pages that follow, there are the usual departmental report-backs, packed 38 Herpetology Department with evidence of exciting progress on many fronts, and we welcome no less than five new staff appointments, all involving young and dynamic individuals. -
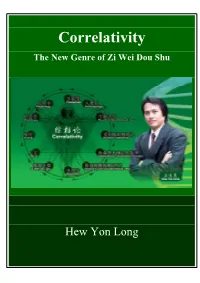
Correlativity: the New Genre of Zi Wei Dou
Correlativity The New Genre of Zi Wei Dou Shu Hew Yon Long About the Author . Born in Malaysia, in 1964. Graduated with a Bachelor of Science in Civil Engineering from the University of Tennessee, Knoxville, USA in 1988. Appointed by the University of Tennessee’s International Student Association as a Psychological Counselor in 1989. Obtained his Masters of Science in Civil Copyright © 2016 Hew Yon Long Engineering and Environmental Science in 1990 from the same university. ISBN 978-983-44693-6-8 . Worked as an Environmentalist at Law Associates, the environmental firm in Atlanta, All rights reserved. No part of this publication USA in 1990. Obtained his Professional Civil may be reproduced, stored in a retrieval system or Engineer Licence in 1998. transmitted in any form or by any means, . Published English books "The Purple Star electronic, mechanical, photocopying, recording System" in 1999, "Chinese Astrology: The or otherwise without the prior permission of the author. Scientific Ways in 2000, "Chinese Astrology: Advanced Scientific Way" in 2002, and Chinese book "Ziwei Xingtai Shuxue" in 2003. Perpustakaan Negara Malaysia . Was invited to present "Ziwei Xingtai Shuxue" Cataloguing-in-Publication Data which literally means the morphological and mathematical ways of Zi Wei Dou Shu (in Hew, Yon Long, 1964- Mandarin) in the World Yi Jing Convention Correlativity 2001 held in Singapore. The New Genre of Zi Wei Dou Shu / . Was honored by Professor Wang Hui, the Hew, Yon Long. President of Yi Jing (I-Ching) Research Center, Nanjing, China in 2002 for his ISBN 978-983-44693-6-8 contributions in promoting Chinese wisdoms to the western world. -

POLYMATHEIA Művelődés- És Neveléstörténeti Folyóirat
POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat XVII. évfolyam, 2020. 1-2. szám POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat A KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM FOLYÓIRATA Felelős kiadó: SZABÓ PÉTER OTTÓ rektor Szerkesztőbizottság: SZABÓ PÉTER OTTÓ, a szerkesztőbizottság elnöke AMBRUSNÉ KÉRI KATALIN (Pécs), CSORBA LÁSZLÓ (Budapest), CSURGAI – HORVÁTH JÓZSEF (Székesfehérvár), GÉCZI JÁNOS (Balatonalmádi), JUHÁSZ ERIKA (Debrecen), KELEMEN ELEMÉR (Budapest), KOVÁCS KISS GYÖNGY (Kolozsvár), KOVÁTS-NÉMETH MÁRIA (Győr), LIPCSEI IMRE (Szarvas), MONOK ISTVÁN (Szeged), LORMAN, THOMAS (London), SÁNTHA KÁLMÁN (Székesfehérvár), SEIDLER, ANDREA (Bécs), SZATMÁRI PÉTER (Budapest), TOTH, ANDREJ (Prága), VIZI LÁSZLÓ TAMÁS (Székesfehérvár), YOO JINIL (Szöul), ZACHAR PÉTER KRISZTIÁN (Budapest) Szakmai támogató: MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottság Neveléstörténeti Munkabizottsága Főszerkesztő: SIMÁNDI IRÉN Főszerkesztő-helyettes: KOUDELA PÁL A szerkesztőség munkatársai: BESSENYEI JÁNOS technikai szerkesztő JEDLICA, IAN angol anyanyelvi lektor TISZÓCZI TAMÁS olvasószerkesztő SZABÓ ANDREA szerkesztőségi titkár Borító: HERVAI LAURA A kötetet tervezte: BESSENYEI JÁNOS Nyomdai kivitelezés: Quadrat '64 Kiadó: Szerkesztőség: Kodolányi János Egyetem Kodolányi János Egyetem 5904 Orosháza, Gyopárosi u. 3/f. 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56. Telefon: +36 30 478 52 79 Telefon: +36 30 478 52 79 E-mail cím: [email protected] Honlap: www.polymatheia.hu HU ISSN 2732-2092 (nyomtatott) HU ISSN 2732-2521 (online) TARTALOMJEGYZÉKTARTALOMJEGYZÉK -

Protágoras, O Homem E Sua Medida
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DANILO PEREIRA DOS SANTOS OBSERVAÇÕES SOBRE A DOUTRINA DO HOMEM-MEDIDA: UMA TENTATIVA DE RECONSTITUIÇÃO DO PENSAMENTO DE PROTÁGORAS MARINGÁ-PR 2017 DANILO PEREIRA DOS SANTOS OBSERVAÇÕES SOBRE A DOUTRINA DO HOMEM-MEDIDA: UMA TENTATIVA DE RECONSTITUIÇÃO DO PENSAMENTO DE PROTÁGORAS Dissertação de Mestrado apresentada ao Pro- grama de Pós-graduação em Filosofia do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Univer- sidade Estadual de Maringá, como condição para a obtenção do grau de Mestre em Filosofia sob a orientação do Prof. Dr. Vladimir Chaves dos San- tos. Este exemplar corresponde à versão preliminar da dissertação a ser aprovada perante Banca Exami- nadora. MARINGÁ-PR 2017 DANILO PEREIRA DOS SANTOS OBSERVAÇÕES SOBRE A DOUTRINA DO HOMEM-MEDIDA: UMA TENTATIVA DE RECONSTITUIÇÃO DO PENSAMENTO DE PROTÁGORAS Dissertação de Mestrado apresentada ao Pro- grama de Pós-graduação em Filosofia do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Univer- sidade Estadual de Maringá, como condição para a obtenção do grau de Mestre em Filosofia sob a orientação do Prof. Dr. Vladimir Chaves dos San- tos. Este exemplar corresponde à versão preliminar da dissertação a ser aprovada perante Banca Exami- nadora. Aprovado em: BANCA EXAMINADORA ____________________________________ Prof. Vladimir Chaves dos Santos Universidade Estadual de Maringá ____________________________________ Prof. Mateus Ricardo Fernandes Ferreira Universidade Estadual de -

Download (3MB)
POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat XVII. évfolyam, 2020. 3-4. szám POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat A KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM FOLYÓIRATA Felelős kiadó: SZABÓ PÉTER OTTÓ rektor Szerkesztőbizottság: SZABÓ PÉTER OTTÓ, a szerkesztőbizottság elnöke AMBRUSNÉ KÉRI KATALIN (Pécs), CSORBA LÁSZLÓ (Budapest), CSURGAI – HORVÁTH JÓZSEF (Székesfehérvár), GÉCZI JÁNOS (Balatonalmádi), JUHÁSZ ERIKA (Debrecen), KELEMEN ELEMÉR (Budapest), KOVÁCS KISS GYÖNGY (Kolozsvár), KOVÁTS-NÉMETH MÁRIA (Győr), LIPCSEI IMRE (Szarvas), MONOK ISTVÁN (Szeged), LORMAN, THOMAS (London), SÁNTHA KÁLMÁN (Székesfehérvár), SEIDLER, ANDREA (Bécs), SZATMÁRI PÉTER (Budapest), TOTH, ANDREJ (Prága), VIZI LÁSZLÓ TAMÁS (Székesfehérvár), YOO JINIL (Szöul), ZACHAR PÉTER KRISZTIÁN (Budapest) Szakmai támogató: MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottság Neveléstörténeti Munkabizottsága Főszerkesztő: SIMÁNDI IRÉN Főszerkesztő-helyettes: KOUDELA PÁL A szerkesztőség munkatársai: BESSENYEI JÁNOS technikai szerkesztő JEDLICA, IAN angol anyanyelvi lektor TISZÓCZI TAMÁS olvasószerkesztő SZABÓ ANDREA szerkesztőségi titkár Borító: HERVAI LAURA A kötetet tervezte: BESSENYEI JÁNOS Nyomdai kivitelezés: Quadrat '64 Kiadó: Szerkesztőség: Kodolányi János Egyetem Kodolányi János Egyetem 5904 Orosháza, Gyopárosi u. 3/f. 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56. Telefon: +36 30 478 52 79 Telefon: +36 30 478 52 79 E-mail cím: [email protected] Honlap: www.polymatheia.hu HU ISSN 2732-2092 (nyomtatott) HU ISSN 2732-2521 (online) TARTALOMJEGYZÉK MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET -
Violência, Mito E Destino: Para Uma Crítica Do Direito Com Base Em Walter Benjamin
Universidade Estadual do Ceará Ivoneide Fernandes Rodrigues Violência, mito e destino: para uma crítica do Direito com base em Walter Benjamin Dissertação de Mestrado Fortaleza - Ceará 2010 Ivoneide Fernandes Rodrigues Violência, mito e destino: para uma crítica do Direito com base em Walter Benjamin Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Filosofia do Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará como requisito parcial para a obtenção do grau de mestre em filosofia. Orientador: Prof. Dr. João Emiliano Fortaleza de Aquino Linha de Pesquisa: Ética e Filosofia Social e Política Fortaleza - CE 2010 2 Folha de Aprovação Título do trabalho: Violência, mito e destino: para uma crítica do Direito com base em Walter Benjamin Autora: Ivoneide Fernandes Rodrigues Prof.-Orientador: Prof. Dr. João Emiliano Fortaleza de Aquino Defesa pública em 29/06/2010 Nota obtida: 10,0 (dez) Banca Examinadora ________________________________________________ João Emiliano Fortaleza de Aquino, Dr. Presidente da Banca ________________________________________________ Carla Milani Damião, Dra. 1ª Examinadora ________________________________________________ Ilana Viana do Amaral, Dra. 2ª Examinadora 3 Enquanto houver um mendigo, ainda haverá mito. Walter Benjamin 4 Ao meu pai, por me ensinar a ver a vida com leveza. A minha mãe por me ensinar a ver a vida com determinação. Ao João Pedro, por me chamar a viver . 5 Agradecimentos Ao João Pedro, que comigo às vezes ganha, às vezes perde. Mas sempre comigo. Ao João Emiliano, orientador, amigo, companheiro. Com sua sabedoria e paciência sabe o que falar em cada hora, sabe que a linguagem não é meramente uma formulação conceitual. A minha família. Meus pais, por me ajudarem a acreditar na vida e nas pessoas. -

Using Ostraca in the Ancient World Materiale Textkulturen
Using Ostraca in the Ancient World Materiale Textkulturen Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 933 Herausgegeben von Ludger Lieb Wissenschaftlicher Beirat: Jan Christian Gertz, Markus Hilgert, Hanna Liss, Bernd Schneidmüller, Melanie Trede und Christian Witschel Band 32 Using Ostraca in the Ancient World New Discoveries and Methodologies Edited by Clementina Caputo and Julia Lougovaya ISBN 978-3-11-071286-5 e-ISBN (PDF) 978-3-11-071290-2 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-071295-7 ISSN 2198-6932 DOI https://doi.org/10.1515/9783110712902 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- NoDerivatives 4.0 International License. For details go to http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Control Number: 2020947108 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2020 Clementina Caputo and Julia Lougovaya, published by Walter de Gruyter GmbH, Berlin/ Boston The book is published open access at www.degruyter.com. Typesetting: Sonderforschungsbereich 933 (Nicolai Schmitt), Heidelberg Cover: Ostracon from the praesidium of Didymoi, O. Did. inv. 445; © Adam Bülow-Jacobsen. Printing and binding: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com Contents Clementina Caputo and Julia Lougovaya Introduction 1 I Documentation and Interpretation of Ostraca as Archaeological Objects Paola Davoli Papyri and Ostraca as Archaeological