Revision Der Gattung Ateliotum ZELLER , 1839
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

New and Poorly Known Tineidae from the Western Palaearctic
©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/ Beitr. Ent. Keltern ISSN 0005 - 805X 61 (2011) 2 S. 357 - 370 10.11.2011 New and poorly known Tineidae from the Western Palaearctic (Lepidoptera) With 30 figures R e in h a r d G a e d ik e Summary As the result of the study of tineid material, which was collected in numerous countries of Western Palaearctic, were etablished first records for 8 countries, two of them are first records for Europe. The mate rial contains four species, which are described as new species: Neurothaumasia tenuipennella, Neurothaumasia tunesiella, Infurcitinea corleyi and Ateliotum larseni. From Matratinea rufulicaput Szir aki & Sz ö c s, 1990 and Anomalotinea gardesanella (H a rtig , 1950) were described and illustrated the female genitalia for the first time, from Elatobia bugrai K ocak, 1981 were described and illustrated the male genitalia for the first time. The examination of the type series of Euplocamus anthracinalis amanalis O st h e ld e r , 1936 shows, that this taxon is a new synonym of Euplocamus delagrangei R ag o n o t, 1895. There was designated and selected the lectotype for Euplocamus anthracinalis amanalis O st h e l d e r , 1936. Zusammenfassung Im Ergebnis der Untersuchung von Tineiden-Material, welches in zahlreichen Ländern der Westpaläarktis gesammelt wurde, konnten für 8 Länder Erstfunde festgestellt werden, zwei davon sind Erstfunde für Europa. Das Material enthielt vier Arten, die als neue Arten beschrieben werden: Neurothaumasia tenuipennella, Neurothaumasia tunesiella, Infurcitinea corleyi und Ateliotum larseni. Von Matratinea rufulicaput Sziraki & Sz ö c s, 1990 undAnomalotinea gardesanella (H artig, 1950) werden erstmals die weiblichen Genitalien abge bildet und beschrieben, vonElatobia bugrai K ocak, 1981 werden erstmals die männlichen Genitalien abge bildet und beschrieben. -

Recerca I Territori V12 B (002)(1).Pdf
Butterfly and moths in l’Empordà and their response to global change Recerca i territori Volume 12 NUMBER 12 / SEPTEMBER 2020 Edition Graphic design Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis Mostra Comunicació Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter Museu de la Mediterrània Printing Gràfiques Agustí Coordinadors of the volume Constantí Stefanescu, Tristan Lafranchis ISSN: 2013-5939 Dipòsit legal: GI 896-2020 “Recerca i Territori” Collection Coordinator Printed on recycled paper Cyclus print Xavier Quintana With the support of: Summary Foreword ......................................................................................................................................................................................................... 7 Xavier Quintana Butterflies of the Montgrí-Baix Ter region ................................................................................................................. 11 Tristan Lafranchis Moths of the Montgrí-Baix Ter region ............................................................................................................................31 Tristan Lafranchis The dispersion of Lepidoptera in the Montgrí-Baix Ter region ...........................................................51 Tristan Lafranchis Three decades of butterfly monitoring at El Cortalet ...................................................................................69 (Aiguamolls de l’Empordà Natural Park) Constantí Stefanescu Effects of abandonment and restoration in Mediterranean meadows .......................................87 -

Systematic Treatment of the Genera and Species of the European Tineidae (Part II)
Chapter 2 Systematic Treatment of the Genera and Species of the European Tineidae (Part II) Myrmecozelinae Myrmecozelinae Capuşe, 1968 [March 15]: Pachyarthra Amsel, 1940 137. Type-genus: Myrmecozela Zeller, 1852. Pachyarthra Amsel, 1940: 55. Myrmecozelinae Zagulajev, 1968 [after Type species: Amydria ochroplicella March 26]: 220. Chrétien, 1915. Type-genus: Myrmecozela Zeller, 1852. Haplotineini Zagulajev, 1963: 371. Description. Medium-sized species Type-genus: Haplotinea Diakonoff & with wingspan from 15–30 mm, females Hinton, 1956. larger than males. Pattern on forewing Ceratuncini Capuşe, 1964: 93. often very variable. Antenna: segments of Type-genus: Ceratuncus Petersen, 1957. flagellum clearly broader than long, males Cephimallotini Zagulajev, 1965: 386. with thicker antenna than females. Type-genus: Cephimallota Bruand, 1851. Separated from the other genera of the Rhodobatinae Capuşe, 1968: 73. subfamily, especially from Myrmecozela, by Type-genus: Rhodobates Ragonot, 1895. characteristic structures in the genitalia. Ateliotini Zagulajev, 1975b: 202. Male genitalia. Uncus with two Type-genus: Ateliotum Zeller, 1839. long socii, gnathos arms angled before 1/2, Protaphreutini Capuşe, 1971: 232. vinculum more or less narrow, without Type-genus: Protaphreutis Meyrick, 1922. saccus; valva parallel, last third narrowing Syncalypsini Capuşe, 1971: 234. to a more or less pointed apex; phallus Type-genus: Syncalypsis Gozmány, 1965b. nearly right-angled. Hilaropterini Capuşe, 1971: 234. Female genitalia. Anterior apophy- Type-genus: Hilaroptera Gozmány, 1969. ses short, unforked, oviscapt short too. Phthoropoeinae Gozmány & Vári, 1973: 10. Distribution. In the Palaearctic Type-genus: Phthoropoea Walsingham, Region from North Africa to Nepal with 11 1896. species (one species known from East Sudan), one species is known from Europe. Remarks. Date of issue of the paper of Bionomics. -

The Entomologist's Record and Journal of Variation
M DC, — _ CO ^. E CO iliSNrNVINOSHilWS' S3ldVyan~LIBRARlES*"SMITHS0N!AN~lNSTITUTl0N N' oCO z to Z (/>*Z COZ ^RIES SMITHSONIAN_INSTITUTlON NOIiniIiSNI_NVINOSHllWS S3ldVaan_L: iiiSNi'^NviNOSHiiNS S3iavyan libraries Smithsonian institution N( — > Z r- 2 r" Z 2to LI ^R I ES^'SMITHSONIAN INSTITUTlON'"NOIini!iSNI~NVINOSHilVMS' S3 I b VM 8 11 w </» z z z n g ^^ liiiSNi NviNOSHims S3iyvyan libraries Smithsonian institution N' 2><^ =: to =: t/J t/i </> Z _J Z -I ARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiniliSNI NVINOSHilWS SSIdVyan L — — </> — to >'. ± CO uiiSNi NViNosHiiws S3iyvaan libraries Smithsonian institution n CO <fi Z "ZL ~,f. 2 .V ^ oCO 0r Vo^^c>/ - -^^r- - 2 ^ > ^^^^— i ^ > CO z to * z to * z ARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNl NVINOSHllWS S3iaVdan L to 2 ^ '^ ^ z "^ O v.- - NiOmst^liS^> Q Z * -J Z I ID DAD I re CH^ITUCnMIAM IMOTtTIITinM / c. — t" — (/) \ Z fj. Nl NVINOSHIIINS S3 I M Vd I 8 H L B R AR I ES, SMITHSONlAN~INSTITUTION NOIlfl :S^SMITHS0NIAN_ INSTITUTION N0liniliSNI__NIVIN0SHillMs'^S3 I 8 VM 8 nf LI B R, ^Jl"!NVINOSHimS^S3iavyan"'LIBRARIES^SMITHS0NIAN~'lNSTITUTI0N^NOIin L '~^' ^ [I ^ d 2 OJ .^ . ° /<SS^ CD /<dSi^ 2 .^^^. ro /l^2l^!^ 2 /<^ > ^'^^ ^ ..... ^ - m x^^osvAVix ^' m S SMITHSONIAN INSTITUTION — NOIlfliliSNrNVINOSHimS^SS iyvyan~LIBR/ S "^ ^ ^ c/> z 2 O _ Xto Iz JI_NVIN0SH1I1/MS^S3 I a Vd a n^LI B RAR I ES'^SMITHSONIAN JNSTITUTION "^NOlin Z -I 2 _j 2 _j S SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNI NVINOSHilWS S3iyVaan LI BR/ 2: r- — 2 r- z NVINOSHiltNS ^1 S3 I MVy I 8 n~L B R AR I Es'^SMITHSONIAN'iNSTITUTIOn'^ NOlin ^^^>^ CO z w • z i ^^ > ^ s smithsonian_institution NoiiniiiSNi to NviNosHiiws'^ss I dVH a n^Li br; <n / .* -5^ \^A DO « ^\t PUBLISHED BI-MONTHLY ENTOMOLOGIST'S RECORD AND Journal of Variation Edited by P.A. -

The Scientific Publications of Dr László Gozmány (1921 2006) on Lepidoptera with a Revised Bibliography and an Annotated List of Taxon Names He Proposed
ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI Volume 103 Budapest, 2011 pp. 373–428 The scientific publications of Dr László Gozmány (1921 2006) on Lepidoptera with a revised bibliography and an annotated list of taxon names he proposed ZS. BÁLINT1, G. KATONA1 & A. KUN2 1 Department of Zoology, Hungarian Natural History Museum H-1088 Budapest, Baross utca 13, Hungary. E-mails: [email protected], [email protected] 2 H-2089 Telki, Berkenye u. 46, Hungary. E-mail: [email protected] – The complete bibliographic list of 141 scientific works on Lepidoptera written by Dr LÁSZLÓ GOZMÁNY, former curator of Lepidoptera in the Hungarian Natural History Museum, is presented with reference to 800 names he proposed. The bibliography is supp- lemented by the catalogue of the names arranged according to family-group (13), genus- group (150) and species-group (637) names and listed in alphabetical order with reference to original description, type status, sex, country of origin, type locality and depositor. With 6 figures. –LÁSZLÓ GOZMÁNY, bibliography, list of taxon names, Microlepidoptera, Hungarian Natural History Museum. INTRODUCTION Five years elapsed since the curator emeritus of the Lepidoptera col- lection, the renowned Microlepidoptera specialist of the Hungarian Natu- ral History Museum, Dr LÁSZLÓ GOZMÁNY passed away. The festive volume of the journal Acta zoologica Academiae scientiarum hungaricae for his 85th anniversary was only posthumously published (BÁLINT 2007), which actually included the funeral oration (MATSKÁSI 2007). In the same year two commemorations were published in the journals of the two lepi- dopterists’ societies, where he had been elected as honorary member (BÁLINT et al. -

Nota Lepidopterologica
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Nota lepidopterologica Jahr/Year: 2011 Band/Volume: 34 Autor(en)/Author(s): Gaedike Reinhard, Mally Richard Artikel/Article: On the taxonomic status of Cephimallota angusticostella (Zeller) and C crassiflavella Bruand (Tineidae) 115-130 ©Societas Europaea Lepidopterologica; download unter http://www.biodiversitylibrary.org/ und www.zobodat.at Nota lepid. 34 (2): 115-130 115 On the taxonomic status of Cephimallota angusticostella (Zeller) and C crassiflavella Bruand (Tineidae) ^ Reinhard Gaedike ' & Richard Mally ' Flomsstraße 5, 53225 Bonn, Germany; [email protected] 2 Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, Museum für Tierkunde, Königsbrücker Landstraße 159, 01109 Dresden, Germany; [email protected] Abstract. Cephimallota angusticostella (Zeller, 1839) and C. crassiflavella Bruand, 1851 are two Pa- laearctic Tineidae species which have been recognised as well differentiated taxa. The observation of variability in the male saccus caused doubt about the status of the two taxa and prompted us to initiate a detailed study of the male genital morphology. In this study we found a distinct variability in the shape of the saccus only in C crassiflavella, and not in C. angusticostella. The differences in external and genital morphology are corroborated by molecular analyses (DNA barcoding). The morphological and molecular data are discussed in the context of the determined distribution of the two taxa. Zusümmenfsissung. Cephimallota angusticostella {ZqWqy, 1839) und C crassiflavella Bruand, 1851 stellen zwei palaearktische, als gut unterscheidbar angesehene Tineidae-Arten dar. Die Beobachtung von Varia- bilität im männlichen Saccus ließ Zweifel zum Status der beiden Taxa aufkommen und war Anlass einer de- taillierten Untersuchung der morphologischen Strukturen der männlichen Genitalien. -
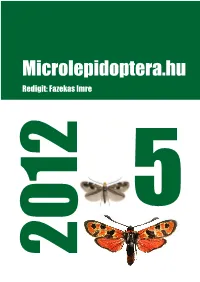
Microlepidoptera.Hu Redigit: Fazekas Imre
Microlepidoptera.hu Redigit: Fazekas Imre 5 2012 Microlepidoptera.hu A magyar Microlepidoptera kutatások hírei Hungarian Microlepidoptera News A journal focussed on Hungarian Microlepidopterology Kiadó—Publisher: Regiograf Intézet – Regiograf Institute Szerkesztő – Editor: Fazekas Imre, e‐mail: [email protected] Társszerkesztők – Co‐editors: Pastorális Gábor, e‐mail: [email protected]; Szeőke Kálmán, e‐mail: [email protected] HU ISSN 2062–6738 Microlepidoptera.hu 5: 1–146. http://www.microlepidoptera.hu 2012.12.20. Tartalom – Contents Elterjedés, biológia, Magyarország – Distribution, biology, Hungary Buschmann F.: Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához – Additional data Zygaenidae fauna of Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) ............................... 3–7 Buschmann F.: Két új Tineidae faj Magyarországról – Two new Tineidae from Hungary (Lepidoptera: Tineidae) ......................................................... 9–12 Buschmann F.: Új adatok az Asalebria geminella (Eversmann, 1844) magyarországi előfordulásához – New data Asalebria geminella (Eversmann, 1844) the occurrence of Hungary (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) .................................................................................................. 13–18 Fazekas I.: Adatok Magyarország Pterophoridae faunájának ismeretéhez (12.) Capperia, Gillmeria és Stenoptila fajok új adatai – Data to knowledge of Hungary Pterophoridae Fauna, No. 12. New occurrence of Capperia, Gillmeria and Stenoptilia species (Lepidoptera: Pterophoridae) ………………………. -

Texto Completo (Pdf)
ISSN: 1989-6581 Revilla & Gastón (2019) www.aegaweb.com/arquivos_entomoloxicos ARQUIVOS ENTOMOLÓXICOS, 21: 107-114 ARTIGO / ARTÍCULO / ARTICLE Contribución al conocimiento de la fauna de Microlepidoptera de España, con nuevos registros y otras citas de interés (Insecta: Lepidoptera). 1, 3 2 Tx. Revilla & J. Gastón 1 c/ Simón Otxandategi, 122. E-48640 Berango (Vizcaya) (ESPAÑA / SPAIN). e-mail: [email protected] 2 c/ Amboto, 7-4ªDcha. E-48993 Getxo (Vizcaya) (ESPAÑA / SPAIN). e-mail: [email protected] 3 Autor para la correspondencia / Corresponding author Resumen: Se presentan nuevos registros para España de Tineidae Latreille, 1810, Praydidae Moriuti, 1977, Blastobasidae Meyrick, 1894, Elachistidae Bruand, [1850] 1847 y Gelechiidae Staiton, 1854. Eudarcia lobata (Petersen & Gaedike, 1979), Prays ruficeps Heinemann, 1854, Blastobasis glandulella (Riley, 1871), Elachista agelensis Traugott-Olsen, 1996, Aristotelia mirabilis (Christoph, 1888) y Gelechia nigra (Haworth, 1828) son nuevas para España. Se añaden nuevas citas provinciales de Myrmecozela lambessella Rebel, 1901 y Blastobasis maroccanella Hamsel, 1952. Palabras clave: Insecta, Lepidoptera, Tineidae, Praydidae, Blastobasidae, Elachistidae, Gelechiidae, nuevas citas, España. Abstract: Contribution to the knowledge of the Microlepidoptera fauna of Spain, with new or other interesting records (Insecta: Lepidoptera). New records of Tineidae Latreille, 1810, Praydidae Moriuti, 1977, Blastobasidae Meyrick, 1894, Elachistidae Bruand, [1850] 1847, and Gelechiidae Staiton, 1854 for Spain are presented. Eudarcia lobata (Petersen & Gaedike, 1979), Prays ruficeps Heinemann, 1854, Blastobasis glandulella (Riley, 1871), Elachista agelensis Traugott-Olsen, 1996, Aristotelia mirabilis (Christoph, 1888), and Gelechia nigra (Haworth, 1828) are new for Spain. New provincial records of Myrmecozela lambessella Rebel, 1901 and Blastobasis maroccanella Hamsel, 1952 are given. Key words: Insecta, Lepidoptera, Tineidae, Praydidae, Blastobasidae, Elachistidae, Gelechiidae, new records, Spain. -

Taxonomy of Microlepidoptera
KFRI Research Report No. 361 Taxonomy of Microlepidoptera George Mathew Kerala Forest Research Institute An Institution of Kerala State Council for Science, Technology and Environment (KSCSTE) Peechi – 680 653, Thrissur, Kerala, India March 2010 KFRI Research Report No. 361 Taxonomy of Microlepidoptera (Final Report of the Project KFRI/ 340/2001: All India Coordinated Project on the Taxonomy of Microlepidoptera, sponsored by the Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi) George Mathew Forest Health Division Kerala Forest Research Institute Peechi-680 653, Kerala, India March 2010 Abstract of Project Proposal Project No. KFRI/340/2001 1. Title of the project: Taxonomy of Microlepidoptera 2. Objectives: • Survey, collection, identification and preservation of Microlepidoptera • Maintenance of collections and data bank • Development of identification manuals • Training of college teachers, students and local communities in Para taxonomy. 3. Date of commencement: March 2001 4. Scheduled date of completion: June 2009 5. Project team: Principal Investigator (for Kerala part): Dr. George Mathew Research Fellow: Shri. R.S.M. Shamsudeen 6. Study area: Kerala 7. Duration of the study: 2001- 2010 8. Project budget: Rs. 2.4 lakhs/ year 9. Funding agency: Ministry of Environment and Forests, New Delhi CONTENTS Abstract 1. Introduction………………………………………………………………… 1 1.1. Classification of Microheterocera………………………………………… 1 1.2. Biology and Behavior…………………………………………………….. 19 1.3. Economic importance of Microheterocera……………………………….. 20 1.4. General External Morphology……………………………………………. 21 1.5. Taxonomic Key for Seggregating higher taxa……………………………. 26 1.6. Current status of taxonomy of the group………………………………….. 28 2. Review of Literature……………………………………………………….. 30 2.1. Contributors on Microheterocera………………………………………….. 30 2.2. Microheteocera fauna of the world………………………………………… 30 2.3. -

Entomologiske Meddelelser
Entomologiske Meddelelser BIND 60 KØBENHAVN 1992 Indhold - Contents Andersen, T., L. L. Jørgensen & J. Kjærandsen: Relative abundance and flight periods of some caddis flies (Trichoptera) from the Faroes .................... 117 Buhl, 0., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack: Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1990 (Lepidoptera) Records of Microlepidoptera from Denmark in 1990 . ............................ Buh!, 0., P. Falck, B.Jørgensen, O. Karshol t & K. Larsen: Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1991 (Lepidoptera) Records oj Microlepidopterafrom Denmark in 1991 .............................. 101 Fibiger, M.: Diarsia rubi (Vieweg, 1790) og D.florida (Schmidt, 1859), to selvstændige arter (Lepidoptera, N octuidae) Diarsia rubi (Vieweg, 1790) and D. florida (Schmidt, 1859), two dislinet species . 61 Godske, L.: Aphids in nests of Lasiusflavus F. in Denmark. II. Population dynamics (Aphidoidea, Anoeciidae & Pemphigidae; Hymenoptera, Formicidac) . 21 Gønget, H.: Om spidsmussnudebillerne Apion (Catapion) seniculus Kirby og A. (C.) meieri Desbrochers des Loges i Danmark (Coleoptera, Apionidae) On Apion (Catapion) seniculus Kirby and A. (C.) meieri Desbrochers des Loges in Denmark . 111 Hansen, M.: Vandkæren n Berosus spinosusa - to arter i Danmark (Coleoptera, H ydrophilidae) The water scavenger beetle » Berosus spinosus« two species in Denmark . 65 Hansen, M., S. Kristensen, V. Mahler &J. Pedersen: 11. tillæg til "fortegnelse over Danmarks biller« (Coleoptera) 11th supplement to the list of Danish Coleoptera . 69 Heda!, S. & S. C. Schmidt: Om forekomsten af porcelænsmøllet Acentria ephemerella (Den. & Schiff.) i nogle danske fjorde (Lepidoptera, Pyralidae) On the occurrence of Acentria ephemerella (Den. & Schiff) in same Danishjjords . 17 Jensen, A., V. Mahler & M. Hansen: To nye danske biller i en brændt mose i Sønder jylland (Coleoptera, Staphylinidae & Cryptophagidae) Two new Danish beetles in a burntfen in Southjutland.. -

Entomologiske Meddelelser
Entomologiske Meddelelser Indeks for Bind 1-67 (1887-1999) Entomologisk Forening København 2000 FORORD Tidsskriftet "Entomologiske Meddelelser" - Entomologisk Forenings medlemsblad - blev grundlagt i 1887, og er således det ældste danske entomologiske tidsskrift, som stadig udgives. Det har siden sin start haft til formål at udbrede kendskabet til entomologien i almindelighed og dansk entomologi i særdeleshed. De første 5 bind udkom i årene 1887-1896 og omhandlede primært artikler af særlig relevans for dansk entomologi. Herefter skiftede det format, såvel rent fysisk som (mere gradvis) indholdsmæssigt, og fik efterhånden et mere internationalt tilsnit med en vis andel af bl.a. tysk- og engelsksprogede artikler. I forbindelse med overgangen til det nye format, benævntes tidsskriftet nu som "Entomologiske Meddelelser, 2. Række" og nummereringen af de enkelte bind startede forfra. Efter at have praktiseret denne nummerering i nogle år, droppedes dog betegnelsen "2. Række", og man vendte tilbage til at nummerere bindene fortløbende fra det først udkomne bind. Efter at tidsskriftet op igennem 1900-tallet havde fået et stigende indhold af artikler med internationalt sigte, blev det fra bind 39 (1971) besluttet at koncentrere indholdet til primært dansksprogede artikler af særlig relevans for den danske fauna. Samtidig overgik de enkelte bind til at udgøre årgange i stedet for, som tidligere, at være flerårige. "Entomologiske Meddelelser" har siden sin start bragt hen mod 1600 originale, videnskabelige artikler eller mindre meddelelser, næsten 500 boganmeldelser, over 100 biografier eller nekrologer over primært danske entomologer, samt enkelte meddelelser af anden slags. For at lette overskueligheden over den meget betydelige mængde af information disse publikationer rummer, har Entomologisk Forenings bestyrelse fundet tiden moden til at sammenstille et indeks over indholdet af samtlige udkomne numre af "Entomologiske Meddelser" til og med bind 67 (årgang 1999). -

Akrotiri Peninsula Environmental Management Plan
AKROTIRI PENINSULA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN Version 2.0 17 September 2012 2 CONTENTS 1. Introduction 2. Legislation 2.1. SBAA Ordinances 2.2. Conventions 2.3. Pending legislation 3. Policy 4. Designations for nature conservation 4.1. Ramsar designation 4.2. IBA designation 4.3. SPA designation 4.4. Candidate SAC area 5. Land use zones 6. Description of Nature conservation interest 6.1. Overview 6.2. Habitats 6.3. Flora 6.4. Fauna 7. Important conservation features 7.1. Evaluation criteria for habitats 7.2. Evaluation criteria for species 7.3. Important habitats 7.4. Important flora 7.5. Important birds 7.6. Important reptiles 7.7. Important mammals 7.8. Important amphibians 7.9. Important invertebrates 7.10. Important fish 8. Sensitivity of the important conservation features 8.1. Habitats in general 8.2. Specific habitats 8.3. Flora 8.4. Birds 8.5. Reptiles 8.6. Mammals 8.7. Amphibians 8.8. Invertebrates 8.9. Fish 3 9. Hydro-geology 10. Historic Environment 11. Landscape 12. Land Ownership 13. Existing infrastructure 14. Impact of existing land uses and activities on important features and current management arrangements and controls 15. Objectives and actions 15.1. General objective 15.2. Proposed development prescription 15.3. Proposed actions 16. Monitoring, evaluation and reporting 17. References 18. Maps 19. Annexes Annex A: Administrative Secretary’s Policy Statement Annex B: Chart on the Appropriate Assessment process and definition of terms and concepts Annex C: Chart on the Environmental Impact Assessment evaluation process 4 1. Introduction The aim of the Management Plan will be to manage and protect the important environmental features of Akrotiri Peninsula included in the Ramsar and Special Protection Area designations for Akrotiri and the candidate Akrotiri Special Area of Conservation.