"Die Großen Trainer Haben Doch Alle Gesoffen" (PDF)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Malta Aachen · 13.5.2010
aktuell OFFIZIELLES PROGRAMM DES DEUTSCHEN FUSSBALL-BUNDES · 2/2010 · SCHUTZGEBÜHR 1,– ¤ Benefiz-Länderspiel Deutschland – Malta Aachen · 13.5.2010 Mit Super-Gewinnspiel und Riesen-Poster! www.dfb.de · team.dfb.de · www.fussball.de lufthansa.com Mitfi ebern Ein Produkt von Lufthansa. Buchen Sie Ihren Fanfl ug unter lufthansa.com/fanfl ug Lufthansa bringt Sie in jede Fankurve: Mit günstigen Flügen, eigenem Fanflugportal, persönlichen Fankalendern und News zu allen Sportevents, um überall live dabei zu sein. LH_DFB_Fan_210x297_DFB_Journal_IC2.indd 1 14.09.09 13:05 Liebe Freunde des Fußballs, zum heutigen Länderspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Malta zu Gunsten der DFB-Stiftung Egidius Braun und anderer deut- scher Fußball-Stiftungen am Aachener Tivoli sende ich allen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie den beiden Mannschaften meine herzlichen Grüße. Das Aufeinandertreffen ist eine von drei Vorbereitungs-Begegnungen für das deutsche Team auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Südafrika. Nicht nur der Bundestrainer, sondern auch die vielen Fußballfans im Stadion wie an den Bildschirmen sind gespannt, wie sich die Mannschaft hier und heute präsentiert. Das traditionelle Benefizspiel findet erstmals in Aachen statt – der Heimat von DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun. Der deutsche Fußball möchte sich damit bei ihm für sein vorbildliches soziales Engagement bedan- ken. „Fußball ist mehr als ein 1:0“ – mit diesem Leitsatz hat Egidius Braun den deutschen Fußball nachhaltig geprägt. Seit Jahren kümmert sich die DFB-Stiftung Egidius Braun um benach- teiligte Ju gendliche, Waisen- und Straßenkinder unter anderem in Osteuropa und Mexiko. In Deutschland betreut sie Nachwuchs-Elitesportler und hilft kleineren Vereinen bei verschiedenen Projekten. Das Engagement für die Menschen, die der Hilfe bedür fen, war und ist Egidius Braun eine Herzensangelegenheit. -

608 Seiten Einsatz Im Team Wird Zu Einer 430 Hoppers
4. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Stagnation und Resignation 4.2. Drei Vorarlberger Fußballspieler der Extraklasse Alle Auswahlspieler-Portraits von Kampfmannschaft Alle Vereine im Vorarlberger Fußballverband 100 Jahre AZahlen wie - DatenAberer - Fakten bis Z wie Zugliani von A wie Altach bis W wie Wolfurt VorarlbergerU16 B SC Rheindorf U16 A U18 Vorne v.l.: Tobias Wilfling, Julius Adrian Tölzer, Davud Ekici, Elias Altach Schmid, Elias Martin Rimmele, Raphael Guichern, Baran Bulanik, 69 Bruno Pezzey – UEFA-Cupsieger, 11 WM-Spiele, Stand von 0:0 einen Elfmeter. Max Fleisch, Marco Effinger, Dominik Prugg Mitte v.l.: Marco Vorne v.l.: Fabio Plesa, Nico Fritsche, David Tschaler, Matteo Gründung 1929 als Sektion im Müller, Kubilay Sen, Maximilian Thurnher, Mustafa Fadl, Kaan Wenn Kutzop trifft, ist Bremen Schöpf, Tobias Loacker, Elias Witzemann Mitte v.l.: Alexander Europa- und Weltauswahl, 84 Mal für Österreich Sönmez, Max Egle, Ekin Sarikaya, Christopher Novak,Fußballgeschichte Eren Turnerbund Altach Guem, Killian Bürger, Niklas Klohs, Luca Nizic, Julius Fischer, Janis Sentürk, Efe Nebat, Hinten v.l.: Ergün Karatay, Ahmet Karadurmus, Meister, doch der Ball geht an den Vorne v.l.: Julian Pointner, Resul Zumberi, Philipp Madlener, Nico Hug, Robert Nizic. Hinten v.l.: Damiano Baeli, Flamur Kicaj, Eren Beitritt zum VFV 1931 (bis 1937) Lukas Adlboller, Ceyhan Karadurmus Der 21. Mai 1980 geht in die Fuß- die Meisterschaft reicht es aber Nizic, David Hartmann, Merd Zorlu, Berkant Temizürek, Umut Azar, Nico Guem, Nils Thalmann, Saimen Velic Pfosten. Ilhan, Oliver Wohlgenannt Mitte v.l.: Nikola Vuckovic, Cem Köken, ballgeschichte ein. Am Abend nicht, nach fünf Jahren ist Schluss Vladan Stanojevic, Marin Milosevic, Luca Plesa, Niclas Bickel, Akif • 2 Mal Europa League-Qualifi kation Play- Yilmaz, Arber Ali, Ivan Kristo. -

Rapids Große Derbysieger
Jeden Dienstag neu | € 1,90 Nr. 16 | 17. April 2018 FOTOS: GEPA PICTURES 50 Wien ROSES NÄCHSTES ZIEL: FINALE! Das „Wunder von Salzburg“ 4 Seite SCHOBI & GOGO IM HOCH, AUSTRIA IN DER KRISE BAUMGARTNER IM INTERVIEW „Sind gefährlicher Cup-Underdog“ Seite 14 Rapids große TOTO RUNDE 16A 18-fach-Jackpot Derbysieger in der Torwette! Seite 6 Österreichische Post AG WZ 02Z030837 W – Sportzeitung Verlags-GmbH, Linke Wienzeile 40/2/22, 1060 Wien Retouren an PF 100, 13 Das Topspiel der Deutschen Bundesliga Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen Am Samstag ab 17.30 Uhr exklusiv auf Sky PR_AZ_Coverbalken_Sportzeitung_169x31_2018_V01.indd 1 12.04.18 09:29 Sportzeitung 02 16/2018 Anstoß Horst Hot & Not wunder gibt es immer wieder FUSSBALL Barometer EDITORIAL von Gerhard Weber Pedro Martins: Der Portugiese, Die Salzburger Bullen haben ihn also wirklich Doch die gehört jetzt Salzburg! Niemand redet zuletzt Guimarães, ist Nachfol- geschafft, den Sprung ins Europa League- momentan von Leipzig. Und das hat man ger von Oscar Garcia als Olym- Semifinale. Die großen Brüder aus Leipzig sich redlich verdient. Unglaublich, was piakos-Trainer nicht … Marco Rose und seine Schützlinge in den Ich gebe es zu – da kommt schon ein biss- letzten Wochen und Monaten geleistet ha- Akira Nishino: Zwei Monate vor chen Schadenfreude auf. Und das nicht nur, ben. Unglaublich, wie konsequent man in der WM löste Japans bisheriger weil es immer Spaß macht, wenn wir gegen- der Mozartstadt den Weg verfolgt hat Sportdirektor Vahid Halilhodzic über den Deutschen endlich wieder einmal Da gab‘s kein Jammern, da gab‘s Wehkla- als Teamchef ab die Nase vorne haben. -
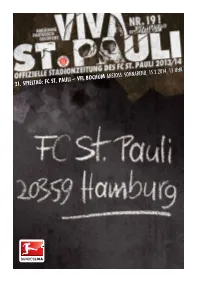
21. Spieltag: FC St. Pauli – Vfl Bochum Anstoss: Sonnabend, 15.2
21. SPIELTAG: FC ST. PAULI – VfL BOCHUM ANSTOSS: SONNABEND, 15.2.2014, 13 UHR Titelstory Sonnabend, 15.2.2014: VFL BOCHUM Vier Jahre vor dem 78 Wochen später war das Album Im Web machte ein Youtube-Video immer noch in den deutschen Charts. über den praktischen „Peter Neuru- zweiten Aufstieg des Ein bis dahin nicht allzu bekannter rer-Altar im Koffer“ die Runde, und FC St. Pauli in die Schauspieler und Liedermacher aus am Ende der Saison färbte Neururer 1. Bundesliga geschah einer grauen Industriestadt tief im sich die Haare blau – Einlösung einer Westen hatte Michael Jacksons „Thril- Wettschuld bei Klassenerhalt. Den eines der „50 Ereignis- ler“ im Rennen um das erfolgreichste „Sport Bild-Award“ für das „Come- se, die den Rock’n’Roll Album des Jahres geschlagen. Mit back des Jahres“ gab es draufzu. Für Texten über Geschlechterstereotypen, einen Moment schien die verstaubte veränderten“. Findet Alkohol, Politik – und eben: Sonne, die Grönemeyer besingt, jedenfalls die deutsche „Bochum“. ziemlich blankgeputzt und die „ehrli- Ausgabe des „Rolling Das kann man fast ebenso erstaunlich che Haut“ der erklärten Nicht-Welt- finden wie den 1988er-Aufstieg samt stadt fast faltenfrei. Stone Magazine“. Das anschließender „Mythoswerdung“ Doch leider: „Von Pulsschlag aus Stahl Ereignis kam ganz eines bis dahin unscheinbaren Stadt- bis Beine aus Blei ist es nicht weit.“ So teilclubs aus Hamburg. Was nicht die hatte VIVA ST. PAULI-Kolumnist unscheinbar daher, einzige Parallele ist. Denn der Geist, Gegengeraden-Gerd vor Jahren ein- damals, im August 84: den Grönemeyer im Titelstück seines mal geunkt, und wer den aktuellen in einer schlichten Hülle, Albums besingt – dieser Geist prägt Tabellenplatz des VfL betrachtet, auch die Sehnsüchte und Träume vie- könnte meinen, er habe es erst ges- beschriftet in weißer ler, die 20359 Hamburg und seinen tern gesagt: Drei Spieltage lang Rele- Kreide auf schwarzem Magischen FC lieben. -

Unter Die Haut • 1
DAS INFOZINE DER AUFSTREBENDEN JUGEND UNTER DIE HAUT • 1. FC KAISERSLAUTERN - BORUSSIA MOENCHENGLADBACH SAISON 2010-2011 - AUSGABE 39 - SA, 30.10.2010 HIER UND JETZT Schönen guten Tag, liebe Leser! Anlässlich des 90. Geburtstages von Fritz Walter würdigen wir das Idol des FCK mit einem Portrait. 5 Spiele, 0 Punkte – so lautet die ernüchternde Gleichzeitig feiert unser Stadion sozusagen Bilanz der letzten Partien des FCK in der Bundesliga. 25. Jubiläum, weswegen wir nochmals auf die Somit sind wir nach nunmehr 9 absolvierten ereignisreiche Geschichte des Stadions auf dem Spieltagen dort angekommen, wo die meisten Betzenberg zurück blicken möchten. Fußballsachverständigen und Hobbyexperten uns vor Weiterhin erwarten euch interessante Texte zu Beginn der Saison erwartet haben: nämlich mitten im verschiedenen Themen wie z.B. Vereins- und Abstiegskampf. Klingt unsympathisch und irgendwie Fanpolitik, Gedanken zu verschiedenen Ereignissen gar nicht so sehr attraktiv, die Tatsache an sich kann der letzten Wochen, Graffiti und Streetart sowie allerdings mittlerweile von keinem noch so großen eine weitere Portraitierung einer verdienten Optimisten mehr geleugnet werden. Persönlichkeit des 1.FC Kaiserslautern, nämlich Die Zielvorgabe für das heutige Duell gegen die unseres Meistertrainers von 1998, „König“ Otto traditionsreiche Borussia aus Mönchengladbach ist Rehhagel. daher klar: endlich wieder einen verdammten Dreier Darüber hinaus gibt es Neuigkeiten aus einfahren! Die Glanzzeiten, in denen Gladbach mit verschiedenen deutschen Städten und dem Ausland, schillernden Figuren wie Günter Netzer und Jupp was selbstverständlich nicht unerwähnt bleiben soll. Heynckes von Erfolg zu Erfolg marschierte, sind In der Kategorie „Ein Blick auf“ warten somit erneut längst vorbei. Vielmehr ist die Borussia, gemessen an lesenswerte Zeilen auf euch! den Leistungen in der aktuellen Saison, einer unserer ärgsten Konkurrenten um die Nichtabstiegsplätze. -

Bachelorarbeit
BACHELORARBEIT Herr Nino Duit Die Rolle des Fußballtrainers und seine Aufgabenbereiche im Wandel der Zeit 2016 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT Die Rolle des Fußballtrainers und seine Aufgabenbereiche im Wandel der Zeit Autor: Herr Nino Duit Studiengang: Angewandte Medien (DHS) Seminargruppe: AA13wJ-MEM Erstprüfer: Prof. Dr. Detlef Gwosc Zweitprüfer: Mag. Jakob Rosenberg Einreichung: München, 7.3.2016 Faculty of Media BACHELOR THESIS The Role of a Footballmanager and his Fields of Duty in Changing Times author: Mr. Nino Duit course of studies: Applied Media (DHS) seminar group: AA13wJ-MEM first examiner: Prof. Dr. Detlef Gwosc second examiner: Mag. Jakob Rosenberg submission: Munich, 7.3.2016 Bibliografische Angaben Duit, Nino: Die Rolle des Fußballtrainers und seine Aufgabenbereiche im Wandel der Zeit The Role of a Footballmanager and his Fields of Duty in Changing Times 62 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2016 Abstract In der vorliegenden Arbeit wird nachgezeichnet, welche Rolle der Fußballtrainer seit der Regelvereinheitlichung 1863 spielt und wie sich diese mit der zunehmenden Pro- fessionalisierung des Sports geändert hat. Dabei wird auf die Entwicklungen in Eng- land und Deutschland eingegangen und verdeutlicht, wie sich die verschiedenen Herangehensweisen in diesen beiden Ländern entwickelt haben. Während der „Trai- ner“ in Deutschland hauptsächlich für die sportbezogene Arbeit im Verein verantwort- lich ist, hat der „Manager“ in England auch administrative und wirtschaftliche Aufgaben zu bewältigen. Es wird analysiert, wie sich die Aufgabenfelder und Verantwortungsbe- reiche in diesen beiden Ländern im Laufe der Zeit verschoben haben und über welche Fähigkeiten ein erfolgreicher und angesehener Fußballtrainer heute verfügen muss. Inhaltsverzeichnis V Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................... -

Uefa Champions League
UEFA CHAMPIONS LEAGUE - 2020/21 SEASON MATCH PRESS KITS (First leg: 4-1) Fussball Arena München - Munich Wednesday 17 March 2021 FC Bayern München 21.00CET (21.00 local time) SS Lazio Round of 16, Second leg Last updated 14/05/2021 21:35CET UEFA CHAMPIONS LEAGUE OFFICIAL SPONSORS Previous meetings 2 Match background 7 Squad list 11 Match officials 13 Fixtures and results 14 Match-by-match lineups 18 Competition facts 21 Team facts 23 Legend 25 1 FC Bayern München - SS Lazio Wednesday 17 March 2021 - 21.00CET (21.00 local time) Match press kit Fussball Arena München, Munich Previous meetings Head to Head UEFA Champions League Date Stage Match Result Venue Goalscorers Correa 49; Lewandowski 9, 23/02/2021 R16 SS Lazio - FC Bayern München 1-4 Rome Musiala 24, Sané 42, Acerbi 47 (og) Home Away Final Total Pld W D L Pld W D L Pld W D L Pld W D L GF GA FC Bayern München 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 SS Lazio 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 FC Bayern München - Record versus clubs from opponents' country UEFA Champions League Date Stage Match Result Venue Goalscorers Lewandowski 73, Müller 90+1, Thiago 4-2 Alcántara 108 ET, 16/03/2016 R16 FC Bayern München - Juventus Munich agg 6-4 (aet) Coman 110 ET; Pogba 5, Cuadrado 28 Dybala 63, Sturaro 23/02/2016 R16 Juventus - FC Bayern München 2-2 Turin 76; Müller 43, Robben 55 UEFA Champions League Date Stage Match Result Venue Goalscorers 05/11/2014 GS FC Bayern München - AS Roma 2-0 Munich Ribéry 38, Götze 64 Gervinho 66; Robben 9, 30, Götze 23, 21/10/2014 GS AS Roma - FC Bayern München 1-7 -

P20 Layout 1
Leicester draws Larsson salvages 2-2 with Everton draw for on EPL return Sunderland SUNDAY, AUGUST 17, 201419 19 Juventus thrash Singapore 5-0 Page 18 MANCHESTER: Swansea City’s Gylvi Sigurdsson (centre left) scores against Manchester United during their English Premier League soccer match at Old Trafford Stadium yesterday. (Inset) Manchester United’s manager Louis van Gaal walks from the pitch after his team’s 2-1 loss to Swansea City. — AP Sigurdsson brings Van Gaal down to earth Swansea’s Ki scores first goal of new season first opening-day home defeat since 1972. After an underwhelming first half, in which lyóand perhaps illegallyóblocking Jonesís although Swanseaís debutant goalkeeper Lukasz Wilfried Bonyís quick free-kick enabled Jefferson they trailed to Kiís first goal for the Welsh club, attempt to close down Ki, the South Korean mid- Fabianski tipped it over his crossbar easily Montero to cross from the left and although Van Gaal brought on Nani to replace the ineffec- fielder had time and space to plant a left-foot enough. Man United 1 Wayne Routledge miscued his volley, the tive Javier Hernandez. Rooney operated as the shot into the bottom-right corner. At that point, it The second half, and the equalizer, brought unmarked Sigurdsson was able to finish from spearhead of the attack, slightly ahead of Juan was hard to envisage how United would find a about an improvement from the home side, with eight yards. Mata, and it took the England forward just seven route back into the game, so inept had they been Williams forced to make an excellent tackle fol- It was a goal that highlighted Unitedís defen- minutes of the second half to claim an equaliser, at turning possession into cutting-edge chances. -

Evidence from German Soccer
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Hentschel, Sandra; Muehlheusser, Gerd; Sliwka, Dirk Working Paper The Contribution of Managers to Organizational Success: Evidence from German Soccer IZA Discussion Papers, No. 8560 Provided in Cooperation with: IZA – Institute of Labor Economics Suggested Citation: Hentschel, Sandra; Muehlheusser, Gerd; Sliwka, Dirk (2014) : The Contribution of Managers to Organizational Success: Evidence from German Soccer, IZA Discussion Papers, No. 8560, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/104656 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen -

Arnd Zeigler Taktik Ist Keine Pfefferminzsorte! Bella Arnd Zeigler
Arnd Zeigler Taktik ist keine Pfefferminzsorte! Bella Arnd Zeigler Taktik ist keine Pfefferminzsorte! Neueste Sprüche und Weisheiten der Fußballstars Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. ISBN 978-3-86910-188-0 (Print) ISBN 978-3-86910-289-4 (PDF) Der Autor: Arnd Zeigler ist TV-Moderator mit eigener Sendung im WDR-Fernsehen: „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ läuft seit 2007 immer sonntags um 23.45 Uhr und wird live aus Zeiglers Bremer Wohnung übertragen. Die gleichnamige Radio comedy ist seit über einem Jahrzehnt in den Programmen von Radio Bremen, WDR Eins Live, HR 3, SWR 1, Bayern 3, SR 1 und MDR Sputnik. Ein Blog nannte ihn „the thinking man’s Gerhard Delling“. Zeigler gibt Fußball-CDs heraus, schreibt Kolumnen, ist Stadionsprecher bei Werder Bremen und Texter und Interpret der Werder-Stadionhymnen „Das W auf dem Trikot“ und „Lebens- lang grün-weiß“. Mit letztgenanntem Song schaffte er es im Sommer 2004 für neun Wochen in die deutschen Single-Charts (Beste Platzierung: 44). Deutlich bessere Musik legt er selbst wöchentlich in seiner von der Kritik hochgelobten Kult-Radioshow „Zeiglers wunderbare Welt des Pop“ (immer dienstags, 20 Uhr, Bremen Vier) auf. Bei humboldt sind 4 weitere Bücher der Reiher „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ von Arnd Zeigler erschienen: 1111 Kicker-Weisheiten (ISBN 978-3-86910-157-6) 1000 ganz legale Fußballtricks (ISBN 978-3-89994-077-0) Gewinnen ist nicht wichtig, solange man gewinnt (ISBN 978-3-89994-099-2) Keiner verliert ungern – Neue Sprüche und Zitate der Fußballstars (ISBN 978-3-86910-160-6) Originalausgabe © 2011 humboldt Eine Marke der Schlüterschen Verlagsgesellschaft mbH & Co. -

Preparing for EURO 2004 How the Qualifiers Shaped up Germany Win
.03 11 Preparing for EURO 2004 03 How the qualifiers shaped up 06 Germany win the Women’s World Cup 09 Professional leagues 1010 no 19 – november 2003 – november no 19 COVER IN THIS ISSUE Professional leagues 10 Greece (Angelos Charisteas, in blue) Coach education directors will be taking part in their first EURO 2004 preparations in full swing 03 in Brussels 12 European Championship final round UEFA prepares for its jubilee 14 since 1980 and only their second ever. Review of the EURO 2004 qualifiers 06 News from member PHOTO: FLASH PRESS Germany win the Women’s World Cup 09 associations 17 AchievingEditorial the right balance The final tournament of the European Championship really started to take definite shape on 11 October, when Portugal found out the names of ten of their potential opponents and football fans were presented with the outline of what already shows all the signs of being a particularly mouth-watering line-up. Interest in the competition will be maintained in November with the play-offs, which promise to be exciting and open, and could give the final field of participants a very interesting look indeed. After these deciders, the draw for the final round will well and truly put us on tenterhooks in anticipation of the tournament itself and the fever will continue to mount until the opening match kicks off on 12 June 2004. For the supporters of the national teams which have not managed to qualify for next year’s European Championship final round, the draw for the 2006 World Cup qualifying competition at the beginning of December will give them renewed reason to hope and dream. -

ASC AKTUELL Das Magazin Des Arminia Supporters Club
Februar 2007 | Ausgabe 8 | 1,00 Euro | www.asc-aktuell.de ASC AKTUELL Das Magazin des Arminia Supporters Club Baut für Blau Frank Stopfel – Architekt der neuen Haupttribüne – gibt Antworten auf unsere Fragen. Das ASC-Bilderbuch Viele Fotos von der Weihnachts- feier und dem HSV-Fanfest Stopper Schulz Ein Fanclub stellt sich vor. ������������������������������ www.arminia-supporters.de �������������� Liebe Supporter, „Ich beginne mit ein paar mal „endlich“: die Rückrunde hat endlich wieder begon- nen, Vata und Ahanfouf sind endlich wieder dabei, TvH hat endlich zugegeben, dass er geht – und wann endlich die alte Osttribüne ersetzt wird, scheint auch nur Mit Farbe und Papier noch eine Frage der Zeit zu sein! Viel Bewegung also Stückchen auch „mein Baby“. Ich erinnere beim DSC Arminia – mich nur zu gut daran, wie wir selbst ganz erfüllen wir Ihnen fast und hoffentlich eine am Anfang so vieles für Spinnerei und Vision positive, im Inneren gehalten haben, was heute schon tatsäch- jeden Wunsch! und auch bezüglich lich erreicht ist. Vielen Dank an alle, die sich der Außenwahrneh- bis heute dabei nicht haben entmutigen las- mung. sen und engagiert für ihren ASC stehen! Das nächste Supporters-Projekt soll sich Und was bewegt mit der Zielgruppe der über-14-Jährigen Topqualität zu sich beim Sup- beschäftigen, also denen, die aus den porters Club? Die Arminis rauswachsen. Man darf gespannt Weihnachtsfeier ist sein, was sich dort entwickelt. marktgerechten Preisen. längst Vergangen- heit – schön, dass es Auch die neue Website ist endlich fertig. Ich wieder so viele posi- hoffe, sie kommt gut an und wird ein noch tive Rückmeldungen aktuelleres und lebendigeres Medium für gab.