Das Flugboot Dornier „Wal“ (Do J) Von Günter Frost (ADL)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Catalogue of Place Names in Northern East Greenland
Catalogue of place names in northern East Greenland In this section all officially approved, and many Greenlandic names are spelt according to the unapproved, names are listed, together with explana- modern Greenland orthography (spelling reform tions where known. Approved names are listed in 1973), with cross-references from the old-style normal type or bold type, whereas unapproved spelling still to be found on many published maps. names are always given in italics. Names of ships are Prospectors place names used only in confidential given in small CAPITALS. Individual name entries are company reports are not found in this volume. In listed in Danish alphabetical order, such that names general, only selected unapproved names introduced beginning with the Danish letters Æ, Ø and Å come by scientific or climbing expeditions are included. after Z. This means that Danish names beginning Incomplete documentation of climbing activities with Å or Aa (e.g. Aage Bertelsen Gletscher, Aage de by expeditions claiming ‘first ascents’ on Milne Land Lemos Dal, Åkerblom Ø, Ålborg Fjord etc) are found and in nunatak regions such as Dronning Louise towards the end of this catalogue. Å replaced aa in Land, has led to a decision to exclude them. Many Danish spelling for most purposes in 1948, but aa is recent expeditions to Dronning Louise Land, and commonly retained in personal names, and is option- other nunatak areas, have gained access to their al in some Danish town names (e.g. Ålborg or Aalborg region of interest using Twin Otter aircraft, such that are both correct). However, Greenlandic names be - the remaining ‘climb’ to the summits of some peaks ginning with aa following the spelling reform dating may be as little as a few hundred metres; this raises from 1973 (a long vowel sound rather than short) are the question of what constitutes an ‘ascent’? treated as two consecutive ‘a’s. -

Autumn 07 Cover
SALE 5901 STANLEY GIBBONS LONDON 1856 | THURSDAY 4TH OCTOBER 2018 4TH OCTOBER THURSDAY COLLECTIONS & RANGES 4TH OCTOBER 2018 399 Strand, WC2R 0LX, London Please contact us on 020 7836 8444 | Email: [email protected] www.stanleygibbons.com/auctions Stanley Gibbons Collections and Ranges pages.qxp_Layout 1 22/08/2018 09:10 Page 1 COLLECTIONS & RANGES SALE 5901 THURSDAY 4TH OCTOBER 2018 To be held at: Stanley Gibbons 399 Strand London WC2R 0LX PUBLIC VIEWING AT 399 STRAND Monday 24th September 09:30 – 16:30 Tuesday 25th September 09:30 – 16:30 Wednesday 26th September 09:30 – 16:30 Thursday 27th September 09:30 – 16:30 Friday 28th September 09:30 – 16:30 Private viewing beforehand may be available at 399 Strand by appointment only. For an appointment to view please telephone 0207 557 4458 or email [email protected] ORDER OF SALE Afternoon Session not starting before 2.00pm Lots 2500 -3134 INDEPENDENT AUCTION AGENTS The below agents attend each of our auctions. These details are provided without recommendation or guarantee. Trevor Chinery BA. PTS: Tel: +44 (0)1205 330026 / Fax: +44 (0)1933 622808 / Mobile: (0)7527 444825 Email: [email protected] Nick Martin (Love Auctions): Tel: +44 (0)1205 460968 / Mobile: +44(0)7703 766477 Email: [email protected] STANLEY GIBBONS LONDON 1856 399 Strand, WC2R 0LX, London Please contact us on 020 7836 8444 | Email: [email protected] www.stanleygibbons.com/auctions Stanley Gibbons Collections and Ranges pages.qxp_Layout 1 22/08/2018 09:10 Page 2 MEET THE AUCTION TEAM -
![Evening Star. (Washington, D.C.). 1932-07-25 [P ]](https://docslib.b-cdn.net/cover/9054/evening-star-washington-d-c-1932-07-25-p-2729054.webp)
Evening Star. (Washington, D.C.). 1932-07-25 [P ]
i _._ _ WEATHER. “From Press to Home 1 <U. 8. Weather Bureau Forecast.) •»-. »• T* „ * n an OUr Fair and warmer tonight and tomor- row; gentle winds, mostly south and The Star’s Carrier system covers every southwest city block and the regular edition is Temperatures—Highest. 80, at noon delivered to city and suburban homes today; lowest, 61. at 5:30 a m. today. as fast as the papers are printed. on 9. Full report page _ ___ 7~ .. M Saturdays Circulation, 11844* Closing N. Y. Markets, Pages 10 and 11 circulation. ____ _Sundays m,567_ No. 32,227. Z'THru' "w^hingto” TT WASHINGTON, D. CM MONDAY, JULY 25, 1932-TWENTY-SIX PAGES. **** <*> M..n. Associated Pr**.. TWO CENTS. ^BOYS.IMAY'n RADICAL VETERANS E IN MINORITY have been \ IT” OPENS FIGHT BORAH BCHINDINTHAT \ CHICAGO UNt^JP CLUBBED BY k \ POLICE; LINKED 10 SILVER ON WAR DEBT PLAN. l BUT iWGlFFY* i AGAINST CLOSURE NINE ARE ARRESTED A ON THE S?OT MONEY AT OTTAWA LEADERS HERE SAY p wm.i'y ORDERED BY U. S. Street Fights Mark Advocates of Bimetalism Congress Believed Against Chicago Board of Trade Pre- Attempt to Picket Urging Scheme—Both His Revision Ideas—Hoo- pared to File Briefs Re- White House. in Tentative State. ver Silent on Proposal. sisting Order. DETECTIVE CLIMBS MEAT SALES NOW HOLD FOREIGN VIEWS, EXCEPT “HOOVER’S JOBHOLDERS” TREE AFTER LEADER DELEGATES’ ATTENTION PARIS, FAVOR PARLEY ARE ACCUSED BY CAREY Pace, Chief of “Red” Want to U. Tariff Cut More “President’s Pet Farm Forces, Held on Charges Trade Now Given S. -
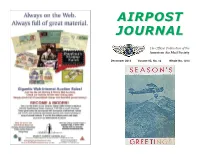
48 Page GPS Template
AAIIRRPPOOSSTT JJOOUURRNNAALL The Official Publication of the American Air Mail Society December 2014 Volume 85, No. 12 Whole No. 1014 Zeppelins & Aerophilately Ask for our Free Price List of Worldwide Flight covers and stamps. The following is a small sampling – full list on Website! United States 1930 US C13 - C15 set of card and 2 covers w/matched wide bottom plate numbers. VF condition . $1,350.00 1938 (July 10) Howard Hughes’ Round-the-World Flight cover. This record-breaking flight started at Floyd Bennett Field, Long Island, New York, then landed in France where additional postage was added and postmarked July 11.. $1,250.00 Kenya / Germany 1934 South America catapult. Tape stains on back . $750.00 Latvia / Germany / Guatemala 1934 catapult . Europa $2,000.00 Liechtenstein 1932 catapult to Bahamas, (K131 LN) . Europa $900.00 Malta 1933 Chicago flight to U.S. $750.00 Hungary Chicago Flight sent to Brazil S.238Aa . $1,250.00 Mauritania 1934 3rd South America Flight sent to Argentina S.254Ba . $1,850 Monaco Chicago Flight sent to Brazil S.238Aa . $4,250.00 Nicaragua US 1933 Chicago Flight with dual franking. Scott C18 S.245B . $1,200.00 Poland 1932 8th South America Flight sent to Brazil S.189B . $650.00 Henry Gitner Philatelists, Inc. PO Box 3077T, Middletown NY 10940 Email: [email protected] — http://www.hgitner.com DECEMBER 2014 PAGE 485 In This Issue of the Airpost Journal — ARTICLES — First Flight Around the World in a Flying Boat ............................................ 495 Bob Dille May 15, 1918 William T. Robey Cover: A Reunion .................................... -
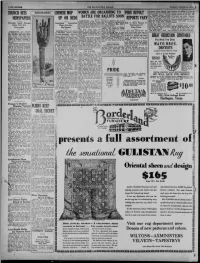
I /Jie Semational GUMSXAM Hug 3
Lieutenant Colonel Sanche* Cerro. Involved the sending ?! a fleet U> Federico Fern- ENDURANCE! His troops arrested Mollendo. a port near Arequlpa. and WOMEN ARE ORGANIZING TO andinl, prefect of the department, HITS CHINESE MOP PERU REVOLT moving aircraft on the city. The CHURCH and Brigadier General Leopoldc BATTLE FOR BALLOTS SOON Arias. chief of the Arequipa milit- government also closed Mollendo. ary division, but there was no blood- which is the terminus of a railroad NEWSPAPERS DP ON REDS REPORTS VARY shed. A government communique running through Arequlpa, to both Issued here said the movement was 23- (JPh- i Franklin D. Roosevelt, wife of the national and commercial WASHINGTON, Aug. based on a ordinance foreign York forged army Women, students of how women New governor; representative *■ aircraft. Methodist Board ! Said to Have To saying the wcmment had decided Charges Communuts Committing vote and why are mustering ranks Mary T. Norton of New Jersey, Spread to discharge some officers and for a real before the Nov- and Mrs. Genevieve Clark Thom- Dailes With Wet battle, j Departments Of soldiers and to cut the salarier An interesting exhibit of the Many Atrocities, ember for the ballots of son of New Orleans. election, j of others. It added that necessary German hygiene museum in Dres- several million voters of their Headquarters here is in commu* Propaganda Say Reports the Puno, Cuzco steps had been taken to restcre den is a huge wax model of the sex. nication with leaders in states j order In the human ear. It show? ever}' ——■.■■■ « province. org* Mrs. -

LON CHANEY DEAD; Trails-Atlantic Plane Is V Eter^ of Arctic END UNEXPECTED
tji '’'d'i’i - m S T P R E SS BUN STERAGE DAU<P OIROULATION for Itie Montb of Julft 1980 5.416 HembenTst tke AnOlt Bar««u of OlTcalMJoa'o p b Ic e t b e ^ e t w e l v e p a g e s SOUTH MANGH£^Sit» CONN*, TUESDAY, AUGUST 2^ 1930. VOL. XLrST., NO. 279. (COaaiifled Adverttoiiig on Page 10) z LON CHANEY DEAD; Trails-Atlantic Plane Is V eter^ of Arctic END UNEXPECTED i Famous Character Actor Had Head of l ^ r y Been Reported as Improv Yields to Popidar ing When Sudden Hemor TELLSSTAND and Recalls Former ( ^ ; rhage Terminates Career. ON W LAW Wardiip Ordered to Rf* Wasiflngton, Aug. 28.__(AP)—i^Ministers was DelegateD at a meet FerDinanD L. Mayer, American ing of the D lp lo ^ tlc Corps tp- call torn So TImf Leguia Lo.s Angeles, Aug. 26.—CAP)— ; charge D’affaires at Lima, aDviseD upon the conunalitee in power anD Lon Chaney, whose gfrotesque screen j ‘ the State Department toDay he had- request assurances, of - protection Supports Enforcement But both for foreign nationals, businesa characterizations won him the so- , granteD asylum to: two Daughters of Face Trial-4l!airtial Lalfr PresiDent Legula and their chilDren interests .and. Diplomatic missions. briquet of “The Man of a ThousanD i A mpift protecrion was -assureD the Believes Change Should in his house. Faces,’’ DieD here early toDay after j AlfreDo Larrinaj^,i son-in-law <w Diplomats by General Ponce, who Pre?ails iuCapRai and R Wolfgang von saiD he haD DeclateD martial law to a valiant battle against anaernia Be Made— Mrs. -

In Separate Catalogue
Commencing on Monday, June 27, at 9:30 am with the People’s Republic of China and Liberated Areas (lots 1001 – 1812) in separate catalogue. The General Session (lots 1813 – 2234) will take place immediately following. Postage Dues 1814 1904 “Postage Due” overprints on ½c. pane of twenty mint, 1912 “Republic of China” overprint ½c. blue double panes of fifty (2, mint and used) with selvedge on two sides showing imprint or requisition numbers, and 1c. brown similar double pane used (light creasing), and 1913 First London printing ½c. double pane of fifty unused with much original gum, fine to very fine. Chan D1, D23, D24, D41. From the Beckeman Collection. HK$ 1,500 - 2,000 1815 1904 “Postage Due” overprints on 1c. and 2c. in top marginal interpanneau blocks of twenty-four mint or unused (the latter with backing paper affixed) and 1915 Peking printing 1c. part sheet of fifty with imprints and plate number cancelled by “Harbin” c.d.s., also 1912 “Republic of China” overprint ½c. double pane of forty mint, a few small faults, overall fine. HK$ 3,000 - 4,000 1813 1816 1813 1904(c.) Composite lithographed essay for Postage Due 1c., 1816 2c., 4c., 6c., 8c., 10c., 20c. and 30c. in deep salmon, perf. 1904 Waterlow imperforate proof of Postage Due 5c. lake on 12, in sheetlet form on ungummed foreign paper, some thick wove paper, overprinted “Waterlow & Sons Ltd./ Specimen”, very fine. creasing in selvedge. Designed by H.B. Morse (1855-1934), HK$ 5,000 - 6,000 an American employee of the Chinese Customs. -

Dornier Do-J „Wal“ (Whale)
MooseAir #5: Dornier Do-J „Wal“ (Whale) 23. April 2008 MOOSEAIR #5 Version 1.0.0 DORNIER DO-J „WAL“ (WHALE) The „Whale“ was one of the most successful flying boats in German aircraft history. After its maiden flight on 6 November 1922 more than 250 Whales were produced and flown all around the world. Most famous was probably the „Amundsen-Whale“ used by the Norwegian explorer to fly to the North Pole, but also other re- cord flights were undertaken in the 20s and 30s of the last century. The Dornier „Wal“ (Whale) was one of the best-known and most successful flying boats ever developed. The aircraft was gigantic against other aircraft of its day. It completed its maiden flight on No- vember 6, 1922 and its total production ran to more than 200 exam- ples. To avoid violating the terms of the Treaty of Versailles, from July 1922 production of the flying boat was carried out at Pisa in Italy on the premises of Costruzioni Meccaniche Aeronautiche S.A. (CMASA), a company that had been founded especially for the purpose. In do- Type Civil Flying Boat Manufacturer Dornier a.o. ing this, Dornier wished not only to progress from the already existing Maiden Flight: 6 November 1922 drafts for a high-wing flying boat equipped with two engines in tan- Number built: 283 dem arrangement but also to continue work on the already tried and proven Dornier stub-wing stabilizers. Even before a single Dornier Wal had been constructed, six had been ordered by the Spanish Air Force, who had seen no more than the blueprints. -

BORDMAGAZIN 2015 03 116 Bordmagazin 2015 V26 AMK.Qxp Sylt Air Bordmagazin 2015 04.05.15 18:53 Seite 4
116_Bordmagazin_2015_v26_AMK.qxp_Sylt_Air_Bordmagazin_2015 04.05.15 18:52 Seite 1 SAISON 2015/2016 / FREIEXEMPLAR DIE FLUGLINIE DES NORDENS BORDMAGAZIN SSYYLLTT AAIIRR GGMMBBHH •• FFLLUUGGHHAAFFEENN // TTEERRMMIINNAALL 22 •• 2255998800 SSYYLLTT//TTIINNNNUUMM TTEELL:: 0044665511-- 7788 7777 •• FFAAXX:: 0044665511-- 9922 9977 0077 •• EE--MMAAIILL:: SSEERRVVIICCEE@@SSYYLLTTAAIIRR..DDEE •• WWWWWW..SSYYLLTTAAIIRR..DDE E 116_Bordmagazin_2015_v26_AMK.qxp_Sylt_Air_Bordmagazin_2015 04.05.15 18:52 Seite 2 VORWORT Liebe Fluggäste, ganz besonders auf Sylt hatten wir 2014 viele Sonnentage mit warmen Temperaturen; das bleibt in Erinnerung und gibt uns Anlass zu großer Vorfreude auf die diesjährige Saison! Zahlreiche Urlauber haben während dieser schönen Zeit unser Angebot als Linien-, Charter- oder Rundfluggast in Anspruch genommen. Dabei unterstützen Sie als Fluggast unsere Aktion „Flugticket mit Küstenschutz“ (Anteil 1 € pro Ticket). Auch in diesem Jahr wird wieder die Spende des Ticketanteils an die Stiftung erfolgen. Seit mehr als 18 Jahren bin ich Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma Sylt Air GmbH. Im Juni dieses Jahres werde ich 60 Jahre jung und habe beschlossen die Führung der Firma an einen engagierten Nachfol- ger abzugeben, um mich etwas in den Hintergrund zu begeben und meinen neuen Lebensabschnitt zu genie - ßen. Ab dem 1. Mai 2015 wird die Geschäftsführung von Herrn Stephan Stritter übernommen. Er ist seit 2009 Pilot bei uns. Darüber hinaus hat er mich in den letzten Jahren bereits massiv bei der Organisation der Firma unterstützt. Ich werde allerdings als Technischer Leiter weiterhin der Firma treu bleiben und man wird mich auch in Zukunft immer mal wieder in den Räumlichkeiten der Sylt Air antreffen können. Herzlichst Ihr FLIEGEN IST UNSERE LEIDENSCHAFT Peter Siemi Sehr geehrte Fluggäste, mein Name ist Stephan Stritter und ich habe die Ehre die Nachfolge von Peter Siemi antreten zu dürfen. -

W$T Waurkm% Jdewwrat OVER 50,000 PEOPLE DAILY
Classified Ads } IN THE DEMOCRAT REACH PAGES 11 TO 20 W$t WaUrkm% jDewwrat OVER 50,000 PEOPLE DAILY WATERBURY EVENING DEMOCRAT. FRIDAY, AUGUST 14. 1931 PAGE ELEVEN DOLLAR DAY Lindberghs Awaiting VISIT NEW TELEPHONE EXCHANGE GREAT SUCCESS 9,000 Better Weather To Merchants Pleased With Thousands Of Waterburians Attracted By Special Shopping Event The Inspection Days Here Continue Flight New And Equipment Yesterday Exchange — Prove Popular THE STORES” CROWDED Next Leg Is Overseas to Siberia German Flyer of Avia- Expressions of Jubilance were Lands—One Woman Preparing—Body heard on all sides to-day over the With Citizens success of the Dollar Day con- tor Seen ducted In Waterbury yesterday. While reports are not complete — of oil and gaso- leaders Nome, Alaska, Aug. 14—(UP) Special supplies a available as yet, business American and hia Taken Through at Time—Trip Col. and Mrs Charles A. Lindbergh line for the flyer of Twenty were frank to state that yester- made available at Groups awaited better weather today be- wife have ben day's sales passed last year's Dollar announce- Fas* an over-sea the airdrome there, the About an Hour—Dial Equipment mark. In the words of Frank fore soaring away on Requires Day Hlbera. A ment said, although the Soviet of- J. Green, secretary of the Cham- flight to Karaginsk, vacation ficials have not been advised of the ber of Commerce, "yesterday’s ex- dangerous leg of their trip cinating to Visitors date of their expected arrival. ceptionally large turnout of shop- to the Orient. here for almost Copenhagen, Aug. -

50 Jahre REUSS Jahrbuch Der Luft- Und Raumfahrt
50 Jahre REUSS Jahrbuch der Luft- und Raumfahrt * 50 Jahre Luft- und Raumfahrt in Deutschland * 50 Jahre REUSS - Eine Dokumentation von Arno L. Schmitz November 2000 2 Statt einer Einleitung Deutschland in den zu Ende gehenden 40er-Jahren war ein Land noch voller Not, Trümmer überall! Langsam begann das so genannte Wirtschaftswunder zu greifen, der Aufschwung begann – insbesondere nach der Währungsreform vom 18. Juni 1948. Jeder Deutsche be- kam ein Kopfgeld von 40,00 Deutsche Mark (was etwa der Grundausgabe einer Woche entsprach) und später nochmals 20,00 DM. Der Parlamentarische Rat konstituierte sich in Bonn, die Westalliierten schränkten ihre Demontage ein und gaben die Idee auf, Deutsch- land im Zustand eines nicht-industriellen Landes zu halten. Deutschland konnte sich wie- der „einrichten“. Armes, deutsches Volk, du hast Städte gebaut, hast Dome gebaut, du hast einen frei- en Bauern auf freien Grund gestellt, hast auf dem Gebiet der Kunst, der Wissen- schaft, des Rechts, der Sprache Höhen erreicht. Du hast die Hansa, hast Zünfte, hast das freie Gewerbe, hast mannigfaltigen Ausdruck für deine Wesenheit gefunden und deine Militärorganisation kann allenfalls als ein Zug deines Gesichtes gelten, als ein Ressort deiner gesamten gesellschaftlichen Verfassung. Dieses Ressort hat sich auf- gebläht, ist mächtig geworden, hat alles in sich einbezogen. Es hat alle Dämme nie- dergerissen und ist über die Landesgrenzen hinweggeschwemmt, und der Bauer hat von seinem Land, der Arbeiter von seiner Arbeit, der Priester von seiner Gemeinde, der Lehrer von seinen Hörern, die Jugend von ihrer Jugend, der Mann von seiner Frau lassen müssen, und das Volk hat als Volk aufgehört und ist nichts als Brenn- stoff für den ungeheuren rauchenden Berg, und der Einzelne ist nichts als Holz, als Torf, als brennbares Fett und zuletzt eine ausgespiene schwarze Flocke. -
Aircraft Seating Market Heating Up!
ISSN 2667-8624 VOLUME 1 - ISSUE 3 - YEAR 2020 TECHNOLOGY HIGH-TECH MATERIAL UTILIZATION TREND IN IATA EXECUTIVES THE AVIATION INDUSTRY GATHERED WITH GLOBAL AVIATION MEDIA IN GENEVA AVIATION HISTORY ELLY BEINHORN’S RECORD BREAKING REPORT FLIGHT FROM GERMANY TURKISH AIRPORTS TO TURKEY UPWARD PERFORMANCE IN 2019 WOMEN OF AVIATION WORLDWIDE WEEK CABIN INTERIOR AIRCRAFT SEATING MARKET HEATING UP! VOLUME 1 - YEAR 2020 - ISSUE 3 contents ISSN 2667-8624 Publisher & Editor in Chief Managing Editor Ayşe Akalın Cem Akalın 14 [email protected] cem.akalin@aviationturkey. com International Relations & Advertisement Director Administrative Şebnem Akalın Coordinator sebnem.akalin@ Yeşim Bilginoğlu Yörük aviationturkey.com y.bilginoglu@ aviationturkey.com Chief Advisor to Editorial Board Editors Can Erel / Aeronautical Muhammed Yılmaz/ Engineer Aeronautical Engineer Translation İbrahim Sünnetçi Tanyel Akman Şebnem Akalin Saffet Uyanık Proof Reading & Editing Mona Melleberg Yükseltürk Photographer Sinan Niyazi Kutsal Graphic Design 2019 Worst Gülsemin Bolat İmtiyaz Sahibi Year for Görkem Elmas Hatice Ayşe Evers Advisory Board Basım Yeri Air Freight Aslıhan Aydemir Demir Ofis Kırtasiye Demand Serdar Çora Perpa Ticaret Merkezi B Blok 8 Renan Gökyay Kat:8 No:936 Şişli / İstanbul Since 2009 Lale Selamoğlu Kaplan Tel: +90 212 222 26 36 Assoc. Prof. Ferhan Kuyucak IATA demirofiskirtasiye@hotmail. Şengür com Executives Adress www.demirofiskirtasiye.com Administrative Office Gathered Basım Tarihi DT Medya LTD.STI Şubat - 2020 with Global İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi Sinpaş Yayın Türü Aviation Altınoran Kule 3 No:142 Süreli Media in Çankaya Ankara/Turkey Geneva Tel: +90 (312) 557 9020 [email protected] www.aviationturkey.com © All rights reserved. No part of publication may be reproduced by any means without Jetex – written permission.