1955–1965 Die „Langen 50Er Jahre“ STEFAN KARNER
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bundesregierung Gorbach 1 Von 2
Index IX. GP - Anhang - Bundesregierung Gorbach 1 von 2 7 Bundesregierung Gorbach vom 11. April 1961 bis 27. März 1963 Amtsdauer Bundesministerien Mitglieder der Bundesregierung und Staatssekretäre Ernannt am I Enthoben am **) Bundeskanzler Dr. Alfons Gorbach 27. März 1963 Bundes- 1110 April 1961 kanzleramt Vizekanzler Dr. Bruno **) Pittermann *) 27. März 1963 ) -- - ----- ------- **) Bundes- Bundesminister Dr. Bruno Kreisky 11. April 1961 27. März 1963 ministerium für Auswärtige Staatssekretär **) Angelegenheiten Dr. Ludwig Steiner 11. April 1961 27. März 1963 **) Bundesminister Josef Afritsch 11. April 1961 Bundes- 27. März 1963 ministerium für Inneres Staatssekretär Dr: Otto **) Kranzlmayr 11. April 1961 27. März 1963 . ~~~--~-----_._- Bundes- **) ministerium für Bundesminister Dr. Christian Broda 11. April 1961 27. März 1963 Justiz -- ---- Bundes- Dr. Heinrich 11. April 1961 **) ministerium für Bundesminister 27. März 1963 Unterricht Drimmel Bundes- **) ministerium für Bundesminister Anton Proksch 11. April 1961 27. März 1963 soziale Verwaltung - ---- ---.--- --------- .- Bundes- **) ministerium für Bundesminister Dr. Josef Klaus 11. April 1961 27. März 1963 Finanzen ---- - -- ------ Bundes- **) ministerium für Bundesminister Dipl.-Ing. Eduard 11. April 1961 Land- und Forst- Hartmann 27. März 1963 wirtschaft ---- --- -~-- - -_. *) Mit Entschließung des Bundespräsidenten vom 11. April 1961, BGBl. Nr. 96, wurde Vizekanzler Dr. Pittermann mit der sachlichen Leitung bestimmter zum Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes gehören• der Angelegenheiten gemäß Art. 77 Abs. 3 B.-VG. betraut. **) Die Bundesregierung wurde auf Grund ihrer Demission nach der Nationalratswahl (18. 11. 1962) vom Bundespräsidenten am 20. 11. 1962 vom Amte enthoben; gleichzeitig wurden die Mitglieder der Bundes regierung mit der Fortführung der von ihnen bisher innegehabten Ämter und der bisherige Bundeskanzler mit dem Vorsitz in der einstweiligen Bundesregierung betraut sowie die biSherigen Staatssekretäre wiederernannt ("Wiener Zeitung" Nr. -
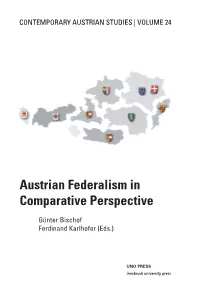
Austrian Federalism in Comparative Perspective
CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 24 Bischof, Karlhofer (Eds.), Williamson (Guest Ed.) • 1914: Aus tria-Hungary, the Origins, and the First Year of World War I War of World the Origins, and First Year tria-Hungary, Austrian Federalism in Comparative Perspective Günter Bischof AustrianFerdinand Federalism Karlhofer (Eds.) in Comparative Perspective Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) UNO UNO PRESS innsbruck university press UNO PRESS innsbruck university press Austrian Federalism in ŽŵƉĂƌĂƟǀĞWĞƌƐƉĞĐƟǀĞ Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 24 UNO PRESS innsbruck university press Copyright © 2015 by University of New Orleans Press All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage nd retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive. New Orleans, LA, 70148, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America Book design by Allison Reu and Alex Dimeff Cover photo © Parlamentsdirektion Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press by Innsbruck University Press ISBN: 9781608011124 ISBN: 9783902936691 UNO PRESS Publication of this volume has been made possible through generous grants from the the Federal Ministry for Europe, Integration, and Foreign Affairs in Vienna through the Austrian Cultural Forum in New York, as well as the Federal Ministry of Economics, Science, and Research through the Austrian Academic Exchange Service (ÖAAD). The Austrian Marshall Plan Anniversary Foundation in Vienna has been very generous in supporting Center Austria: The Austrian Marshall Plan Center for European Studies at the University of New Orleans and its publications series. -

70 Jahre Steirische Reformkraft Politicum Steirische Reformkraft 70 Jahre 118 |Mai2015 Politicum - Bestellservice
politicum 118 | Mai 2015 70 jahre steirische reformkraft 70 jahre steirische reformkraft politicum 118 | Mai 2015 politicum - Bestellservice Nr. 89 Public Private Partnership Nr. 90 Staatsreform Nr. 91 Migration Nr. 92 Partei 21 VERGRIFFEN Nr. 93 Lebenschance Bildung Nr. 94 Österreich-Konvent Nr. 95 Stark für Schwach Nr. 96 EU-Erweiterung Nr. 97 Universitäten der Zukunft Nr. 98 SICHER ?ist? SICHER Nr. 99 Aussichten Nr. 100 Zukunft Nr. 101 Klimaschutz/Umweltpolitik Nr. 102 1918-Der Beginn der Republik Nr. 103 Stadtentwicklung Nr. 104 EURO 2008 Nr. 105 Steuerreform Nr. 106 Reform des Gesundheitssystems Nr. 107 Steirische Politikerinnen Nr. 108 Europarat Nr. 109 „Grenz-Erfahrungen“ Nr. 110 Erziehung Nr. 111 Sicherheit Nr. 112 Kulturvisionen Nr. 113 LH Josef Krainer sen. Nr. 114 Reformpartnerschaft VERGRIFFEN Nr. 115 Wehrpflicht vs. Berufsheer Nr. 116 Jugend & Arbeitsmarkt Nr. 117 energie: green dreams … Die oben genannten Ausgaben können Sie, soweit verfügbar, zu einem Stückpreis von € 10,- bestellen. Wenden Sie sich bitte an: Verein für Politik und Zeitgeschichte in der Steiermark, Karmeliterplatz 6, 8010 Graz Tel. 0316/60744-4350, Fax: 0316/60744-4325 • Portraits am Cover: E-Mail: [email protected], Internet: www.politicum.at Oben von links: Alois Dienstleder, Anton Pirchegger, Alfons Gorbach, Josef Krainer sen. Unten von links: Friedrich Niederl, Josef Krainer jun., Waltraud Klasnic, Hermann Schützenhöfer. Sie können das politicum auch abonnieren: Für € 25,- erhalten Sie vier Ausgaben Liebe Leserinnen und Leser! Liebe Freunde der Steirischen Volkspartei! HERMANN SCHÜTZENHÖFER m 18. Mai 1945 wurde im Konvents- Steirische Volkspartei vermutlich eine der her- gebäude der Kreuzschwestern in Graz aus forderndsten Perioden der jüngeren Ver- A die Steirische Volkspartei gegründet. -

Austrian Neutrality in Postwar Europe
67 - 12,294 SCHLESINGER, Thomas Otto, 1925- AUSTRIAN NEUTRALITY IN POSTWAR EUROPE. The American University, Ph.D„ 1967 Political Science, international law and relations University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan © Copyright by Thomas Otto Schlesinger 1967 AUSTRIAN NEUTRALITY IN POSTWAR EUROPE BY THOMAS OTTO SCHLESINGER Submitted to the Faculty of the School of International Service of The American University In Partial Fulfillment of The Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in INTERNATIONAL RELATIONS Signatures of Committee: RttAU Chairma Acting Dean: yilember Member auu. 2 rt£ 7 Datete Approved 2 , 7 June 1967 The American University AMERICAN UNIVERSITY LIRPAOY Washington, D. C. MAY 2 a mi A crMn PREFACE In thought, this dissertation began during the candi date's military service as interpreter to the United States military commanders in Austria, 1954-1955, and northern Italy, 1955-1957. Such assignments, during an army career concluded by retirement in 1964, were in part brought about by the author's European background— birth in Berlin, Ger many, and some secondary schooling in Italy and Switzerland. These circumstances should justify the author's own trans lation— and responsibility therefor— of the German, French, and Italian sources so widely used, and of the quotations taken from these. As will become obvious to any reader who continues for even a few pages, the theoretical conception for this study derives in large part from the teachings of the late Charles O. Lerche, Jr., who was Dean of the School of Inter national Service when the dissertation was proposed. While Dean Lerche's name could not appear in the customary place for approval, the lasting inspiration he provided makes it proper that this student's deepest respect and admiration for him be recorded here. -

The Vic M Myth Revisited: the Poli Cs of History in Austria up Un L The
Peter Pirker Introduction Over the last thirty years, no other concept has de!ned the politics of history concerning Austria’s Nazi past to a greater extent than the concept of the Austrian “victim myth.” "e term emerged in the mid-1980s as part of an e#ort to expose the victim hypothesis formulated in the Declaration of Independence of April, 27, 1945—namely that Austria was occupied by Nazi Germany in March 1938 and became, along with its population, a helpless and defenseless victim of German repression, exploitation, and warmongering—as an “existential lie,” a “!ction,” and a “state mythol- ogy.”1 "e exposure of the “victim myth” profoundly changed Austria’s “national mythscape” (Duncan Bell). Today, one could well claim that it has become a widely shared component of the national memory regime, which has moreover taken on a legitimizing function on the level of gov- ernance. "is became especially clear in the 2018 memorial year after the Austrian People’s Party (ÖVP), under the leadership of Sebastian Kurz, had entered into a coalition government with the right-wing Austrian Freedom Party (FPÖ) despite the fact that the latter has made a name for itself with rather di#erent attitudes regarding the politics of history, especially in relation to the service of Austrians in the Wehrmacht, as well as with repeated revisionist, antisemitic, and racist statements made by its functionaries. Now, the “new” politics of memory went hand in hand with a decisively right-wing politics directed against refugees and immigrants, with Austria and the Austrians being stylized as victims that needed protection from an unbridled—and, in the anti-Semitic discourse of the FPÖ, even targeted—invasion by foreigners. -

Katholische Couleurstudenten Im Widerstand VORWORT
75 JAHRE BEFREIUNG: katholische Couleurstudenten im widerstand VORWORT WOLF STEINHÄUSL v. DIONYSOS FOE, Rt-D Kartellsenior des MKV Derzeit leben wir in einer politisch äußerst polarisierenden Welt. Nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa spitzt sich die Situation immer stärker zu. Sowohl Links- als auch Rechtsextremismus fordern immer mehr Opfer und verun- sichern die Bevölkerung. Umso wichtiger ist es, mit festen und unverrückbaren Prinzipien den Weg der Mitte zu bestreiten. Gerade für uns katholische Couleurstudenten gilt es, konsequent zu unseren Werten zu stehen und jegliche Art von Extremismus abzulehnen. Religio, Patria, Scientia und Amicitia, das sind die Grundsätze, die wir stolz mit Band und Deckel nach außen tragen. Gerade in prekären Situationen und unsicheren Zeiten gilt es, unsere Prinzipien zu bewahren und zu verteidigen. Das ist es, was uns katholische Couleurstudenten ausmacht: Hinsehen, Aufstehen und Courage zeigen, gerade wenn viele andere aus Angst, Unsicherheit oder einfach aus Bequemlichkeit wegschauen. Als Kartellsenior des MKV bin ich stolz darauf, was unzählige unserer Kartellbrüder im Widerstand aktiv gegen das NS-Regime geleistet haben. Sie haben Farbe bekannt, unabhängig von den Konsequenzen, die sie zu erwarten hatten. Größere Vorbilder kann es für uns alle gar nicht geben. Viele unserer Kartellbrüder mussten ihren Einsatz für die Gesellschaft mit ihrem Le- ben bezahlen. Genau sie gilt es, niemals zu vergessen. „Niemals wieder“ muss unser Credo sein! 2 VORWORT MICHAEL BAYRHAMMER v. BECCARIA Walth Vorortspräsident des ÖCV Mitglieder katholischer Studentenverbindungen stellen an eigene Handlungen höchste Ansprüche. Basierend auf die- sen Ansprüchen gestalten sie die Gesellschaft entscheidend mit. Es ist wichtig, unbequem zu sein, kritisch zu sein, alle als Tatsachen dargestellten Informationen zu hinterfragen, keine Meinung aus Prinzip auszuschließen, bloß weil sie dem eigenen ideologischen Weltbild nicht entspricht. -

The Schüssel Era in Austria Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.)
The Schüssel Era in Austria Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES Volume 18 innsbruck university press Copyright ©2010 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, ED 210, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Published and distributed in the United States by Published and distributed in Europe by University of New Orleans Press: Innsbruck University Press: ISBN 978-1-60801-009-7 ISBN 978-3-902719-29-4 Library of Congress Control Number: 2009936824 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Assistant Editor Ellen Palli Jennifer Shimek Michael Maier Universität Innsbruck Loyola University, New Orleans UNO/Vienna Executive Editors Franz Mathis, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver Wirtschaftsuniversität -

Austria and the European Integration Process — Chronology 1945-2006
Austria and the European integration process — Chronology 1945-2006 Copyright: (c) Translation CVCE.EU by UNI.LU All rights of reproduction, of public communication, of adaptation, of distribution or of dissemination via Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries. Consult the legal notice and the terms and conditions of use regarding this site. URL: http://www.cvce.eu/obj/austria_and_the_european_integration_process_chronology _1945_2006-en-74a26b48-396d-449b-8aea-5e081f2833e1.html Last updated: 05/07/2016 1/22 Austria and the European integration process from 1945 to 2006: a chronology 8–9 May 1945: Capitulation of the German Wehrmacht in Reims, France, and in Karlshorst (in the Lichtenberg borough of Berlin), Germany. 5 September 1946: Signing of the Gruber–De Gasperi Agreement, named after the Austrian Foreign Minister, Karl Gruber, and the Italian Foreign Minister, Alcide De Gasperi. Also known as the Paris Agreement, it becomes part of the Italian Peace Treaty, inserted in its Annex IV, and is intended to guarantee the German-speaking population of South Tyrol certain rights; according to Article 85 of the Peace Treaty, the Annexes are an integral part of the Treaty. 19 September 1946: Winston Churchill gives his Zurich speech in which he calls for the establishment of the United States of Europe and a Council of Europe. 10 February 1947: Although the Gruber–De Gasperi Agreement, devised as a ‘European solution’, is enshrined in Annex IV of the Italian Peace Treaty, it is subsequently implemented only to a very limited extent. 4 March 1947: The Treaty of Dunkirk is concluded between the United Kingdom and France for a period of 50 years as a Treaty of Alliance and Mutual Assistance in the event of any renewal of German aggression; the Treaty is the precursor of the 1948 Brussels Treaty. -

Jews and Queers in Late-Twentieth-Century Vienna / Matti Bunzl
© 2008 UC Regents Buy this book Erich Lifka’s “Landesgericht zwei, Wien” appears by permission of Foerster Media. Erich Fried’s “An Österreich” appears by permission of Claassen Verlag, Munich. English-language translation of Erich Fried’s “To Austria” reprinted from Contemporary Jewish Writing in Austria: An Anthology, edited by Dagmar C. G. Lorenz, by permission of the University of Nebraska Press. © 1999 by the University of Nebraska Press. University of California Press Berkeley and Los Angeles, California University of California Press, Ltd. London, England © 2004 by the Regents of the University of California Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Bunzl, Matti, 1971–. Symptoms of modernity : Jews and queers in late-twentieth-century Vienna / Matti Bunzl. p. cm. Includes bibliographical references. isbn 0–520–23842–7 (cloth : alk. paper) — isbn 0–520–23843–5 (pbk. : alk. paper) 1. Jews—Austria—Vienna—Social conditions—20th century. 2. Gays— Austria—Vienna—Social conditions—20th century. 3. Vienna (Austria)— Ethnic relations. 4. Vienna (Austria)—Social life and customs—20th century. 5. Austria—History—1955- 6. Austria—Social policy. 7. Nationalism—Social aspects—Austria. I. Title. ds135.a92 v52216 2004 305.892'4043613'09049—dc21 2003002458 Manufactured in the United States of America 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 10987654 321 The paper used in this publication is both acid-free and totally chlorine- free (tcf). It meets the minimum requirements of ansi/niso z39.48–1992 (r 1997) (Permanence of Paper).8 chapter 1 Myths and Silences It would be unkind not to speak about your guilt that bends you to the ground and threatens to crush you. -

Der Erste Österreichertransport in Das KZ Dachau 1938
Wolfgang Neugebauer Peter Schwarz Stacheldraht, mit Tod geladen … Der erste Österreichertransport in das KZ Dachau 1938 Wolfgang Neugebauer Peter Schwarz Stacheldraht, mit Tod geladen … Der erste Österreichertransport in das KZ Dachau 1938 Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft der KZ-Verbände und Widerstandskämpfer Österreichs Redaktion: Christine Schindler Die Herausgabe dieser Broschüre wurde durch den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus gefördert. © 2008, Arbeitsgemeinschaft der KZ-Verbände und Widerstandskämpfer Österreichs, Wien Cover: Ernst Eisenmayer Layout: Christa Mehany-Mitterrutzner Druck: S.Print, 1220 Wien ISBN 978-3-901142-53-6 Vorwort Als am Morgen des 12. März 1938 die Truppen der Hitler-Wehrmacht Österreichs Grenzen überschritten, wussten die NS-Gegner, gleich ob sie Anhänger der Regierung Schuschnigg waren oder in der illegalen Arbeiter- bewegung in Opposition zur Regierung standen, dass es keine Hoffnung mehr auf die Erhaltung der Unabhängigkeit Österreichs gab. Noch bevor die deutsche Wehrmacht in Wien eingetroffen ist, waren schon NS-Greifkommandos unterwegs, um die Verhaftungslisten des unter dem Druck Hitlers eingesetzten Innenministers Seyß-Inquart abzuarbeiten. Damit wurde eine Hetzjagd nicht nur auf die jüdischen Bürger, sondern vor allem auch auf die politischen Gegner des Hitler-Regimes begonnen. Am 1. April wurde aus der Masse der Verhafteten der erste Transport von Häftlingen nach Dachau zusammengestellt. Die beiden Verfasser der vorlie- genden Broschüre, Hon.-Prof. Dr. Wolfgang Neugebauer und Mag. Peter Schwarz, haben in dankenswerter Weise dargestellt, mit welcher Brutalität dieser Transport vonstatten ging. Die Nazis wollten mit den Terrormaßnah- men vor allem die Angst in der österreichischen Bevölkerung schüren und auch die Jubler beeindrucken. Dachau war als Konzentrationslager seit den Tagen bekannt, als Hitler nach der Machtergreifung in Deutschland im Jahre 1933 vor allem die politischen Gegner dorthin deportierte. -

Wolfgang Mueller in the History of the Cold War and Détente, Reference Is
PEACEFUL COEXISTENCE, NEUTRALITY, AND BILATERAL RELATIONS ACROSS THE IRON CURTAIN: INTRODUCTION Wolfgang Mueller In the history of the Cold War and détente, reference is seldom made to the international relations of the small states. If their fates in the Cold War are mentioned at all, they figure either as hot spots of East-West ten- sion, sometimes using their “leverage of the weak” to extract the most backing possible from their superpower patrons, or as passive objects of great-power policy. With regard to détente, their role has also not yet been comprehensively analyzed. Ostpolitik is usually attributed to only France and West Germany, while among the East European states’ initiatives, little other than the Rapacki and the Gomułka Plans are remembered. Special attention is given to the neutrals above all in the context of the CSCE. But if we want to better understand what role détente took in the European in- ternational system as a whole, however, more research must be undertaken about the foreign relations of Europe’s smaller members on both sides of the Iron Curtain.1 This volume undertakes the task of reassessing comparatively, on the basis of newly declassified sources from Western and formerly Eastern ar- chives,2 the preconditions and varying developments of bilateral relations across the Iron Curtain, between the USSR, Eastern Europe, and neutral but capitalist Austria, in the years of détente and the late Cold War. The first part of this volume provides the reader with information on Austria’s political system, its principles of foreign policy, its trade, and its culture. -

Challenging Political Culture in Postwar Austria
John Carroll University Carroll Collected History 12-1997 Challenging Political Culture in Postwar Austria: Veterans' Associations, Identity, and the Problem of Contemporary History Matthew .P Berg John Carroll University, [email protected] Follow this and additional works at: http://collected.jcu.edu/hist-facpub Part of the History Commons Recommended Citation Berg, Matthew P., "Challenging Political Culture in Postwar Austria: Veterans' Associations, Identity, and the Problem of Contemporary History" (1997). History. 14. http://collected.jcu.edu/hist-facpub/14 This Article is brought to you for free and open access by Carroll Collected. It has been accepted for inclusion in History by an authorized administrator of Carroll Collected. For more information, please contact [email protected]. Challenging Political Culture in Postwar Austria: Veterans' Associations, Identity, and the Problem of Contemporary History Matthew Paul Berg Since the Waldheim election and the almost simultaneous appearance of Jorg Haider, recent history is a permanent guest at the center of politics.1 observation, registered by Marianne Enigl and Herbert Lackner, points to an incontestable and compelling feature of contemporary THIS Austrian political culture: during the 1980s and 1990s, the first mean- ingful steps toward an Austrian Vergangenheitsbewaltigungdeveloped out of a dis? cussion of Austrians, military service during the Nazi era and its highly prob- lematic association with wartime atrocities and genocide. Exploration of this important theme had been avoided throughout the period of the Second Republic by a carefully cultivated expression of public memory. The inherent tension between the internationally sanctioned notion of Austrian victimization during the Nazi years and the pride of many Austrian veterans in having per- formed their soldierly duties (Wehrpflichterflillung) had been a taboo subject.