Weimar Und Die Republik.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ludwig Von Hofmann Im Weimarer Kreis
Die Verheissung der Tänzerin Ruth St. Denis : Ludwig von Hofmann im Weimarer Kreis Autor(en): Wintsch, Susann Objekttyp: Article Zeitschrift: Georges-Bloch-Jahrbuch des Kunsthistorischen Instituts der Universität Zürich Band (Jahr): 5 (1998) PDF erstellt am: 10.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-720086 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Susann Wintsch Die Verheissung der Tänzerin Ruth St. Denis Ludwig von Hofmann im Weimarer Kreis 1. Die kunstkritische Abwertung der Malerei Ludwig von Hofmanns: Julius Meier- 1 Meier-Graefe, Julius, Entwicklungsgeschichte Graefe widmete im Jahr 1904 dem Maler Ludwig von Hofmann (1861—1945) in seinem der modernen Kunst. -

Ermächtigungsgesetze Von 1914 Bis 1933 Und Die SPD Ausarbeitung
Wissenschaftliche Dienste Ausarbeitung Ermächtigungsgesetze von 1914 bis 1933 und die SPD © 2016 Deutscher Bundestag WD 1 - 3000 - 015/14 Wissenschaftliche Dienste Ausarbeitung Seite 2 WD 1 - 3000 - 015/14 Ermächtigungsgesetze von 1914 bis 1933 und die SPD Verfasser/in: Aktenzeichen: WD 1 - 3000 - 015/14 Abschluss der Arbeit: 05.03.2014 Fachbereich: WD 1: Geschichte, Zeitgeschichte und Politik Telefon: Ausarbeitungen und andere Informationsangebote der Wissenschaftlichen Dienste geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Der Deutsche Bundestag behält sich die Rechte der Veröffentlichung und Verbreitung vor. Beides bedarf der Zustimmung der Leitung der Abteilung W, Platz der Republik 1, 11011 Berlin. Wissenschaftliche Dienste Ausarbeitung Seite 3 WD 1 - 3000 - 015/14 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 4 2. Verwendung des Begriffs „Ermächtigungsgesetz“ in Wissenschaft und Politik 5 3. Chronologie der Ermächtigungsgesetze 1914-1933 8 3.1. Ermächtigungsgesetz im Kaiserreich 8 3.2. Ermächtigungsgesetze der Weimarer Nationalversammlung 8 3.3. Ermächtigungsgesetze der Weimarer Republik 9 3.4. Ermächtigungsgesetz im nationalsozialistischen Deutschen Reich 12 4. Die Haltung der SPD zu den Ermächtigungsgesetzen 13 5. Quellen- und Literaturverzeichnis 15 5.1. Quellen 15 5.2. Literatur 15 Wissenschaftliche Dienste Ausarbeitung Seite 4 WD 1 - 3000 - 015/14 1. Einleitung -

Die Einführung Des Rundfunks in Deutschland Und Die Reaktion Der Organisierten Arbeiterradiobewegung Auf Das Neue Medium
Die Einführung des Rundfunks in Deutschland und die Reaktion der organisierten Arbeiterradiobewegung auf das neue Medium Freie wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des Grades eines Magister Artium am Fachbereich Kommunikationswissenschaften der Freien Universität Berlin von: Klaus - Michael Klingsporn März 1988 Einleitung: Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Entstehungsgeschichte des Weimarer Rundfunks und der Versuch der neu entstandenen Arbeiterradiobewegung, auf das neue Medium Ein- fluß zu gewinnen. Durch die Gegenüberstellung beider Prozesse soll die Voraussetzung da- für geschaffen werden, sowohl die Kritik der Arbeiterradiobewegung am Weimarer Rund- funk und ihre Vorstellungen über eine andere, den Interessen und Bedürfnissen der organi- sierten Arbeiterschaft angemesseneren Gestaltung des Mediums, als auch das weitgehende Scheitern einer Durchsetzung dieser Vorstellungen nachvollziehen und einschätzen zu kön- nen. Diese im wesentlichen historische Gegenstandsbestimmung ist Resultat einer ausgedehnten Beschäftigung mit der Arbeiterradiobewegung. Mein ursprüngliches Interesse bestand da- bei darin, im Rahmen der Arbeiterradiobewegung entwickelte Radio-Utopien aufzuspüren, also auch für die heutige Zeit noch wegweisende Vorstellungen über eine alternative Ge- staltung des Mediums Rundfunk, an deren Existenz innerhalb der Bewegung es für mich, vor allem nach der Lektüre der Arbeit Peter Dahl’s (1978), keinerlei Zweifel gab. Auch eine erste Sichtung der von dem Arbeiterradioverein herausgegebenen Zeitschrift schien dies zu bestätigen, denn gerade in den ersten Jahrgängen finden sich hier eine Reihe von Aufsätzen, in denen Erwartungen und Hoffnungen an das neue Medium formuliert werden und aus de- nen sich, wie ich hoffte, durchaus eine zusammenhängende Radio-Utopie, ähnlich etwa der Berthold Brechts, rekonstruieren ließe. Im Laufe weiterer Quellenarbeit gelangte ich jedoch zu der Erkenntnis, daß ein solcher Re- konstruktionsversuch einer bloßen Illusionsproduktion gleichgekommen wäre. -

Der Menschensammler Bismarck, Rathenau, Rilke, Maillol, Josephine Baker – Harry Graf Kessler Kannte Sie Alle
Kultur KULTURGESCHICHTE Der Menschensammler Bismarck, Rathenau, Rilke, Maillol, Josephine Baker – Harry Graf Kessler kannte sie alle. Der Museumsleiter, Mäzen, Diplomat und Autor regte den „Rosenkavalier“ an und druckte traumhaft schöne Bücher. Seine Tagebücher entfalten eindrucksvoll das Panorama einer Epoche. Gedanken, die was wert sind, wollen Jahrzehnte steigert sich seine Kunst bis zur Einen Händedruck vom US-Präsidenten nicht begriffen sondern erlebt sein. Perfektion. Eine Momentaufnahme vom und Gletschertouren bei Sankt Moritz, ei- Harry Graf Kessler, Mai 1896 Februar 1926 in Berlin: „Ich fuhr also zu nen Blick von der Cheopspyramide und Vollmoeller in seinen Harem am Pariser Nächte in kanadischen Blockhütten, die ie ein „grosser schöner Hund, ein Platz und fand dort … zwischen einem hal- Festspiele in Oberammergau und ein Anti- Bernhardiner“, blickt der Mann ben Dutzend nackter Mädchen auch Miß semitentreffen in Berlin („das Hauptresul- Wauf dem Sofa. Und wie ein Hund Baker, ebenfalls bis auf einen rosa Mull- tat war ein ziemliches Bier-Besäufnis“), gibt er Pfötchen: „Die Finger sind auffal- schurz völlig nackt.“ Josephine Baker, die Opiumhöhlen – plus Kostprobe – in Shang- lend lang und fein gebildet; nur die Farbe er zum ersten Mal sieht, „tanzte mit äu- hai und ein Gespräch mit Cosima Wagner, fast leichenhaft. Er sieht Einen fest und ßerster Groteskkunst und Stilreinheit…So der Herrin von Bayreuth: Das hat schon lange an; Irres ist im Blick Nichts.“ müssen die Tänzerinnen Salomos und Tut- der 25-Jährige hinter sich. Von Helsingör Harry Graf Kessler trifft den geistes- ench-Amuns getanzt haben. Sie tut das bis Syrakus, von Tokio bis zum Sankt- kranken Friedrich Nietzsche. Sprechen stundenlang scheinbar ohne Ermüdung, Lorenz-Strom kennt er die Welt und wird kann der „Gott ist tot“-Denker, den seine immer neue Figuren erfindend wie im doch nicht müde, sie erkennen zu wollen. -

1923 Inhaltsverzeichnis
1923 Inhaltsverzeichnis 14.08.1923: Regierungserklärung .............................................................................. 2 22.08.1923: Rede vor dem Schutzkartell für die notleidende Kulturschicht Deutschlands ........................................................................................ 14 24.08.1923: Rede vor dem Deutschen Industrie- und Handelstag ........................... 18 02.09.1923: Rede anläßlich eines Besuchs in Stuttgart ........................................... 36 06.09.1923: Rede vor dem Verein der ausländischen Presse in Berlin .................... 45 12.09.1923: Rede beim Empfang des Reichspressechefs in Berlin ......................... 51 06.10.1923: Regierungserklärung ............................................................................ 61 08.10.1923: Reichstagsrede ..................................................................................... 97 11.10.1923: Erklärung im Reichstag ........................................................................119 24.10.1923: Rede in einer Sitzung der Ministerpräsidenten und Gesandten der Länder in der Reichkanzlei ..................................................................121 25.10.1023: a) Rede bei einer Besprechung mit den Vertretern der besetzten Gebiete im Kreishaus in Hagen ..........................................................................................147 b) Rede in Hagen .................................................................................................178 05.11.1923: Redebeitrag in der Reichstagsfraktion -

Wertvolle Bücher Abendauktion
WERTVOLLE BÜCHER ABENDAUKTION 6. Juli 2020 499. AUKTION Wertvolle Bücher Manuskripte · Autographen Auktion Aufgrund der allgemeinen Maßnahmen und gesetzlichen Vorgaben zur Pandemie-Bekämpfung bitten wir um vorherige Terminvereinbarung für Ihre Buchbesichtigung Montag, 6. Juli 2020 hier in unseren Räumen! 12.30 h Los 150 – 575 Wertvolle Bücher Ob am Auktionstag eine persönliche Beteiligung im 17.00 h Los 1 – 101 Wertvolle Bücher – Abendauktion Auktionssaal möglich ist, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Wir bitten Sie daher in jedem Fall um vorherige Kontaktaufnahme! Vorbesichtigung | Preview Telefonisch: 040 37 49 61-14 oder per Mail: [email protected] Mo. – Fr. 29. Juni – 3. Juli 11 – 17 Uhr So. 5. Juli 11 – 17 Uhr In line with legal guidelines and current measures taken against the spread of Covid-19 we kindly ask you to make an appointment for your preview at our premises! Ketterer Kunst Hamburg We will decide on short notice if participation in the saleroom will be possible on the day of the auction. We strongly advise you to contact us beforehand! Holstenwall 5 20355 Hamburg Phone: +49 40 37 49 61-14 Anfahrt siehe Lageplan hinten or per e-mail: [email protected] Vorderumschlag Kat.nr. 6 Karl IV., Bulla aurea. Straßburg 1485. Vorderes Vorsatz (doppelblattgr.) Kat.nr. 32 Peter Suhr, Panorama einer Reise von Hamburg nach Altona. Hamburg 1823. Frontispiz Kat.nr. 50 Thomas R. Malthus, An Essay on the Principle of Population. London 1798. Vorletzte Seite Kat.nr. 92 Paul Éluard und Fernand Léger, Liberté j‘écris ton nom. Paris 1953. Hinteres Vorsatz (doppelblattgr.) Kat.nr. 64 Edoardo Cerillo, Dipinti murali di Pompei. -

Bibliothek Der Universität Kyoto Citation
Title ワイマール共和国時代の文献コレクション目録 Author(s) Bibliothek der Universität Kyoto Citation 京都大学附属図書館. (1983): 1-155 Issue Date 1983-03-19 URL http://hdl.handle. -

Henry Van De Velde Year in Germany and Belgium: Part One
Jane Van Nimmen Henry van de Velde Year in Germany and Belgium: Part One Nineteenth-Century Art Worldwide 12, no. 2 (Autumn 2013) Citation: Jane Van Nimmen, “Henry van de Velde Year in Germany and Belgium: Part One,” Nineteenth-Century Art Worldwide 12, no. 2 (Autumn 2013), http://www.19thc- artworldwide.org/autumn13/van-nimmen-on-henry-van-de-velde-year-in-germany-and- belgium-part-one. Published by: Association of Historians of Nineteenth-Century Art. Notes: This PDF is provided for reference purposes only and may not contain all the functionality or features of the original, online publication. Nimmen: Henry van de Velde Year in Germany and Belgium: Part One Nineteenth-Century Art Worldwide 12, no. 2 (Autumn 2013) Henry van de Velde Year in Germany and Belgium: Part One Honoring the 150th birthday of painter, architect, and designer Henry van de Velde, Google posted a celebratory doodle on April 3, 2013. It was not a global doodle like the glitzy Kiss commemorating Gustav Klimt, displayed around the world in 2012. The pastel tribute to van de Velde could be seen in only a handful of continental markets: Belgium, where he was born in 1863; France, where in 1884 the young painter studied for a few months in Paris with Carolus- Duran and where in 1895 he created three sensational rooms for Siegfried Bing’s new gallery L’Art Nouveau; Austria, where he showed furniture at the Eighth Vienna Secession exhibition in late 1900; Germany, where he lived with his wife and growing family from 1900 until 1917; the Netherlands, where he settled in the 1920s; and Switzerland, where he died in 1957. -

GEN MS 27 Early 20Th-Century German Print Collection Finding Aid
University of Southern Maine USM Digital Commons Search the General Manuscript Collection Finding Aids General Manuscript Collection 8-2012 GEN MS 27 Early 20th-century German Print Collection Finding Aid Julie Cismoski University of Southern Maine Kristin D. Morris Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usm.maine.edu/manuscript_finding_aids Part of the European History Commons, German Literature Commons, and the Military History Commons Recommended Citation Early 20th-century German Print Collection, Special Collections, University of Southern Maine Libraries. This Article is brought to you for free and open access by the General Manuscript Collection at USM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Search the General Manuscript Collection Finding Aids by an authorized administrator of USM Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. UNIVERSITY OF SOUTHERN MAINE LIBRARIES SPECIAL COLLECTIONS EARLY 20th-CENTURY GERMAN PRINT COLLECTION GEN MS 27 Total Boxes: 2 Linear Feet: 1.5 By Julie Cismoski and Kristin D. Morris Portland, Maine August 2012 Copyright 2012 by the University of Southern Maine 1 Administrative Information Provenance: The Early 20th-century German Print Collection was donated in 2012 by Karen S. Curley, whose father acquired the materials while serving in West Germany during the Cold War. Ownership and Literary Rights: The Early 20th-century German Print Collection is the physical property of the University of Southern Maine Libraries. Literary rights, including copyright, belong to the creator or her/his legal heirs and assigns. For further information, consult the Head of Special Collections. Cite as: Early 20th-century German Print Collection, Special Collections, University of Southern Maine Libraries. -

Johannes R. Becher: Vom Münchner Schüler Zum Expressionisten
, 1 8. APR. 1988 AUS nFM"A-NTWy»AfcTAT 1988 3 Herausgeber: DR. KARL H. PRESSLER, RÖMERSTRASSE 7, 8ooo MÜNCHEN 40 ISSN 0343-186 X München - Beiträge zur Literatur, Buchkunst und Bibliophilie LITERATEN, KUNSTLER Michael Reiter SAMMLER, LESER, ANTIQUARE UND VERLAGE City of Beer and Books. Thomas Wolfe und München A 106 Werner Bodenheimer Eberhard Dünninger Bachmairs >Bücherhirt<. Ludwig Steub (1812-1888). Eine wenig bekannte Zu Leben und Werk eines Bibliophilenzeitschrift aus bayerischen Schriftstellers des München A 146 19. Jahrhunderts A 74 ANSICHTSKARTEN, STADTFÜHRER, SPIELKARTEN Resi-Annusch Dust Organisierte Bibliophilie Hans Ries in München. Ein kurzer Dilettantismus als Kunstform. historischer Überblick A 155 Franz Graf Pocci als Illustrator A 81 Adolf Kugler Münchner Ansichtskarten. Anmerkungen zu ihrer Carl-Ludwig Reichert Rolf Selbmann. Geschichte AHO Versuche und Hindernisse Johannes R. Becher. Vom Carls auf seinen Kreuz- und Münchner Schüler zum Querzügen durch die Expressionisten A 85 Antiquariate Münchens A 158 Ludwig Hollweck Stadtführer geleiten durch München A127 Hans-Dieter Holzhausen Noch mehr Münchner Annette Kolb, ihre Dichtungen Antiquariate A 163 und ihre anderen Schriften aus der Sicht eines Sammlers A 96 Hellmut Rosenfeld Das waren noch Preise . .! Fünfhundert Jahre Münchner (Ruth Steinbauer) A 163 Spielkarten. Von karten Heike Pressler spielenden Fürsten und Jakob Wassermanns literarische Königen zu Kartenspiel- Anfänge in München A 103 Königen A 134 IMPRESSUM A 164 Zu dieser Nummer Die bayerische Landeshauptstadt ist in den kommenden Metropole als eine der großen und bedeutenden Verlags Tagen Schauplatz der >Buchhändlertage 1988< mit einer städte der Welt unserer Tage nicht nur heute leuchtet, Vielzahl von Veranstaltungen rund um das Buch. Als - sondern auch gestern auf dem Gebiet der Buchkunst, wie wir hoffen - bleibender Beitrag dazu erscheint diese Literatur und Bibliophilie in hellem Lichte lag. -

The Cultivation of Class Identity in Max Beckmann's
THE CULTIVATION OF CLASS IDENTITY IN MAX BECKMANN’S WILHELMINE AND WEIMAR-ERA PORTRAITURE by Jaclyn Ann Meade A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Art History MONTANA STATE UNIVERSITY Bozeman, Montana April 2015 ©COPYRIGHT by Jaclyn Ann Meade 2015 All Rights Reserved ii TABLE OF CONTENTS 1. INTRODUCTION……...................................................................................................1 2. BECKMANN’S EARLY SELF-PORTRAITS ...............................................................8 3. FASHION AND BECKMANN’S MANNERISMS .....................................................11 Philosophical Fads and the Artist as Individual .............................................................27 4. BECKMANN’S IDENTITY AND SOCIAL POLITICS IN HIS MULTIFIGURAL WORK ............................................................................................33 5. BECKMANN AND THE NEW OBJECTIVITY..........................................................45 BIBILIOGRAPHY ..........................................................................................................125 iii LIST OF FIGURES Figure Page 1. Max Beckmann, Three Women in the Studio, 1908 .............................................2 2. Max Beckmann, Die Nacht, 1918 ........................................................................3 3. Max Beckmann, Self-Portrait with a Cigarette, 1923 .........................................3 4. Max Beckmann, Here is Intellect, 1921 ..............................................................3 -
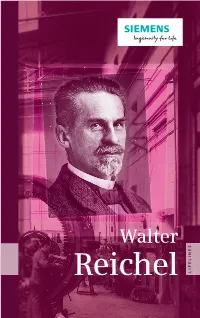
Reichel LIFELINES Walter Reichel’S Lifework Is Closely Linked with the Development of the Rail and Generator Businesses of Siemens
Walter Reichel LIFELINES Walter Reichel’s lifework is closely linked with the development of the rail and generator businesses of Siemens. He is as intimately associated with the legendary high-speed train with three-phase loco- motives as he is with the design of gener- ators and large motors. He was quickly entrusted with tasks of great responsi- bility, both at home and abroad, and he interrupted his Siemens career for two years in to accept a position as a regular professor of electrical engineering in Berlin. Unfazed by the political upheaval of his time, Reichel was passionate about railway electrifi cation and the further development of electrical engineering as a separate fi eld of study at Germany universities. The brochure is the seventh volume in the LIFELINES series, which presents portraits of individuals who have shaped the history and development of Siemens in a wide variety of ways. This includes entrepreneurs who have led the company and members of the Managing Board as well as engineers, inventors, and creative thinkers. Walter Reichel 2 Walter Reichel January , – May , LIFELINES Gibt es das Bild als Scan? Ist aus Buch fotografiert, dabei verzerrt und unscharf! The Siemens engineer – Walter Reichel, 1907 Walter Reichel – An engineer with courage and vision Introduction Walter Reichel was the hero of many a wild tale, some of which were still circulating at Siemens in the 1950s. One was especially popular: During one of the company’s test runs for the Research Association for HighSpeed Electric Railways, Reichel, a Siemens engineer and later a university professor, had himself lashed not just on top of the highspeed car, but underneath it as well, so he could observe how the current collector and the wheel bearings performed while the car was in motion.