Cy Twombly Bild, Text, Paratext
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ovid Book 12.30110457.Pdf
METAMORPHOSES GLOSSARY AND INDEX The index that appeared in the print version of this title was intentionally removed from the eBook. Please use the search function on your eReading device to search for terms of interest. For your reference, the terms that ap- pear in the print index are listed below. SINCE THIS index is not intended as a complete mythological dictionary, the explanations given here include only important information not readily available in the text itself. Names in parentheses are alternative Latin names, unless they are preceded by the abbreviation Gr.; Gr. indi- cates the name of the corresponding Greek divinity. The index includes cross-references for all alternative names. ACHAMENIDES. Former follower of Ulysses, rescued by Aeneas ACHELOUS. River god; rival of Hercules for the hand of Deianira ACHILLES. Greek hero of the Trojan War ACIS. Rival of the Cyclops, Polyphemus, for the hand of Galatea ACMON. Follower of Diomedes ACOETES. A faithful devotee of Bacchus ACTAEON ADONIS. Son of Myrrha, by her father Cinyras; loved by Venus AEACUS. King of Aegina; after death he became one of the three judges of the dead in the lower world AEGEUS. King of Athens; father of Theseus AENEAS. Trojan warrior; son of Anchises and Venus; sea-faring survivor of the Trojan War, he eventually landed in Latium, helped found Rome AESACUS. Son of Priam and a nymph AESCULAPIUS (Gr. Asclepius). God of medicine and healing; son of Apollo AESON. Father of Jason; made young again by Medea AGAMEMNON. King of Mycenae; commander-in-chief of the Greek forces in the Trojan War AGLAUROS AJAX. -

2013 Virginia Senior Classical League State Finals Certamen Level III NOTE to MODERATORS: in Answers, Information in Parentheses Is Optional Extra Information
2013 Virginia Senior Classical League State Finals Certamen Level III NOTE TO MODERATORS: in answers, information in parentheses is optional extra information. A slash ( / ) indicates an alternate answer. Underlined portions of a longer, narrative answer indicate required information. ROUND ONE 1. TOSSUP: From what Latin noun, with what meaning, do the words ignition and igneous ultimately derive? ANS: IGNIS, FIRE BONUS: From what Latin verb, with what meaning, do the words coherent and adhesion derive? ANS: HAEREŌ, STICK/CLING 2. TOSSUP: According to Livy and Plutarch, what legendary Roman triumphed four times, was dictator five times, was never once consul, was honored with the title “Second Founder of Rome,” and conquered the city of Veii in 396 BC? ANS: (M. FURIUS) CAMILLUS BONUS: Following the victory over Veii, for what accusation did his political adversaries impeach Camillus? ANS: EMBEZZLEMENT 3. TOSSUP: According to Hesiod, what moon titan, the daughter of Ouranos and Gaia, bore Leto from the union with her brother Coeus? ANS: PHOEBE BONUS: According to Hesiod, what Star goddess was also the daughter of Phoebe and Coeus and the mother of Hecate? ANS: Asteria 4. TOSSUP: What fifteen-book work of Ovid ends with the apotheosis of Julius Caesar? ANS: METAMORPHOSES BONUS: What other work of Ovid, consisting of epistolary poems written by mythological heroines, allowed him to claim that he had created a new genre of mythological elegy? ANS: HEROIDES rd 5. TOSSUP: Give the 3 person singular, pluperfect active subjunctive of noceō, nocēre. ANS: NOCUISSET nd BONUS: Now give the 2 person plural present subjunctive of morior, morī. -

European Train Names: a Historic Outline Christian Weyers
ONOMÀSTICA BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA European Train Names: a Historic Outline* Christian Weyers DOI: 10.2436/15.8040.01.201 Abstract This paper gives a first overview of the onomastic category of train names, searches to classify the corpus and reviews different stages of their productivity. Apart from geographical names (toponyms, choronyms, compass directions) generally indicating points of origin and destination of the trains in question, a considerable number of personal names have entered this category, of classical literary authors, musicians and scientists, but also of many fictional or non-fictional characters taken from literature or legendary traditions. In some cases also certain symbolic attributes of these persons and finally even heraldic figures have given their names to trains. In terms of their functionality, train names originally were an indicator of exclusiveness and high grade of travel quality, but they developed gradually, as they dispersed over the European continent, into a rather unspecific, generalized appellation, also for regional and local trains. After two periods of prosperity after 1950, the privatisation of railway companies starting in the 1990s had again a very positive effect on the category, as the number of named trains initially reached a new record in this decade. ***** The first train names appeared in England in the 1860s in addition to names for steam locomotives, and on two different levels. The Special Scotch Express between London King’s Cross and Edinburgh (inaugurated in 1862) was called by the public The Flying Scotsman from the 1870s, but it succeeded as the official name not before 1924. Also the names of the German diesel trainsets Der Fliegende Hamburger and Der Fliegende Kölner were colloquial name creations, as were the Train Bleu and the Settebello operated from 1922 and 1953 but officially named in 1947 and 1958, respectively. -

La Red T. E. E. Cumple Feli^Mente So Vigesimo Quinto Aniversario Miguel Cano L
Rama Dieael VT 11 del Parsifal aproximándosa a Per(s. CI^EADA EN 1957 A INSTANCIA DEL HOI^ANDES DEN HOLI^ANDER LA RED T. E. E. CUMPLE FELI^MENTE SO VIGESIMO QUINTO ANIVERSARIO MIGUEL CANO L. LUZZATTI N 1954, el señor Den Hollander, a la nes eran los políticos y ejecutivos del re- sazón director de los Ferrocarriles Ho- • Etoile du Nord, Ile de cién nacido Mercado Común Europeo, los landeses, lanzó la idea de crear una cuales venían obligados a desplazarse con- red de trenes internacionales con unas ca- France y Oiseau Bleu, úni- tinuamente de un país a otro, con cargo a racterísticas comunes de confort y veloci- organismos oficiales o empresas comer- dad, capaces de hacer frente a la compe- cos supervivientes de los on- ciales. tencia del avión, en trayectos de gran de- ce primeros trenes. En principio se pensó en crear un club manda de servicios y en los que la vía distinguido para el transporte ferroviario, férrea, menos vulnerable a las condiciones con un parque propio de trenes, al igual meteorológicas, podía desempeñar aún el • Otros veintisiete trenes que lo era la Compañfa de Wagons Lits en papel que antes de la guerra le era casi han sido sustituidos por In- el campo de los coches-cama. Finalmente exclusivo. prevaleció el sentimiento de que cada ad- La idea descansaba en la utilización de tercities, entre ellos el espa- ministración ferroviaria fuera propietaria de automotores Diesel, capaces de cubrir sus propios vehículos, los cuales se ajusta- cualquier trayecto, sin tener que detenerse ñol Catalán Talgo. -

Early Mythology Ancestry
GRANHOLM GENEALOGY EARLY MYTHOLOGY ANCESTRY 1 INTRODUCTION This book covers the earliest history of man and the mythology in some countries. The beginning from Adam and Eve and their descendants is from the Old Testament, but also by several authors and genealogy programs. The age of the persons in the lineages in Genesis is expressed in their “years”, which has little to do with the reality of our 365-day years. I have chosen one such program as a starting point for this book. Several others have been used, and as can be expected, there are a lot of conflicting information, from which I have had to choose as best I can. It is fairly well laid out so the specific information is suitable for print. In addition, the lineage information shown covers the biblical information, fairly close to the Genesis, and it also leads to both to mythical and historical persons in several countries. Where myth turns into history is up to the reader’s imagination. This book lists individuals from Adam and Eve to King Alfred the Great of England. Between these are some mythical figures on which the Greek (similar to Roman) mythology is based beginning with Zeus and the Nordic (Anglo-Saxon) mythology beginning with Odin (Woden). These persons, in their national mythologies, have different ancestors than the biblical ones. More about the Nordic mythology is covered in the “Swedish Royal Ancestry, Book 1”. Of additional interest is the similarity of the initial creation between the Greek and the Finnish mythology in its national Kalevala epos, from which a couple of samples are included here. -
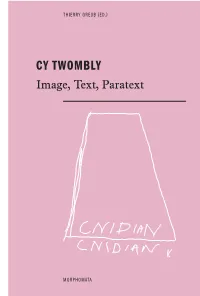
CY TWOMBLY Image, Text, Paratext
THIERRY GREUB (ED.) CY TWOMBLY Image, Text, Paratext MORPHOMATA The artworks of the US artist Cy Twombly (1928–2011) are considered to be hermetic and inaccessible. Pencil scribblings, explosions of paint, tumbling lines, over- lapping layers of color, and inscriptions, geometrical figures, numerals, rows of numbers, words, fragments of quotations, and enigmatic work-titles present very special challenges to both researchers and viewers. In the interdisciplinary and transcultural research meth- od of the Morphomata International Center for Advanced Studies at the University of Cologne, a conference was held in June 2012 that brought art historians together with renowned scholars of Egyptology, Archaeology, German, Greek, English, Japanese, and the Romance languages, i.e. all the fields and cultural spheres that were a source of inspiration for the œuvre of Cy Twombly. While these scholars inquire into the relation between title, work, and inscribed quotations, leading represen- tatives of research on Twombly focus on the visual lan- guage and scriptural-imagistic quality of Cy Twombly’s work. Through comprehensive interpretations of famous single works and groups in all the artistic media employed by Twombly, the volume’s cross-disciplinary view opens up a route into the associative-referential visual language of Cy Twombly. THIERRY GREUB (ED.) – CY TWOMBLY MORPHOMATA EDITED BY GÜNTER BLAMBERGER AND DIETRICH BOSCHUNG VOLUME 37 EDITED BY THIERRY GREUB CY TWOMBLY Image, Text, Paratext WILHELM FINK English edition translated from the German original: Cy Twombly. Bild, Text, Paratext (Morphomata, vol. 13). Paderborn 2014 (based on a conference held at the University of Cologne, 13–15 June 2012, by Morphomata International Center for Advanced Studies) Translated by Orla Mulholland, Daniel Mufson, Ehren Fordyce, and Timothy Murray Translated and printed with the generous support of the Cy Twombly Founda tion, Rome / New York and the Fondazione Nicola Del Roscio, Gaeta unter dem Förderkennzeichen 01UK1505. -

The Abuse of Patriarchal Power in Rome: the Rape Narratives of Ovid’S Metamorphoses
The Abuse of Patriarchal Power in Rome: The Rape Narratives of Ovid’s Metamorphoses A Thesis Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Classics By K. Tinkler Classics Department University of Canterbury 2018 Table of Contents Acknowledgements……………………………………………………………………………………………………………. 4 Abstract……………….…………………………………………………………………………………………………………….. 5 Introduction……………………………………………………………………………………………………………………….. 6 CHAPTER ONE: Gender in Rome………………………………………………………………………………………. 12 A Woman’s Place in a Man’s World: Patriarchy in Rome…………………………………………………… 12 Lucretia’s Legacy: The Cultural Template of the Raped Woman……………………………………….. 18 The Intimacy of Rape: The Body of a Woman in Antiquity…………………………………………………. 22 CHAPTER TWO: Rape in the Metamorphoses…………………………………………………………………… 29 The Rape Stories of the Metamorphoses………………………………………………………………………….. 29 The Characteristics of Ovid’s Perpetrators………………………………………………………………………… 30 Gods and Non-Human Perpetrators………………………………………………………………………………….. 34 The Characteristics of Ovid’s Victims…………………………………………………………………………………. 40 The Rape of Philomela………………………………………………………………………………………………………. 44 The Male Gaze………………………………………………………………………………………………………………….. 48 CHAPTER THREE: The Aftermath of Rape…………………………………………………………………………. 55 The Non-Metamorphic Consequences………………………………………………………………………………. 55 The Psychological Effect on the Victim……………………………………………………………………………… 60 The Eternal Link between the Victim and the Rapist…………………………………………………………. 63 The Second Rape: The Goddesses’ Wrath…………………………………………………………………………. -

Divine Riddles: a Sourcebook for Greek and Roman Mythology March, 2014
Divine Riddles: A Sourcebook for Greek and Roman Mythology March, 2014 E. Edward Garvin, Editor What follows is a collection of excerpts from Greek literary sources in translation. The intent is to give students an overview of Greek mythology as expressed by the Greeks themselves. But any such collection is inherently flawed: the process of selection and abridgement produces a falsehood because both the narrative and meta-narrative are destroyed when the continuity of the composition is interrupted. Nevertheless, this seems the most expedient way to expose students to a wide range of primary source information. I have tried to keep my voice out of it as much as possible and will intervene as editor (in this Times New Roman font) only to give background or exegesis to the text. All of the texts in Goudy Old Style are excerpts from Greek or Latin texts (primary sources) that have been translated into English. Ancient Texts In the field of Classics, we refer to texts by Author, name of the book, book number, chapter number and line number.1 Every text, regardless of language, uses the same numbering system. Homer’s Iliad, for example, is divided into 24 books and the lines in each book are numbered. Hesiod’s Theogony is much shorter so no book divisions are necessary but the lines are numbered. Below is an example from Homer’s Iliad, Book One, showing the English translation on the left and the Greek original on the right. When citing this text we might say that Achilles is first mentioned by Homer in Iliad 1.7 (i.7 is also acceptable). -
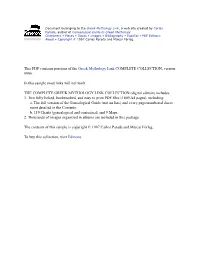
Greek Mythology Link (Complete Collection)
Document belonging to the Greek Mythology Link, a web site created by Carlos Parada, author of Genealogical Guide to Greek Mythology Characters • Places • Topics • Images • Bibliography • Español • PDF Editions About • Copyright © 1997 Carlos Parada and Maicar Förlag. This PDF contains portions of the Greek Mythology Link COMPLETE COLLECTION, version 0906. In this sample most links will not work. THE COMPLETE GREEK MYTHOLOGY LINK COLLECTION (digital edition) includes: 1. Two fully linked, bookmarked, and easy to print PDF files (1809 A4 pages), including: a. The full version of the Genealogical Guide (not on line) and every page-numbered docu- ment detailed in the Contents. b. 119 Charts (genealogical and contextual) and 5 Maps. 2. Thousands of images organized in albums are included in this package. The contents of this sample is copyright © 1997 Carlos Parada and Maicar Förlag. To buy this collection, visit Editions. Greek Mythology Link Contents The Greek Mythology Link is a collection of myths retold by Carlos Parada, author of Genealogical Guide to Greek Mythology, published in 1993 (available at Amazon). The mythical accounts are based exclusively on ancient sources. Address: www.maicar.com About, Email. Copyright © 1997 Carlos Parada and Maicar Förlag. ISBN 978-91-976473-9-7 Contents VIII Divinities 1476 Major Divinities 1477 Page Immortals 1480 I Abbreviations 2 Other deities 1486 II Dictionaries 4 IX Miscellanea Genealogical Guide (6520 entries) 5 Three Main Ancestors 1489 Geographical Reference (1184) 500 Robe & Necklace of -

Part V. Reference Material: Cumulative Bibliography and Indexes
PART V. REFERENCE MATERIAL: CUMULATIVE BIBLIOGRAPHY AND INDEXES CUMULATIVE BIBLIOGRAPHY grabes , Lund: Gleerup . Aaron, David H., 1995, ‘Early rabbinic exegesis on Noah’s son Ham and the so-called ‘‘Hamitic myth’’ ’, Journal of the American Aksu, A.E., Mudie, P.J., Rochon, A., Kaminski, M.A., Abra- Academy of Religion , 63, 4: 721-59. jano, T., & Ya şar, D., 2002, ‘Persistent Holocene out- flow from the Black Sea to the Eastern Mediterranean Abel, F.M., with Mackay, E.J.H., 1923, Hebron - Le Haram el- contradicts Noah’s flood hypothesis’, GSA [Geographic Khalil , Paris: Leroux. Society of America] Today , May 2002, 12, 5: 4-9. Abramova, Z.A., 1997, ‘Mal’ta’, in: Leroi-Gourhan, A., ed., Dic- Akurgal, Ekrem, 1992, ‘L’Art hatti’, in: Otten, Heinrich, tionnaire de la préhistoire , Paris: Presses Universitaires de Ertem, Hayri, Akurgal, Ekrem, & Süel, Aygül, eds, Hit- France, first published 1988, pp. 683-4. tite and other Anatolian and Near Eastern studies in Abu el-Haj, N., 2001, Facts on the ground: Archaeological practice honour of Sedat Alp , Ankara: Türk Tarih Kurumu and territorial self-fashioning in Israeli society , Chicago: Uni- Basımevi, pp. 1-5. versity of Chicago Press. Albright, William Foxwell, 1932, The excavations of Tell Abusch, T., & van der Toorn, K., 1999, eds, Mesopotamian magic: Beit Mirsim in Palestine , I : The pottery of the first three Textual, historical, and interpretative perspectives , Groningen: campaigns , vol. 12, Annual of the American Schools of Styx. Oriental Research , New Haven CT: American Schools of Oriental Research. Achterberg, Winfried, Best, Jan, Enzler, Kees, Rietveld, Lia, & Woudhuizen, Fred, 2004, The Phaistos disc : A Luwian letter to Albright, William Foxwell, 1934, The vocalisation of the Nestor , Publications of the Henri Frankfort Foundation 13, Egyptian syllabic orthography , American Oriental Se- Amsterdam: Dutch Archaeological and Historical Society. -

Mythology Heroes
Mythology Heroes Trojan Warriors Paris Paris was the son of King Priam and Queen Hecuba of Troy, who eloped with Helen, queen of Sparta, thus causing the events that led to the Trojan War. Before he was born, Hecuba saw a dream in which her child was a flaming torch. The explanation to the dream that was given by the seer Aesacus was that the yet unborn child would be the doom of Troy. Aesacus also said on the day of Paris' birth that a child born of royals that day should be killed in order to save the kingdom. However, Priam and Hecuba could not kill their baby son, and instead gave the baby to a herdsman so that he would do the deed. The herdsman, also unable to kill the baby, left him to die on Mount Ida, but the boy was saved by drinking milk from a female bear. When the herdsman returned nine days later, he found the baby still alive and took him back to Troy. While growing up, Paris met the nymph Oenone, and they became lovers; after he left her for Helen, Oenone told him that she would be happy to treat all of his injuries, small or serious, whenever he was wounded. Years later, a magnificent ceremony took place on Mount Olympus for the marriage of Peleus and Thetis. Major and minor deities had been invited, except Eris, the goddess of strife. In retribution, Eris decided to cause havoc, by throwing the Golden Apple of Discord amidst the goddesses, which was inscribed with the words "To the fairest". -

Ferro-Flash-307-Fr
N°307 Octobre, Novembre, Décembre 2020 Ferro-Flash Périodique Trimestriel Photo de couverture : L’autorail série 600 inaugure la gare de la scierie du 3 rails Photo de : G.B. Ne pas jeter sur la voie publique Niet op de openbare weg gooien FSR ASBL Westvaartdijk 57 (au 2ième étage) - 1850 Grimbergen Ferro-Flash 307 INFO : Ferro Schaerbeek Rail Comité : - Président d'honneur Guy Bridoux - Président Daniel Leydens - Trésorier Fabre Quentin - Secrétaire Bettig Benoit Responsables : - Réseau 2 rails Michel Colson - Réseau 3 rails Philippe Deuquet - Locaux et bar Fabre Quentin - Gestion Réseau Fabrice Urbain - Rédaction du Ferro-Flash Quentin Fabre - Traduction du Ferro-Flash Wynton Bindelle - Brems Paul Cotisation : Membre ordinaire : 120 € – Etudiants : 60 € Membre vivant sous le même toit qu'un membre ordinaire : 60 € Membre bienfaiteur : à partir de 150 € Compte bancaire : Code IBAN : BE23 0688 9433 6791 BIC : GKCCBEBB FSR ASBL Av. Rogier 185 1030 Bruxelles Comment nous contacter : Internet : www.club-fsr.be email : [email protected] www.facebook.com/pages/Ferro-Schaerbeek-Rail/683201528424857 FSR ASBL Westvaartdijk 57 (au 2ième étage) - 1850 Grimbergen Réunion Mercredi de 19-22h n° Tél. gsm : 0476 342 0500 50 Le petit mot du … Face à la crise qui persiste, notre premier souci a été de garder le contact entre membres et de rester le plus possible ouvert pour désormais notre unique réunion du mercredi. En insérant deci delà quelques dates clé, nous avons pu ainsi organiser une réunion 2 rails et une réunion 3 rails sous le thème des « autorails et des automotrices ». Ce fût un succès comme en témoigne les photos insérées dans ce numéro.