97-100 Azzola
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Familien Fragebogen
Familien Fragebogen Diese Befragung wird zur Erstellung der ersten Kinder- und Familien-Freizeitkarte für unsere Region am Bayerischen Untermain durchgeführt. Die Ergebnisse kommen als Freizeittipps in den Plan. Bitte die ganze Familie gemeinsam ausfüllen. Wir wohnen in der Stadt/Gemeinde: ____________________________________ 1. Der beste Spielplatz in unserer Gegend (im Ort oder Umgebung) ist… __________________________________________________ (Ort/Ortsteil + Straße) Begründung: _________________________________________________________ Der zweitbeste Spielplatz in unserer Gegend (im Ort oder Umgebung) ist… __________________________________________________ (Ort/Ortsteil + Straße) Begründung: _________________________________________________________ 2. Außer auf offiziellen Spielplätzen spielen wir gerne dort...(Bitte genaue Ortsan- gabe und auf der beigefügten Karte markieren - am besten mit Nummer versehen) Wiese zum Drachensteigen: ____________________________________________ Wiese zum (Ball)spielen: _______________________________________________ Picknick-Wiese: ______________________________________________________ Rodelhang: __________________________________________________________ Wassertreffpunkt (bespielbare Brunnen, Bäche…): ___________________________ ___________________________________________________________________ Skaten: _____________________________________________________________ Spielort im Wald: _____________________________________________________ -

Frankfurtrhinemain in Figures 2019
European Institutions European Central Bank (ECB) European Space Operations Centre (ESOC) European Meteorological Satellite Organisation (EUMETSAT) European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) Tourism in FrankfurtRhineMain No. of hotels and guest houses 2,887 FrankfurtRhineMain No. of beds 165,548 Total guests 12,936,055 Guests from abroad in percent 29.2 % Total overnight stays 26,123,146 Average duration of stay 2.0 days in figures 2019 Figures per: 2017 Transport Infrastructure FrankfurtRhineMain Total of classified roads 11,420 km including Federal highways (Bundesautobahnen) 1,448 km Long distance stations 18 Ports along the rivers Rhine and Main 7 Figures per: 01.01.2018 FrankfurtRhineMain In the RhineMain region 7.9 % of the German gross value is generated. The Hessian part of the region realises Frankfurt International Airport (FRA) a staggering 78 % of the gross domestic product of the federal state of Hessian. These numbers emphasise the status of FrankfurtRhineMain as – according to European standards – one of the most important metropolitan FRA segment within Frankfurt International All German areas of Germany. German airports Airport Airports in percent There is also no lack of international flair: four European institutions are based in the region. More than 2,500 companies from China and the United States alone have settled here. This is not least due to the excellent inf- No. of passengers 64,500,386 27.4 % 235,175,472 rastructure of the region. At 12 international schools, students can obtain an internationally accredited degree. Freight (+Airmail) volume in tons 2,228,969 44.7 % 4,983,656 With over 1,300 flight movements a day, Frankfurt International Airport contributes much to the outstanding accessibility of the metropolitan area for both business travellers and tourists. -

Aschaffenburg Zu Fuß
8 Monika Spatz Aschaffenburg zu Fuß Die schönsten Sehenswürdigkeiten zu Fuß entdecken Die Angaben und Informationen in diesem Buch sind aktuell re- cherchiert und vor Drucklegung sorgfältig überprüft worden. Trotz- dem ist darauf hinzuweisen, dass sich Telefonnummern, Öffnungs- zeiten und andere Angaben im Lauf der Zeit ändern können. Bildnachweis für alle Bilder: Dr. Karl Spatz Seite 2: Das Pompejanum 2., ergänzte und überarbeitete Auflage Alle Rechte vorbehalten • Societäts-Verlag © 2020 Frankfurter Societäts-Medien GmbH Satz: Julia Desch, Societäts-Verlag Umschlaggestaltung: Julia Desch, Societäts-Verlag Umschlagabbildung: Dr. Karl Spatz Karten: Peh & Schefcik Druck und Verarbeitung: CPI books GmbH, Leck Printed in Germany 2020 www.societaets-verlag.de www.facebook.com/societaetsverlag ISBN 978-3-95542-356-8 Inhalt Vorwort ...........................................................................................................7 Kapitel 1 Ein Gang durch die Altstadt ..................... 8 Kapitel 2 Das Grüne Band ...........................................32 Kapitel 3 Wenn alle Brünnlein fließen ................. 48 Kapitel 4 Rund ums Schloss ......................................62 Kapitel 5 Kunst, Kino, Musik und Theater — von allem etwas ............................................. 76 Kapitel 6 Auf verschlungenen Wegen ..................90 Kapitel 7 Kippenburg und Teufelskanzel .........106 Kapitel 8 Steine erzählen Geschichte ..................116 Service .......................................................................................................126 -
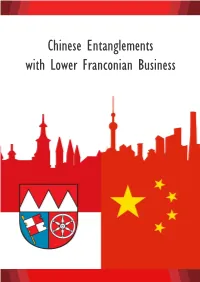
Chinese Entanglements with Lower Franconian Business
Chinese Entanglements with Lower Franconian Business Chinese Entanglements with Lower Franconian Business A Student Research Project by the Chair of China Business and Economics at the University of Würzburg Impressum Project Team Members: Automotive Industry Team Leader: Fabian Schmid Members: Lena Hofmann, Torbjörn Kubsch, Luisa Schneidawind Clothing Industry Team Leader: Filip Wieteska Members: Pascal Bühler, Katherina Ho, Mateja Mogus Food and Beverages Industry Team Leader: Claire Wilson Members: Enarile Angnide, Iryna Bielitska, Andreas Mischer Technology and Machinery Industry Team Leader: Alexander Li Members: Finn Borchert, Simon Lin, Xinyue Chen Tourism and Hospitality Industry Team Leader: Manuela Voss Members: Louisa Braun, Melvin Kebekus, Linda Yu Interviews: with Mr. Eisend: Pascal Bühler with Mr. Göpfert: Enarile Angnide, Claire Wilson with Ms. Geier: Iryna Bielitska, Andreas Mischer with Mr. Rudek: Melvin Kebekus, Linda Yu with Mr. Streck: Pascal Bühler with Ms. Streiffuss, and Mr. Weiler: Melvin Kebekus, Manuela Voss with Mr. Treumann: Mateja Mogus, Filip Wieteska Design and Format: Alexander Li, Manuela Voss Editing: Claire Wilson Cover Page: Filip Wieteska Project Coordination: Jonas Lindner © 2020 Doris Fischer, Chair of China Business and Economics, Julius-Maximillian’s University of Würzburg. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. It was authored by the students of the Master’s program China Business and Economics M.Sc. at the Julius-Maximilians-University -

Landesmuseum Mainz
27_008679 bindex.qxp 10/25/06 1:25 PM Page 675 Index Altes Rathaus (Old City Hall) An der Hauptwache Aachen (Aix-la-Chapelle), Bamberg, 219 (Frankfurt), 464 513–517 Göttingen, 590 Annweiler, 494 Abercrombie & Kent, 55 Hannover, 580 An Sibin (Frankfurt), 472 Above and Beyond Tours, 45 Leipzig, 185 Antik & Flohmarkt (Berlin), 147 Abteikirche St. Maria Lindau, 373 Antikensammlung (Berlin), 120, (Amorbach), 255 Munich, 312 122 Accommodations, 46, 63 Regensburg, 237 Antikensammlungen (Munich), best, 12–14 Altes Residenztheater (Cuvilliés 320 Agfa-Historama (Cologne), 528 Theater; Munich), 318, Antiques Airfares, 46, 51–52 330–331 Bamberg, 220 Airlines, 49–50, 59 Altes Schloss (Meersburg), 8, Berlin, 142–143 bankrupt, 41 380 Bremen, 569 Airport security, 50–51 Altes Schloss and Dresden, 204 Aix-la-Chapelle (Aachen), Württembergisches Düsseldorf, 541 513–517 Landesmuseum (Stuttgart), Hamburg, 617 Alamannen Museum 439–440 Leipzig, 188 (Weingarten), 390 Altes Schloss Eremitage Lübeck, 631 Albertinum (Dresden), 202 (Bayreuth), 215 Munich, 327 Albrecht Dürer House Altmarkt (Dresden), 201 Archäologisches (Nürnberg), 227 Altmühltal Nature Park, 210 Landesmuseum (Schleswig), Albrechtsburg Castle Alt-Sachsenhausen (Frankfurt), 637 (Meissen), 209 468 Architecture, 20–27 Alexanderplatz (Berlin), 130 Altstadt (Old Town) Armory (Dresden), 203 Alf, 548 Düsseldorf, 538–539, 542 Arnstadt, 172 Alpengarten (Alpine Garden; Frankfurt, 464–466 Arsenal (Schwerin), 648 Pforzheim), 412 Goslar, 587 Art, 16–20 Alpspitz, 358–359 Hamburg, 612 Art galleries Alsterpark (Hamburg), -

Ein Schloss Für Die Aschaffenburger
Liebe Bürgerinnen und Bürger, IM DIALOG Kommt der Zeitung der Stadt Aschaffenburg für ihre Bürgerinnen und Bürger Reisende zurück Sonderausgabe · Februar 2014 nach Aschaffen- burg, grüßen ihn schon aus der Ferne die Tür- me von Schloss Johannisburg. Und gleich fühlt er sich angekommen in der Heimat. Das war nicht immer so. Die Älteren unter uns erin- nern sich noch an die Trümmer, die sich nach dem Krieg an der Stelle türmten, an der sich zuvor das stolze Wahrzeichen unserer Stadt erhob. Als das Schloss, von Bomben getrof- fen, in Flammen stand und mit vielen anderen Gebäuden der Stadt in Schutt und Asche sank, da verließ viele Bürger der Mut. Auch wenn es damals viel Kraft gekostet hat in einer Zeit, in der viele Menschen ihr Dach über dem Kopf verloren hatten, war es ein richtiger und weiser Entschluss, das Schloss Stein für Stein wieder aufzu- bauen. Die Aschaffenburger bekamen damit nicht nur ein Stück Heimat zurück, sondern auch die Hoffnung auf ein Le- ben in Frieden und Wohlstand © Bayerische Schlösserverwaltung / in ihrer Stadt. Heute stellt das www.schloesser.bayern.de Schloss Johannisburg wieder ein einzigartiges Kleinod für Aschaffenburg dar. Mit den Kunstwerken, die dort präsen- tiert werden, sowie mit den in Schauräumen und Depots EIN SCHLOSS FÜR DIE vorhandenen Museumsstücken bewahrt das Schloss einen großen Teil des Gedächtnisses ASCHAFFENBURGER der Stadt. So steht es für die lange Geschichte Aschaffen- 400 Jahre: von der Prachtresidenz zum kulturellen Zentrum burgs, baut zugleich die Brü- cke in die Zukunft und ist für die Bürger ein Symbol unserer Statt im Sportunterricht zu turnen, ten. -

MITTEILUNGEN Aus Dem Stadt- Und Stiftsarchiv Aschaffenburg ISS 0174-5328 Bd
MITTEILUNGEN aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg ISS 0174-5328 Bd. 5 0996-1998), Heft 1 März 1996 - ;:·.- -� - - -.=::.-.. §Ei' -:=: n 1 -- -- ,31.3,,,,C"': Haupteingang Schönborner Hof (Zeichnung: Rainer Erzgraber, Aschaffenburg) Inhalt Ulrike Klotz, Streifzug durch 100 Jahre Filmgeschichte . 1 Werner Krämer, Chronik der Aschaffenburg r Kinogeschichte . 15 Hans-Bernd Spies, Burg und Schloß Johannisburg zu Aschaffenburg im Spiegel schriftlicher Quellen . 33 Werner Krämer, Ein Rückblick auf die Bekleidungsindustrie am bayeri schen Untermain . 44 Mitarbeiterverzeichnis Ulrike Klotz, M. A., Hauptstr. 97, 63829 Krombach Werner Krämer, Deutsche Str. 59, 63739 Aschaffenburg Dr. phil. Hans-Bernd Spies, M. A., ·Neubaustr. 27, 63814 Mainaschaff Vorschau auf kommende Hefte: Friedrich Karl Azzola, Das Sprengwerk außen an der Südseite von St. Agatha - eine Stiftung der Aschaffenburger Tuchmacher? - Jakob Jung, Die diplomati schen Verhandlung n in Hanau 1743 - Werner Krämer, Franz Xaver Wüth, Rechnungskommissar am Kg!. Lotto-Oberamte Aschaffenburg - Hans-Bernd Spies, Die ersten Aufführungen von Werken Hindemiths in Aschaffenburg. Gesamtinhaltsverzeichnis und Register zu Band 4 werden mit dem September heft ausgeliefert. Mitteilungen aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg im Auftrag der Stadt Aschaffen burg - Stadt- und Stiftsarchiv - herausgegeben von Hans-Bernd Spies Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg, Wermbachsrraf�e 15, D-63739 Aschaffenburg Gesamtherstellung: Verlagsdruckerei Schmidt Gmbl 1, 91413 Neustadt an der Aisch Streifzug durch 100 Jahre Filmgeschichte von Ulrike Klotz 1995 jährt sich zum hundertsten Mal die Erfindung des Films. Das Ju biläum gibt Anlaß, die Geschichte des jahrhundertprägenden Medi ums aufzurollen. Verschiedene Ausstellungen und Aktivitäten sind bundesweit üb r das ganze Jahr verteilt. Neben der Erforschung der allgemeinen Filmgeschichte wird auch die regionale Filmforschung 1 vorangetrieben. -

Bayerische Verwaltung Der Staatlichen Schlösser, Gärten Und Seen
Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen Schloss Nymphenburg, Eingang 16, D – 80638 München Telefon 089 17908-0; Fax 089 17908-154 E-Mail: [email protected] Internet: www.schloesser.bayern.de Eintrittspreise und Öffnungszeiten 2021 Corona-bedingt können die Öffnungszeiten abweichen. Bitte informieren Sie sich vor einem Besuch auf unserer Internetseite unter www.schloesser.bayern.de über die aktuelle Öffnungssituation. Bitte rechnen Sie in allen Häusern mit Wartezeiten und Einschränkungen wie geänderten Wegeführungen. Ort Besichtigungsobjekt Öffnungszeiten Eintrittspreise (€) regulär ermäßigt Ansbach Residenz Ansbach 29. März-3. Oktober: 9-18 Uhr 5,- 4,- 4. Oktober-28. März: 10-16 Uhr Tel. 0981 953839-0 stündliche Führungen Fax 0981 953839-40 letzte Führung: [email protected] 29. März-3. Oktober: 17 Uhr 4. Oktober-28. März: 15 Uhr Montags geschlossen Aschaffenburg Schloss Johannisburg April-3. Oktober: 9-18 Uhr 6,- 5,- 4. Oktober-März: 10-16 Uhr Tel. 06021 38657-0 Montags geschlossen Fax 06021 38657-16 sgvaschaffenburg@ bsv.bayern.de Reduzierter Eintrittspreis bis zur Wiedereröffnung der 3,50 2,50 Staatsgemäldesammlungen und der Museumsräume Tel. 06021 218012 Pompejanum 27. bis 31. März: 10-16 Uhr 6, 5,- April-3. Oktober: 9-18 Uhr 4. bis 31. Oktober: 10-16 Uhr Nov.-26. März: geschlossen Montags geschlossen Kombikarte „Schloss Johannisburg / Pompejanum“ 9,- 7,- Reduzierter Eintrittspreis bis zur Wiedereröffnung der Staatsgemäldesammlungen und der Museumsräume im Schloss Johannisburg: Kombikarte „Schloss Johannisburg / Pompejanum“ 7,- 5,- Tel. 06021 625478 Gesamtkarte „Schloss Schönbusch mit Besucherzentrum“ 4,- 3,- Schloss Schönbusch Hinweis : Zum Schutz vor COVID-19 muss dieses Objekt bis auf Weiteres geschlossen bleiben (Stand 9/2020). -

Spessart Lustig Ist’S Im Räuberwald!
Schramberger Str. 15 78078 Niedereschach-Fischbach Tel.: 07725 9165-0 Fax: 07725 9165-25 [email protected] Spessart Lustig ist’s im Räuberwald! Mespelbrunn Versteckt in einem verschwiegenen Spessart-Tal liegt das berühmte Wasserschloßes Mespelbrunn. Das Schloss wurde unter anderem als Drehort des Films „Wirtshaus im Spessart“ sowie als Schauplatz für das gleichnamige Theaterstück bekannt. Aufgrund seiner versteckten Lage überstand das Schloss alle Kriege unbeschadet und ist in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben. Miltenberg Miltenberg ist bekannt durch seine romantische Altstadt und zahlreiche kleine Brauereien, die hier köstliche Biere anbieten. Vorschläge zur Programmgestaltung: Schifffahrt auf dem Main Aschaffenburg Das Schloss Johannisburg aus rotem Buntsandstein gehört zu den bedeutendsten und schönsten Renaissance- bauten Deutschlands. Vom Schloss Johannisburg bis zum Rathaus finden sich verwinkelte enge Gassen, in denen sich hübsche kleine Fachwerkhäuser mit urigen Kneipen und Restaurants abwechseln. Zahlreiche gemüt- liche Wein- und Bierstuben bieten sich zur Rast an, darunter der berühmte Brauereiausschank „Schlappeseppel“, dessen Gründung auf den 30-jährigen Krieg zurückreicht. Ein Muss für jeden Biertrinker ! Unser Special: Räuberparty im Spessart Im tiefen Spessart unternehmen Sie eine kleine Wanderung (Waldspaziergang) im dunklen Wald und wenn die Büch- se knallt – dann ist es auch schon zu spät: Räuberüberfall! Auf den Schrecken gibt es einen Spessarträuberschnaps, bevor es in das nahegelegene, urige Waldgasthaus geht. Ein leckerer Spanferkelschmaus mit Klößen und Rotkraut erwartet Sie als Entschädigung für den „schrecklichen“ Räuberüberfall. Schlachtfest Pferdekutschenfahrt zu einer kleinen Brauerei und Besichtigung mit Bierprobe. Anschließend kräftiges, rustikales „Spessartschlachtfest“ mit Schlachtplatte, dazu Bier zum Selberzapfen und einen „Sautropfen“. Gemütliche Stunden mit einem lustigen Musikus schließen sich an. Besuch im Spukschloss 8-gängiges Räubergelage im Gewölbekeller. -
Parks & Gärten in Aschaffenburg
Aschaffenburg Parks & Gärten in Aschaffenburg Schönbusch Schlossgarten Schöntal 2 Aschaffenburgs historischer Grünzug Wie Perlen an einer Kette reihen sich die historischen Parks und Gärten Aschaffenburgs beinahe durchgängig aneinander. Die Grundlage hier- für schuf gegen Ende des 18. Jahrhunderts der Mainzer Erzbischof und Kurfürst Friedrich Carl Joseph von Erthal, dem Aschaffenburg zunächst als Zweit- und schließlich als Hauptresidenz diente. Er engagierte einen der bedeutendsten Gartenkünstler seiner Zeit, Friedrich Ludwig Sckell (1750–1823), dessen Handschrift das grüne Erbe der Stadt maßgeblich trägt. Diese Oasen der Ruhe bieten für Einheimische und Besucher jeder Altersgruppe Refugien für Erholung und Freizeitaktivitäten. Spazier- gänger und Wanderer können abwechslungsreiche Fauna und Flora sowie kulturelle Besonderheiten entdecken. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen zwölf ausgewählte Parks und Gärten vor, ergänzt mit Tipps und Anregungen für Ihren Aufenthalt. Information: Tourist-Information Aschaffenburg Schloßplatz 2, 63739 Aschaffenburg Tel.: 06021-395 800 E-Mail: [email protected] www.info-aschaffenburg.de info-aschaffenburg.de Inhaltsverzeichnis 3 Aschaffenburgs historischer Grünzug S. 02 Inhalt und Impressum S. 03 Nilkheimer Park S. 04 Park Schönbusch S. 05-07 Kleine Schönbuschallee S. 08 Mainufer S. 09 Schlossgarten S. 10-11 Garten am Pompejanum S. 12 Offenes Schöntal S. 13 Park Schöntal S. 14-15 Großmutterwiese S. 16 Grünbrücke S. 17 Fasanerie S. 18 Godelsberg S. 19 Übersichtskarten S. 20-23 Impressum: Herausgeber: Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg Bilder: W. Gulder, A. Heinrichs, T. Benzin, Beyond Five Stars, Garten- und Friedhofsamt der Stadt Aschaffenburg Gestaltung: Beyond Five Stars Angaben ohne Gewähr, Stand: Januar 2020 4 Nilkheimer Park Ursprünglich war der Park ein Obsthain mit den dazugehörenden Wirt- schaftsgebäuden. -

The Charm of the Bavarian Lower Main
// excursions frm SeRieS BAVaRIAN LOWeR MAIN the charm oF the bavarian loweR MaIn high tech and quality oF liFe away FroM the big-city hustle and bustle A castle forms the skyline, in the valley global market leaders produce their goods, a princess enthuses about wind turbines and for the music scene aschaffenburg is a major city. a journey of discovery claus beRninGeR during the afternoon some of the EvenT OrganizeR, coloS-Saal band members head upstairs to the By Barbara Hofmann and Martin Orth, photos: Jonas Ratermann Aschaffenburg performers’ dressing room, while 49°58‘33.10“N the others prepare the sound check. 9°8‘56.54“E Quite casually, wearing a T-shirt, shorts and sandals, claus berninger sits in his office on thest 1 story above the concert hall and tells us Alzenau Mömbris about his job. he has been manag- ing the club for 27 years. 25 events The Bavarian Lower Main is a real are the frontrunners in FrankfurtRhineMain: years ago. Around 800 years as part of the take place here each month – from Rock, Pop and Jazz to heavy Metal insider tip. Numerous national and Germany’s first music school was established in former Electorate and Archbishopric of Mainz and hip hop. For him that means Aschaffenburg >international studies have shown that the region Aschaffenburg in 1810. have left lasting marks on the area. a 70 to 80-hour week, starting at 6 a.m. every day. This has nothing in offers top quality of life, opportunities for the common with the classic sex, drugs Großwallstadt future and development potential. -
Parks & Gärten in Aschaffenburg
Aschaffenburg Parks & Gärten in Aschaffenburg Schönbusch Schlossgarten Schöntal 2 Aschaffenburgs historischer Grünzug Inhaltsverzeichnis 3 Wie Perlen an einer Kette reihen sich die historischen Parks und Gär- Aschaffenburgs historischer Grünzug S. 02 ten Aschaffenburgs beinahe durchgängig aneinander. Die Grund- Inhalt und Impressum S. 03 lage hierfür schuf gegen Ende des 18. Jahrhunderts der Mainzer Nilkheimer Park S. 04 Erzbischof und Kurfürst Friedrich Carl Joseph von Erthal, dem Park Schönbusch S. 05-07 Aschaffenburg zunächst als Zweit- und schließlich als Hauptresi- Kleine Schönbuschallee S. 08 denz diente. Er engagierte einen der bedeutendsten Gartenkünstler Mainufer S. 09 seiner Zeit, Friedrich Ludwig Sckell (1750–1823), dessen Handschrift Schlossgarten S. 10-11 das grüne Erbe der Stadt maßgeblich trägt. Diese Oasen der Ruhe Garten am Pompejanum S. 12 bieten für Einheimische und Besucher jeder Altersgruppe Refugien Offenes Schöntal S. 13 für Erholung und Freizeitaktivitäten. Spaziergänger und Wanderer Park Schöntal S. 14-15 können abwechslungsreiche Fauna und Flora sowie kulturelle Be- Großmutterwiese S. 16 sonderheiten entdecken. Grünbrücke S. 17 Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen zwölf ausgewählte Fasanerie S. 18 Parks und Gärten vor, ergänzt mit Tipps und Anregungen für Ihren Godelsberg S. 19 Aufenthalt. Übersichtskarten S. 20-23 Information: Impressum: Tourist-Information Aschaffenburg Herausgeber: Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg Schloßplatz 2, 63739 Aschaffenburg Bilder: W. Gulder, A. Heinrichs, T. Benzin, Beyond Five Stars, Garten- und Tel.: 06021-395 800 Friedhofsamt der Stadt Aschaffenburg E-Mail: [email protected] Gestaltung: Beyond Five Stars www.info-aschaffenburg.de info-aschaffenburg.de Angaben ohne Gewähr, Stand: Februar 2016 4 Nilkheimer Park Park Schönbusch 5 Ursprünglich war der Park ein Obsthain mit den dazugehörenden Ab 1775 wurde der einstige kurfürstliche Wildpark auf Anlass des Wirtschaftsgebäuden.