Landesausstellung 2020 Leitfaden.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

'Europe First' Strategy, 1940-1941
Why ‘Europe First’? The Cultural, Economic and Ideological Underpinnings of America’s ‘Europe First’ Strategy, 1940-1941 “That those threats to the American way of life and to the interests of the United States in Europe, Latin America and the Far East – against which threats the huge new defence program of this country is directed – all stem, in the last analysis from the power of Nazi Germany.”1 “The Atlantic world, unless it destroys itself, will remain infinitely superior in vigor and inventive power to the too prolific and not too well-nourished Orientals.”2 “Since Germany is the predominant member of the Axis Powers, the Atlantic and European area is considered to be the decisive theatre. The principal United States Military effort will be exerted in that theatre.”3 Nearly seventy years have passed since the Roosevelt administration tacitly accepted the 'Europe First' policy as the controlling element of American grand strategy in the Second World War. Three generations of historians have traced the genesis and evolution of “the most important strategic concept of the war”.4 Most of the scholarship centres on how the official documents and reports shaped American strategic policy. We know that American war planning began before the US was actively engaged in battle and that the Navy had a prominent voice in matters of strategy. We know that President Franklin D. Roosevelt stayed aloof from the hypothetical discussions of his military 1 Resolution of the Miller Group at the Century Club in New York City on 11 July 1940. As quoted in Walter Johnson, The Battle Against Isolation, (Chicago: University of Chicago Press, 1944), pp. -
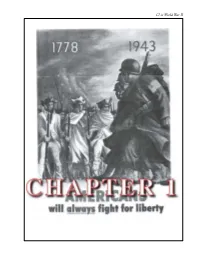
A Counterintelligence Reader, Volume 2 Chapter 1, CI in World
CI in World War II 113 CHAPTER 1 Counterintelligence In World War II Introduction President Franklin Roosevelts confidential directive, issued on 26 June 1939, established lines of responsibility for domestic counterintelligence, but failed to clearly define areas of accountability for overseas counterintelligence operations" The pressing need for a decision in this field grew more evident in the early months of 1940" This resulted in consultations between the President, FBI Director J" Edgar Hoover, Director of Army Intelligence Sherman Miles, Director of Naval Intelligence Rear Admiral W"S" Anderson, and Assistant Secretary of State Adolf A" Berle" Following these discussions, Berle issued a report, which expressed the Presidents wish that the FBI assume the responsibility for foreign intelligence matters in the Western Hemisphere, with the existing military and naval intelligence branches covering the rest of the world as the necessity arose" With this decision of authority, the three agencies worked out the details of an agreement, which, roughly, charged the Navy with the responsibility for intelligence coverage in the Pacific" The Army was entrusted with the coverage in Europe, Africa, and the Canal Zone" The FBI was given the responsibility for the Western Hemisphere, including Canada and Central and South America, except Panama" The meetings in this formative period led to a proposal for the organization within the FBI of a Special Intelligence Service (SIS) for overseas operations" Agreement was reached that the SIS would act -

Miles-Cameron Families Correspondence [Finding Aid
Miles-Cameron Families Correspondence A Finding Aid to the Collection in the Library of Congress Prepared by Manuscript Division Staff Revised by Michelle Krowl with the assistance of Jewel McPherson Manuscript Division, Library of Congress Washington, D.C. 2012 Contact information: http://hdl.loc.gov/loc.mss/mss.contact Finding aid encoded by Library of Congress Manuscript Division, 2012 Finding aid URL: http://hdl.loc.gov/loc.mss/eadmss.ms012059 Collection Summary Title: Miles-Cameron Families Correspondence Span Dates: 1661-1956 Bulk Dates: (bulk 1862-1944) ID No.: MSS32870 Creator: Miles, Nelson Appleton, 1839-1925 Extent: 1,000 items; 9 containers; 3.6 linear feet Language: Collection material in English, with some French and Spanish. Repository: Manuscript Division, Library of Congress, Washington, D.C. Abstract: Army officer. Correspondence addressed to Elizabeth Cameron, J. D. Cameron, Nelson Appleton Miles, and Sherman Miles Selected Search Terms The following terms have been used to index the description of this collection in the Library's online catalog. They are grouped by name of person or organization, by subject or location, and by occupation and listed alphabetically therein. People Buffalo Bill, 1846-1917--Correspondence. Cameron family--Correspondence. Cameron family. Cameron, Elizabeth, 1857-1944--Correspondence. Cameron, J. D. (James Donald), 1833-1918--Correspondence. Cameron, Simon, 1799-1889--Correspondence. Miles family--Correspondence. Miles family. Miles, Nelson Appleton, 1839-1925--Correspondence. Miles, Nelson Appleton, 1839-1925. Miles, Sherman, 1882-1966--Correspondence. Miles, Yulee Noble, 1888-1953--Correspondence. Roosevelt, Theodore, 1858-1919--Correspondence. Sherman family--Correspondence. Sherman, John, 1823-1900--Correspondence. Sherman, William T. (William Tecumseh), 1820-1891--Correspondence. -
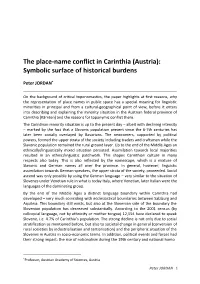
The Place-Name Conflict in Carinthia (Austria): Symbolic Surface of Historical Burdens
The place-name conflict in Carinthia (Austria): Symbolic surface of historical burdens Peter JORDAN* On the background of critical toponomastics, the paper highlights at first reasons, why the representation of place names in public space has a special meaning for linguistic minorities in principal and from a cultural-geographical point of view, before it enters into describing and explaining the minority situation in the Austrian federal province of Carinthia [Kärnten] and the reasons for toponymic conflict there. The Carinthian minority situation is up to the present day – albeit with declining intensity – marked by the fact that a Slavonic population present since the 6-7th centuries has later been socially overlayed by Bavarians. The newcomers, supported by political powers, formed the upper strata of the society including traders and craftsmen while the Slavonic population remained the rural ground layer. Up to the end of the Middle Ages an ethnically/linguistically mixed situation persisted. Assimilation towards local majorities resulted in an ethnic/linguistic patchwork. This shapes Carinthian culture in many respects also today. This is also reflected by the namescape, which is a mixture of Slavonic and German names all over the province. In general, however, linguistic assimilation towards German-speakers, the upper strata of the society, proceeded. Social ascend was only possible by using the German language – very similar to the situation of Slovenes under Venetian rule in what is today Italy, where Venetian, later Italian were the languages of the dominating group. By the end of the Middle Ages a distinct language boundary within Carinthia had developed – very much coinciding with ecclesiastical boundaries between Salzburg and Aquileia. -

The First Americans the 1941 US Codebreaking Mission to Bletchley Park
United States Cryptologic History The First Americans The 1941 US Codebreaking Mission to Bletchley Park Special series | Volume 12 | 2016 Center for Cryptologic History David J. Sherman is Associate Director for Policy and Records at the National Security Agency. A graduate of Duke University, he holds a doctorate in Slavic Studies from Cornell University, where he taught for three years. He also is a graduate of the CAPSTONE General/Flag Officer Course at the National Defense University, the Intelligence Community Senior Leadership Program, and the Alexander S. Pushkin Institute of the Russian Language in Moscow. He has served as Associate Dean for Academic Programs at the National War College and while there taught courses on strategy, inter- national relations, and intelligence. Among his other government assignments include ones as NSA’s representative to the Office of the Secretary of Defense, as Director for Intelligence Programs at the National Security Council, and on the staff of the National Economic Council. This publication presents a historical perspective for informational and educational purposes, is the result of independent research, and does not necessarily reflect a position of NSA/CSS or any other US government entity. This publication is distributed free by the National Security Agency. If you would like additional copies, please email [email protected] or write to: Center for Cryptologic History National Security Agency 9800 Savage Road, Suite 6886 Fort George G. Meade, MD 20755 Cover: (Top) Navy Department building, with Washington Monument in center distance, 1918 or 1919; (bottom) Bletchley Park mansion, headquarters of UK codebreaking, 1939 UNITED STATES CRYPTOLOGIC HISTORY The First Americans The 1941 US Codebreaking Mission to Bletchley Park David Sherman National Security Agency Center for Cryptologic History 2016 Second Printing Contents Foreword ................................................................................ -

ONOMÀSTICA Anuari De La Societat D’Onomàstica
ONOMÀSTICA Anuari de la Societat d’Onomàstica 3 | 2017 Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica Germà Colón (Inst. d’Estudis Catalans) és una publicació electrònica d’accés lliure Jordi Cors (Univ. Autònoma de Barcelona) i de periodicitat anual dedicada a l’estudi dels noms, Jordi Costa (Univ. de Perpinyà / Inst. d’Estudis Catalans) en el sentit més ampli de l’expressió, editada Jean-Paul Escudero (Soc. d’Onomàstica) per la Societat d’Onomàstica. Oliviu Felecan (Technical Univ. of Cluj-Napoca / North Univ. Centre of Baia Mare) Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica Yaïves Ferland (Univ. Laval. Québec) is a yearly academic e-journal dedicated to the Joan Ferrer (Univ. de Girona) study of names in the broadest sense of the term. Franco Finco (Univ. di Udine / Agenzia Regionale per la It is published by the Societat d’Onomàstica. Lingua Friulana) Roberto Fontanot (Euskal Herriko Unibertsitatea) issn 2462-3563 Artur Galkowski (Univ. of Lodz) http://www.onomastica.cat/anuari-onomastica/ Xosé Lluis García (Academia de la Llingua Asturiana) Jean Germain (Commission Royale de Toponymie et de EDITOR CONVIDAT / GUEST EDITOR Dialectologie. Bruxelles) Peter Jordan (Österreichische Akademie der Jordi Ginebra (Univ. Rovira i Virgili) Wissenschaften) M. Dolores Gordón (Univ. de Sevilla) Mikel Gorrotxategi (Euskaltzaindia) DIRECTOR Joseph Gulsoy (Univ. of Toronto) Joan Tort (Univ. de Barcelona) Isolde Hausner (Österreichische Akademie der Wissenschaften) CONSELL EDITOR Milan Harvalík (Inst. of the Czech Language) Anna-Maria Corredor (Univ. de Girona) Nobuhle Hlongwa (Univ. of Kwazulu-Natal) José Enrique Gargallo (Univ. de Barcelona) Carole Hough (Univ. of Glasgow) Joan Ivars (Univ. Nacional de Educación a Distancia) Peter Jordan (Österreichische Akademie der Pere Navarro (Univ. -

Povezave Med Poročili Milesove Misije in Odločitvijo Mirovne Konference V Parizu Za Plebiscit Na Koroškem Leta 1919
Prispevki za novejšo zgodovino XLV - 1/2005 1 1.01 UDK 341.223(436.5)"1920" Prejeto 29. 3. 2005 Tom Priestly" Povezave med poročili Milesove misije in odločitvijo mirovne konference v Parizu za plebiscit na Koroškem leta 1919. Kakšen dokaz so poročila sama? IZVLEČEK Na osnovi jezikovne analize dvanajstih dokumentov, pomembnejših pisnih virov, ki so obravnavali oziroma prikazovali razmere na Koroškem in so pomenili osnovo za odločitev ZDA na mirovni konferenci po prvi svetovni vojni glede meje med Avstrijo in jugoslovansko državo ter glede ozemlja, na katerem je bil izveden oktobra 1920 plebiscit, prikazuje avtor bistvene poudarke, ki so bili za te odločitve odločilni. Predstavlja kakšna sporočila so imela poročila; ali so bili v njih poudarki na ozemeljskih (zemljepisnih) ali nacionalnih (narod nostnih) dejavnikih - na ozemeljski celovitosti Koroške ali na narodnostni sestavi njenega prebivalstva. Predstavi tudi poglede avstrijskega in slovenskega zgodovinopisja do ozemelj skega in narodnostnega dejavnika v -problematiki odločitve za Koroško leta 1920. Ključne besede: Avstrija, Kraljevina SHS, Koroška, plebicit, ZDA, mirovna konferenca 1919, Sherman Miles ABSTRACT ON THE LINK BETWEEN THE MILES MISSION REPORTS AND THE 1919 PLEBISCITE DECISION IN PARIS: WHAT IS THE EVIDENCE OF THE REPORTS THEMSELVES? On the basis of a linguistic analysis of twelve documents of American origin, dealing with the situation in Carinthia, on which, at a peace conference after the First World War, the US based its decision on the determation of the border between Austria and the Yugoslav state, as well as the areas in which a plebiscite was to be carried out in October 1920, the author presents the emphases which were decisive in the taking of these decisions. -

Peter Gstettner (Klagenfurt) „...Wo Alle Macht Vom Volk Ausgeht“
Zur Mikropolitik rund um den „Ortstafelsturm“ in Kärnten 81 Peter Gstettner (Klagenfurt) „...wo alle Macht vom Volk ausgeht“. Eine nachhaltige Verhinderung. Zur Mikropolitik rund um den „Ortstafelsturm“ in Kärnten. Im Herbst 1972 erschütterte der „Ortstafelsturm“ die politische Landschaft Österreichs. Anlass war die Aufstellung deutsch- und slowenischsprachiger Ortstafeln in Südkärnten. Zuvor war im Wiener Parla- ment mit Stimmenmehrheit der sozialdemokratischen Partei ein Gesetz über die topografischen Auf- schriften beschlossen worden. In Kärnten gingen radikale deutschnationale „Heimatschützer“ auf die Straße, um die aufgestellten zweisprachigen Ortstafeln gewaltsam zu entfernen. Ein Großaufgebot von Gendarmerie konnte gerade noch verhindern, dass es zu größeren Ausschreitungen kam. Der Terror der Straße endete erst, als die Regierung bereit war, auf die Neuaufstellung der Ortstafeln zu verzichten und eine Novellierung des Gesetzes vorzunehmen. Eine konkrete Analyse des Geschehens, die hier erstmals anhand von Archiv- und Aktenmaterial durchgeführt wird, kann zeigen, wie minderheitenfeindliche Agi- tation das staatliche Handeln bis zur Einschränkung von demokratischen Rechten deformieren kann. Dies erklärt auch, weshalb der Staatsvertrag von 1955 in Kärnten bis heute nicht voll erfüllt ist. Keywords: Kärnten, Ortstafelsturm, Minderheitenpolitik, Minderheitenrechte Carinthia, place-name sign storm, minority policies, minority rights Auf dem Rücken der Minderheit: das durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Ortstafel-Nullsummenspiel -

Diplomarbeit
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht“ Was macht Journalismus aus politischen Strategien – eine Analyse am Beispiel der Auseinandersetzung zwischen der Kärntner Politik und dem slowenischen Interessensvertreter Rudi Vouk zur Durchsetzung der zweisprachigen Ortstafelfrage Verfasserin Sabina Zwitter-Grilc angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2009 Studienkennzahl lt. Studienbuchblatt: A 301/295 Studienrichtung lt. Studienbuchblatt: Publizistik- und Kommunikationswiss./ Gewählte Fächer statt 2. Studienrichtg. Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Friedrich Hausjell VORWORT ................................................................................................6 1. EINLEITUNG .........................................................................................9 2. DAS ERKENNTNISINTERESSE ......................................................... 10 2.1. Die Forschungsfragen ...................................................................................................... 10 2.2. Das theoretische Fundament.......................................................................................... 11 2.2.1. Die Kommunikationstheorien ...................................................................................... 11 2.2.2. Die analytischen Kategorien von Menz, Lalouschek und Dressler........................ 14 2.3. Narration, Dekonstruktion und Ethnisierung -

Hans Sima: Ein Politisches Leben
Hans Sima: Ein politisches Leben Kärntner Landeshauptmann 1965-1974 Bearbeitet von Petra Mayrhofer 1. Auflage 2015. Buch. 306 S. Hardcover ISBN 978 3 205 79659 6 Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm Gewicht: 666 g Weitere Fachgebiete > Geschichte > Geschichtswissenschaft Allgemein > Biographien & Autobiographien: Historisch, Politisch, Militärisch Zu Inhaltsverzeichnis schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte. Petra Mayrhofer Hans Sima: Ein politisches Leben Kärntner Landeshauptmann (1965–1974) 2015 Böhlau Verlag Wien Köln Weimar Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Umschlagabbildung: Nachlass Sima/Schmölzer © 2015 by Böhlau Verlag Ges.m.b.H & Co. KG, Wien Köln Weimar Wiesingerstraße 1, A-1010 Wien, www.boehlau-verlag.com Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig. Korrektorat: Philipp Rissel, Wien Umschlaggestaltung: Michael Haderer, Wien Satz: Michael Rauscher, Wien Druck und Bindung: Theiss, St. Stefan im Lavanttal Gedruckt auf chlor- und säurefrei gebleichtem Papier Printed in the EU ISBN 978-3-205-79659-6 Inhalt Vorwort (Bundespräsident Dr. Heinz Fischer) .............. 7 Zum Geleit (Mag. Ulli Sima) ....................... 11 Hans Sima – Einleitende Bemerkungen (Univ.-Prof. DDr. Oliver Rathkolb) ................... 13 Vorbemerkung ............................... 15 Einleitung ................................. 21 1. -

Total Control
on la Dichiarazione di Mosca (30 ottobre 1943) gli alleati sostennero uf- Luca Lecis ficialmente l’idea dell’Austria prima vittima dell’aggressione hitleriana e Cannunciarono di voler ricostituire, alla fine della guerra, un’Austria libera e indipendente. Fu questo un passaggio fondamentale perché, da una parte rico- nobbe al paese danubiano un ruolo peculiare durante il conflitto, garantendoli nel dopoguerra un destino profondamente diverso da quello della Germania, dall’altra rese possibile la rinascita dei partiti e la ricostruzione delle strutture democratiche. Ciò fu possibile grazie alla teoria di paese vittima (Opferthese), che permise alle forze politiche (ÖVP, SPÖ, KPÖ) piena legittimità e autori- tà, anche se cancellò con un colpo di spugna le responsabilità austriache nella guerra. L’occupazione dell’Austria da parte delle potenze vincitrici, la specificità all’indipendenza Dal “total control” della realtà politica determinatasi nel paese dopo il 1945, con la realizzazione di uno stabile partenariato politico-sociale tra popolari e socialisti, unitamente alla collocazione politico-ideologica della “questione austriaca”, ossia la firma del Trattato di stato per il ripristino della completa sovranità, nel più ampio contesto della guerra fredda, resero l’Austria un unicum nella realtà europea del dopoguerra. La complessità della questione austriaca si inserì nelle dinamiche di potere e di equilibrio internazionale delle potenze vincitrici, portando inevitabil- mente i negoziati sul Trattato di stato a protrarsi fino al 1955, poiché -

Am Rande Des Bürgerkrieges
Hellwig Valentin AM RANDE DES BÜRGERKRIEGES Der Kärntner Ortstafelkonflikt 1972 und der Sturz Hans Simas Hellwig Valentin: Am Rande des Bürgerkrieges. Der Kärntner Ortstafelkonflikt 1972 und der Sturz Hans Simas Lektorat: Christina Halfmann Umschlaggestaltung: ilab.at Coverfoto: Am 29. Oktober 1972 wurden Landeshauptmann Hans Sima und seine Gat- tin in Völkermarkt von Ortstafelgegnern mit Eiern und Tomaten beworfen. Das Bild mit den lächelnden Gendarmeriebeamten ging um die Welt. (Foto: Verlag Hermago- ras/Mohorjeva, H. G. Trenkwalder). © 2013 Verlag Hermagoras / Mohorjeva založba, Klagenfurt / Celovec – Ljublja- na / Laibach – Wien / Dunaj Gesamtherstellung: Hermagoras Verein / Mohorjeva družba, Klagenfurt / Celo- vec Gedruckt mit Unterstützung des Landes Kärnten und des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur ISBN 978-3-7086-0750-4 Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................................... 9 Geleitwort von Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser ................................................... 11 Vorwort ...................................................................................................................................................... 13 I. Die Kärntner Frage ..................................................................................................................... 15 II. Ein unaufhaltsamer Aufstieg ............................................................................................ 25 1. Schwere