Escape – Identität Im Cyberspace
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Abandoned Child in Contemporary German
THE ABANDONED CHILD IN CONTEMPORARY GERMAN LITERATURE AND FILM by Heidrun Jadwiga Kubiessa Tokarz A dissertation submitted to the faculty of The University of Utah in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Languages and Literature The University of Utah August 2016 Copyright © Heidrun Jadwiga Kubiessa Tokarz 2016 All Rights Reserved The University of Utah Graduate School STATEMENT OF DISSERTATION APPROVAL The dissertation of Heidrun Jadwiga Kubiessa Tokarz has been approved by the following supervisory committee members: Katharina Gerstenberger , Chair 02/18/2016 Date Approved Joseph Metz , Member 02/18/2016 Date Approved Karin Baumgartner , Member 02/18/2016 Date Approved Esther Rashkin , Member 02/18/2016 Date Approved Maeera Shreiber , Member 02/18/2016 Date Approved and by Katharina Gerstenberger , Chair/Dean of the Department/College/School of Languages and Literature and by David B. Kieda, Dean of The Graduate School. ABSTRACT This dissertation examines the motif of the abandoned child as a symptom of postwar German memory culture in German literature and film from the late 1980s to the second decade of the 21st century. As part of German postwar memory culture, the abandoned child motif emerged in the early postwar years and established itself in German memory discourse as Kriegskind (war baby), while representing certain war- related experiences of victimization. This study focuses on the change the motif reflects against the backdrop of Germany’s unification, the surge toward normalization, and globalization. The abandoned child motif in German cultural texts at the end of the 20th and at the beginning of the 21st century is a threshold figure which is symptomatic of the past as well as the present, of the victim and the perpetrator, and of suffering as well as guilt. -
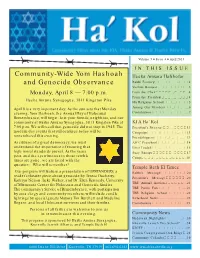
Community-Wide Yom Hashoah and Genocide Observance
Volume 5 ♦ Issue 4 ♦ April 2013 I N T H I S I S S U E Community-Wide Yom Hashoah Heska Amuna HaShofar and Genocide Observance Rabbi Ferency .. 2 Vashti’s Banquet... ...3 Monday, April 8 — 7:00 p.m. From the Chair ... .. ...4 From the President ... .. 4 Heska Amuna Synagogue, 3811 Kingston Pike HA Religious School ... 5 April 8 is a very important day. As the sun sets that Monday Among Our Members ... ....6 evening, Yom Hashoah, the Annual Day of Holocaust Contributions . ....7 Remembrance, will begin. Join your friends, neighbors, and our community at Heska Amuna Synagogue, 3811 Kingston Pike at KJA Ha’ Kol 7:00 p.m. We will recall that genocide did not stop in 1945. The President’s Message ..... 13 modern day events that still continue today will be Campaign .... 13 remembered this evening. Friendshippers .. .. ... 13 As citizens of a great democracy, we must AJCC Preschool .. .. .... 14 understand the importance of ensuring that B’nai Tzedek ... 15 high moral standards prevail. As the years Suzy Snoops .. 17 pass, and the eyewitnesses to those terrible Camp .. .18 times are gone...we are faced with the question: Who will remember? Temple Beth El Times Our program will feature a presentation of UPSTANDERS, a Rabbi’s Message .. .. 20 reader’s theater piece about genocide by Teresa Docherty, President’s Message ..20 Kathryn Nelson, Luke Walker, and Dr. Ellen Kennedy, University of Minnesota Center for Holocaust and Genocide Studies. TBE Annual Auction ...21 The community’s Service of Remembrance, with participation TBE Purim Fun .. .....21 by area clergy and community members, will include candle TBE Religious School . -

College Student Is Killed in Pickup Crash Pital but Was Expected to Be Released Shortly
www.nj.com/r*cordpr«ss Serving Westfield, Scotch Plains and Fanwood Friday, March 17, 2006 50 cents College student is killed in pickup crash pital but was expected to be released shortly. THE RECORD-PRESS Vehicle struck a tree on Martine extension The driver of the car that collided with Hamilton's was not injured. Thnt vehicle .sus- SCOTCH PLAINS —A 21-yearotd Clark lane on the Martine Avenue extension when A 2002 graduate of the Arthur L. Johnson tained minor damage, said Donnelly. resident, Mark Costa, was killed in a car his car sideswiped a car going in the opposite High School in Clark, where he was an honor Donnelly said he could not recall other crash over the weekend on the Martine direction, said Donnelly Police are still inves- student, class president and member of the fatal car accidents On thnt area of the Martini; Avenue extension. tigating whose car swerved into the other track and field and swimming teams, Costa Avenue extension in recent years, and he said The driver and other passenger were not lane, but Donnelly said "we're leaning toward was a junior at Montclair State University. the road is not more dangerous than other seriously injured, according to Lt. Brian the victim's car moving slightly into the He lived in Clark for 17 years after spending roads in Scotch Plains. Donnelly. north-bound lane. his early childhood in Elizabeth. "We do have speeders then1 because it The accident occurred at 11:55 a,m. Hamilton's car then veered into-the right Hamilton and Branham were transported opens up to a four-lane highway," he said, but Saturday when an extended-cab Dodge pick- south-bound lane, went over the curb and nit to Robert Wood Johnson Hospital in New added there is no indication at this jxnnt that up truck driven by Edward Hamilton, a 21- the tree, said Donnelly. -

Mud Connector
Archive-name: mudlist.doc /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ /_/_/_/_/ THE /_/_/_/_/ /_/_/ MUD CONNECTOR /_/_/ /_/_/_/_/ MUD LIST /_/_/_/_/ /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ o=======================================================================o The Mud Connector is (c) copyright (1994 - 96) by Andrew Cowan, an associate of GlobalMedia Design Inc. This mudlist may be reprinted as long as 1) it appears in its entirety, you may not strip out bits and pieces 2) the entire header appears with the list intact. Many thanks go out to the mud administrators who helped to make this list possible, without them there is little chance this list would exist! o=======================================================================o This list is presented strictly in alphabetical order. Each mud listing contains: The mud name, The code base used, the telnet address of the mud (unless circumstances prevent this), the homepage url (if a homepage exists) and a description submitted by a member of the mud's administration or a person approved to make the submission. All listings derived from the Mud Connector WWW site http://www.mudconnect.com/ You can contact the Mud Connector staff at [email protected]. [NOTE: This list was computer-generated, Please report bugs/typos] o=======================================================================o Last Updated: June 8th, 1997 TOTAL MUDS LISTED: 808 o=======================================================================o o=======================================================================o Muds Beginning With: A o=======================================================================o Mud : Aacena: The Fatal Promise Code Base : Envy 2.0 Telnet : mud.usacomputers.com 6969 [204.215.32.27] WWW : None Description : Aacena: The Fatal Promise: Come here if you like: Clan Wars, PKilling, Role Playing, Friendly but Fair Imms, in depth quests, Colour, Multiclassing*, Original Areas*, Tweaked up code, and MORE! *On the way in The Fatal Promise is a small mud but is growing in size and player base. -

ID Title Exhibitor Likes 1 1731 Hallertau Lookout
# ID Title Exhibitor Likes 1 1731 Hallertau Lookout 533 2 464755 ANNO 1800 KOSMOS 514 3 551661 Bonfire Pegasus Spiele 514 4 195845 Pandemic Legacy: Season 0 Z-Man 504 5 426637 Lost Ruins of Arnak Czech Games Edition 502 6 656063 Wingspan- Ozenaniea Expansion Feuerland Spiele 488 7 179749 Paleo Hans im Glück Verlags-GmbH 472 8 507611 7 Wonders Duel expansion Agora Repos Production 462 9 559905 Die verlorenen Ruinen von Arnak HeidelBÄR Games GmbH 416 10 476821 PRAGA Caput Regni Delicious Games 398 11 647611 MicroMacro: Crime City Pegasus Spiele 385 12 494121 CloudAge (German version) dlp games Verlag GmbH 383 13 91292 Gloomhave Jaws of the Lion Feuerland Spiele 363 14 146752 Bonfire Hall Games 362 15 899958 Paris Game Brewer 355 16 913361 Fantasy Realms (German Version) Strohmann Games 326 17 564557 Aeon's End Pegasus Spiele 310 18 731141 New York Zoo Feuerland Spiele 301 19 20988 Der Kartograph: Neue Entdeckungen Pegasus Spiele 290 20 797499 The Castles of Tuscany Ravensburger / alea 284 21 529294 Hallertau (Lookout Games) ASS Altenburger 282 22 621926 Die Insel der Katzen Skellig Games 278 23 846600 Monasterium dlp games Verlag GmbH 272 24 890297 Calico Alderac Entertainment Group 270 25 327886 The Quacks of Quedlinburg – The Alchemists – 2nd extension Schmidt Spiele GmbH 269 26 948106 CloudAge (English version) dlp games Verlag GmbH 262 27 221827 PARKS Feuerland Spiele 254 28 631223 Mariposas Alderac Entertainment Group 253 29 944589 The Red Cathedral Devir 251 30 341629 Rajas of the Ganges - The Dice Charmers HUCH! 236 31 908540 Under -

Franz Kafka's
Kafka and the Universal Interdisciplinary German Cultural Studies Edited by Irene Kacandes Volume 21 Kafka and the Universal Edited by Arthur Cools and Vivian Liska An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. ISBN 978-3-11-045532-8 e-ISBN (PDF) 978-3-11-045811-4 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-045743-8 ISSN 1861-8030 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2016 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Cover image: Franz Kafka, 1917. © akg-images / Archiv K. Wagenbach Printing and binding: CPI books GmbH, Leck ♾ Printed on acid-free paper Printed in Germany www.degruyter.com Table of Contents Arthur Cools and Vivian Liska Kafka and the Universal: Introduction 1 Section 1: The Ambiguity of the Singular Stanley Corngold The Singular Accident in a Universe of Risk: An Approach to Kafka and the Paradox of the Universal 13 Brendan Moran Philosophy and Ambiguity in Benjamin’s Kafka 43 Søren Rosendal The Logic of the “Swamp World”: Hegel with Kafka on the Contradiction of Freedom 66 Arnaud Villani The Necessary Revision of the Concept of the Universal: Kafka’s “Singularity” 90 Section 2: Before the Law Eli Schonfeld Am-ha’aretz: The Law of the Singular. -

1540355802564.Pdf
OCTOBER 23rd 2018 Attention PDF authors and publishers: Da Archive runs on your tolerance. If you want your product removed from this list, just tell us and it will not be included. This is a compilation of pdf share threads since 2015 and the rpg generals threads. Some things are from even earlier, like Lotsastuff’s collection. Thanks Lotsastuff, your pdf was inspirational. And all the Awesome Pioneer Dudes who built the foundations. Many of their names are still in the Big Collections A THOUSAND THANK YOUS to the Anon Brigade, who do all the digging, loading, and posting. Especially those elite commandos, the Nametag Legionaires, who selflessly achieve the improbable. - - - - - - - – - - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - – The New Big Dog on the Block is Da Curated Archive. It probably has what you are looking for, so you might want to look there first. - - - - - - - – - - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - – Don't think of this as a library index, think of it as Portobello Road in London, filled with bookstores and little street market booths and you have to talk to each shopkeeper. It has been cleaned up some, labeled poorly, and shuffled about a little to perhaps be more useful. There are links to ~16,000 pdfs. Don't be intimidated, some are duplicates. Go get a coffee and browse. Some links are encoded without a hyperlink to restrict spiderbot activity. You will have to complete the link. Sorry for the inconvenience. Others are encoded but have a working hyperlink underneath. Some are Spoonerisms or even written backwards, Enjoy! ss, @SS or $$ is Send Spaace, m3g@ is Megaa, <d0t> is a period or dot as in dot com, etc. -

Impossible Communities in Prague's German Gothic
Washington University in St. Louis Washington University Open Scholarship Arts & Sciences Electronic Theses and Dissertations Arts & Sciences Spring 5-15-2019 Impossible Communities in Prague’s German Gothic: Nationalism, Degeneration, and the Monstrous Feminine in Gustav Meyrink’s Der Golem (1915) Amy Michelle Braun Washington University in St. Louis Follow this and additional works at: https://openscholarship.wustl.edu/art_sci_etds Part of the English Language and Literature Commons, German Literature Commons, and the History Commons Recommended Citation Braun, Amy Michelle, "Impossible Communities in Prague’s German Gothic: Nationalism, Degeneration, and the Monstrous Feminine in Gustav Meyrink’s Der Golem (1915)" (2019). Arts & Sciences Electronic Theses and Dissertations. 1809. https://openscholarship.wustl.edu/art_sci_etds/1809 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Arts & Sciences at Washington University Open Scholarship. It has been accepted for inclusion in Arts & Sciences Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of Washington University Open Scholarship. For more information, please contact [email protected]. WASHINGTON UNIVERSITY IN ST. LOUIS Department of Germanic Languages and Literatures Program in Comparative Literature Dissertation Examination Committee: Lynne Tatlock, Chair Elizabeth Allen Caroline Kita Erin McGlothlin Gerhild Williams Impossible Communities in Prague’s German Gothic: Nationalism, Degeneration, and the Monstrous Feminine in Gustav Meyrink’s -
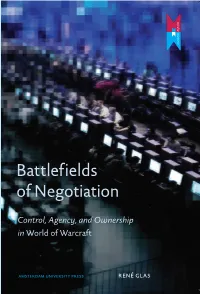
Battlefields of Negotiation
Battlefields of Negotiation The massively multiplayer online role-playing media game World of Warcraft has become one of matters media the most popular computer games of the past decade, introducing millions around the world to community-based play. Within the boundaries set by its design, the game encourages players to appropriate and shape matters it to their own wishes, resulting in highly diverse forms of play and participation. This illuminating study frames World of Warcraft as a complex socio-cultural phenomenon defined by and evolving as a result of the negotiations between groups of players as well as the game’s owners, throwing new light on complex consumer-producer rela- tionships in the increasingly participatory but still tightly controlled media of online games. rené glas rené René Glas is assistant professor of new media and digital culture at Utrecht University. Battlefields of Negotiation Control, Agency, and Ownership in World of Warcraft www.aup.nl ISBN 978-90-896-4500-5 978 908964 5005 amsterdam university press amsterdam university press rené glas AUP MM 08.Battlefields. rug12mm v02.indd 1 20-12-12 12:23 Battlefields of Negotiation MediaMatters is a series published by Amsterdam University Press on current debates about media technology and practices. International scholars critically analyze and theorize the materiality and performativity, as well as spatial practices of screen media in contributions that engage with today's (digital) media culture. For more information about the series, please visit: www.aup.nl Battlefields of Negotiation Control, Agency, and Ownership in World of Warcraft René Glas Amsterdam University Press The publication of this book has been supported by NWO (The Netherlands Or- ganisation for Scientific Research), The Hague, the Netherlands. -

Space and Gender in Post-War German Film
The Misogyny of the Trümmerfilm - Space and Gender in Post-War German film A thesis submitted to the University of Reading For the degree of Doctor of Philosophy Department of Modern Languages and European Studies Richard M. McKenzie January 2017 1 | Page Acknowledgements I would like to express my thanks to my supervisors Dr Ute Wölfel and Prof. John Sandford for their support, guidance and supervision whilst my thesis was developing and being written. It has been a pleasure to discuss the complexities of the Trümmerfilm with you both over multiple coffees during the last few years. I am also grateful for the financial support provided by the Reading University Modern Foreign Languages Department at the beginning of my PhD study. My thanks must also go to Kathryn, Sophie and Isabelle McKenzie, with my parents and sister, for their forbearance whilst I concentrated on my thesis. In addition to my supervisors and family, I would like to record my thanks to my friends; Prof. Paul Francis, Dr Peter Lowman, Dr Daniela La Penna, Dr Simon Mortimer, Dr J.L. Moys and D.M. Pursglove for their vital encouragement at different points over the last few years. Finally, I would like to acknowledge the debt that I owe to two people. Firstly, Herr Wilfred Muscheid of the Frankfurt International School who introduced me to the intricacies of the German language ultimately making my PhD study possible. Secondly, I would like to acknowledge the influence of the late Prof. Lindsey Hughes, lecturer in the former Reading University Russian Department, who, with her departmental colleagues, taught me many of the basic academic tools and determination that I have needed to complete my PhD. -
Local Residents Are Outraged New York Accepts Union County's Offer
festfield football team beats Cranfqrd in overtime. See page C-1 s « t—* eg • I WESTFIELD SCOTCH PLAINS FANWOOD Vol. 16, No. 37 fjt u. u. Friday, September 14, 2001 50 cents I* r S » Li J Briefs County to honor 'Escape from a war zone POW/MIAs Military veterans who live in Union County — especially those New York \ who spent time as Prisoners of War — are invited to participate in the annual Union County commuters \ POW/MIA Remembrance Day Ceremony on Friday, Sept. 21. This year's event begins at share tales 11:15 a.m. in front of the Union County Courthouse on Broad Street in Elizabeth. of horror Police and fire departments have been asked to sound their By THOMAS SCOTT , sirens at noon on Sept. 21 in TIIK UKCOHIt I'HKSS honor of the POWMIAs. WESTF1KLD — It was a day For more information, call they will never forget, no matter Stender's office at (908) 527- how much they may want to. 4116. Survivors of the worst terroriflt attack in America's history came off Downtown work the train at tho Westfip.ld station with stories of destruction and ready to begin mayhem no one ever dreamed WESTFIELD—Through a WOUUI hll])|HH). Union County grant of $450,000 It was literally "an escn|>e from a and another $138,000 in town war zone" said one woman, who funds downtown streetscape pro- requested that her name be with- jects and parking lot improve- hold. ments are set to begin With her HIIOOH .still covered with The streetscape projects the gray dust front the collapse of involve the setting of brick side- the twin towers of the World Trade walks and new lighting at a Center, she made her way slowly number of key intersections, from the train to her car, weary installing a brick paved alley to from her ordeal. -
Sense in Communication
Draft – Comments and Suggestions Welcomed Version 1.32 Sense in Communication October 16, 2003 Abstract The demand for text messaging relative to telephony, the amount of time spent participating in virtual worlds or digital games relative to television viewing, and the value of camera phone ser- vices all depend on how persons make sense in communication. Three models for communica- tion are information transfer, storytelling, and presence. While analysis of communication has tended to employ the first two models, the third model provides a better orientation for recogniz- ing and organizing useful knowledge about sensuous choices in communication. Making sense of presence of another like oneself is a good that drives demand for a wide range of communica- tion services. From study of living organisms, artistic masterpieces, and media history, this work documents knowledge about this good. Providing means for persons to make sense of presence encompasses competition among communication services with different sensory qualities. Competition to support this good offers enduring opportunities to create high industry value. Note: The most recent version of this paper is freely and publicly available at www.galbithink.org When viewed on a color monitor or printed on a color printer, this paper contains color images. Douglas A. Galbi Senior Economist Federal Communications Commission1 1 The opinions and conclusions expressed in this paper are those of the author. They do not necessarily reflect the views of the Federal Communications Commission, its Commissioners, or any staff other than the author. I am grateful for numerous FCC colleagues who have helped me and encouraged me over the past eight years of my ca- reer at the FCC.