Der Bodensee
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Crustacean Zooplankton in Lake Constance from 1920 to 1995: Response to Eutrophication and Re-Oligotrophication
Arch. Hydrobiol. Spec. Issues Advanc. Limnol. 53, p. 255-274, December 1998 Lake Constance, Characterization of an ecosystem in transition Crustacean zooplankton in Lake Constance from 1920 to 1995: Response to eutrophication and re-oligotrophication Dietmar Straile and Waiter Geller with 9 figures Abstract: During the first three quarters ofthis century, the trophic state ofLake Constance changed from oligotrophic to meso-/eutrophic conditions. The response ofcrustaceans to the eutrophication process is studied by comparing biomasses ofcrustacean zooplankton from recent years, i.e. from 1979-1995, with data from the early 1920s (AUERBACH et a1. 1924, 1926) and the 1950s (MUCKLE & MUCKLE ROTTENGATTER 1976). This comparison revealed a several-fold increase in crustacean biomass. The relative biomass increase was more pronounced from the early 1920s to the 1950s than from the 1950s to the 1980s. Most important changes ofthe species inventory included the invasion of Cyclops vicinus and Daphnia galeata and the extinction of Heterocope borealis and Diaphanosoma brachyurum during the 1950s and early 1960s. All species which did not become extinct increased their biomass during eutrophication. This increase in biomass differed between species and throughout the season which re sulted in changes in relative biomass between species. Daphnids were able to enlarge their seasonal window ofrelative dominance from 3 months during the 1920s (June to August) to 7 months during the 1980s (May to November). On an annual average, this resulted in a shift from a copepod dominated lake (biomass ratio cladocerans/copepods = 0.4 during 1920/24) to a cladoceran dominated lake (biomass ratio cladocerans/copepods = 1.5 during 1979/95). -

Zusammenstellung Der Fischereilichen Vorschriften Für Die Angelfischerei Am Untersee
Jagd- und Fischerei- Verwaltung Zusammenstellung der fischereilichen Vorschriften für die Angelfischerei am Untersee I. Auszug aus der III. Auszug aus der Unterseefischereiordung Tierschutzverordnung (Stand 1. Januar 2018) (Stand 4. September 2018) II. Auszug aus der Verordnung IV. Auszug aus der Verordnung des Regierungsrates zum Bundesgesetz des Kantons Thurgau zur über die Fischerei Unterseefischereiordnung (Stand 1. Januar 2018) (Stand 1. Mai 2015) 3.5450.212 Fischereiliche Bestimmungen für den Untersee 2020 Sehr geehrte Anglerinnen, sehr geehrte Angler Gegenüber den Vorschriften 2019 haben sich keine Änderungen der Bestim- mungen ergeben. Beachten Sie jedoch bitte die Präzisierungen in den §§ 3, 14 und 23 der Unterseefischereiordnung (I). Wir machen Sie darauf aufmerksam (vgl. Innenseite Umschlag Teil Fisch- fangstatistik), dass Sie künftig die Sportfischer-Jahreskarte automatisch ver- längern lassen können. Jagd- und Fischereiverwaltung Im Dezember 2019 des Kantons Thurgau I. Unterseefischereiordnung § 1 Räumlicher Geltungsbereich (1) Der Geltungsbereich dieses Vertrages umfasst den ganzen Untersee und den Seerhein von der alten Kon- stanzer Rheinbrücke einschliesslich der darunter befind- lichen Wasserfläche bis zu der Linie, die entlang und in Verlängerung der deutsch-schweizerischen Grenze unter- halb von Öhningen den Rhein überquert. (3) Der Geltungsbereich umfasst ferner die Aach bis 100 m unterhalb der Strassenbrücke Moos-Bohlingen, den Markelfinger und Allensbacher Mühlbach jeweils bis zur Brücke der Bahnlinie Radolfzell-Konstanz, die sonstigen Zuflüsse des Untersees und des Seerheins bis 100 m auf- wärts der Mündung sowie innerhalb einer Entfernung von 100 m alle Gräben und Vertiefungen, welche durch ein Gewässer mit dem Untersee und dem Seerhein in fort- dauernder Verbindung stehen. § 3 Berechtigung im Gebiet der allgemeinen Fischerei (1) Im Gebiet der allgemeinen Fischerei ist zur Ausübung der Fischerei nur berechtigt, wer im Besitze einer gültigen Fischerkarte (§§ 6, 8 bis 11) ist. -

Schwachstellenanalyse Bodensee-Rundwanderweg
Bodensee- Rundwanderweg AG Tourismus und Umwelt in der Kommission Umwelt Schwachstellenanalyse Bodensee-Rundwanderweg - Abschlussbericht - Januar 2002 H.-P. Grünenfelder, Planungsamt St. Gallen R. Beuerle, J. Scheibe, Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 2 Verfasser: Hans-Peter Grünenfelder Planungsamt St. Gallen, Baudepartement Lämmlisbrunnenstr. 54, CH-9001 St. Gallen Tel.: +41 71/229-3150 Fax +49 71/229-4599 E-mail: [email protected] Rainer Beuerle, Julia Scheibe Regionalverband Bodensee-Oberschwaben Hirschgraben 2, D-88214 Ravensburg Tel.: +49 751/36354-29 Fax +49 751/36354-54 E-mail: [email protected] 3 INHALTSVERZEICHNIS 1 Einführung .............................................................................................................. 4 2 Kurzberichte nach Gebietskörperschaften .......................................................... 6 2.1 Kanton Schaffhausen......................................................................................... 6 2.2 Kanton Thurgau ................................................................................................. 6 2.3 Kanton St. Gallen............................................................................................... 7 2.4 Land Vorarlberg ................................................................................................. 8 2.5 Landkreis Lindau................................................................................................ 9 2.6 Landkreis Bodenseekreis.................................................................................. -

Limnologischer Zustand Des Bodensees
Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee LIMNOLOGISCHER ZUSTAND DES BODENSEES Nr.9 Grundlagen (Stand 1985) Jber. Int. Gewässerschutzkomm. Bodensee: Limnol. Zust. Bodensee, 9 (1985) Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee LIMNOLOGISCHER ZUSTAND DES BODENSEES Nr.9 Grundlagen (Stand 1985) 1985 VORWORT Der Bodensee ist in limnologischer Hinsicht einer der bestuntersuchten Seen. Sei t 1961 informiert die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) über den limnologischen Zustand dieses Sees und zeigt dami t gleichzei tig die Auswirkungen der Reinhaltemaßnahmen auf. Ab 1974 liegen Jahresberichte vor. Der vorliegende Bericht faßt die von der speziellen Charakteristik der einzelnen Seejahre unabhängigen Grundlagen zusammen und soll damit das Verständnis der limnologischen Vorgänge und die Interpretation der in den Abbildungen und Tabellen der einzelnen Jahresberichte enthaltenen Daten er leichtern. Beschrieben werden die geographischen und physikalischen Verhältnis• se sowie die chemischen und biologischen Größen mit ihrer bisherigen Entwick lung. Als kurze Einführung in die wichtigsten limnologischen Gegebenheiten des Sees kann der Bericht weder umfassend über die zahlreichen, am Bodensee erzielten Untersuchungsergebnisse berichten, noch eine erschöpfende Aufzählung der vie len einschlägigen Publikationen bieten. Weitergehende zusammenfassende Dar stellungen aus neuerer Zeit wurden z.B. von Kiefer (1972), Grim (1968, 1980), Elster (1974, 1982) Tilzer et al. (1982) und IGKB (1961, 1975, 1982) vorgelegt. Weiterführende Publikationen zu Einzelthemen werden im Text zitiert und sind dem Literaturverzeichnis zu entnehmen. - 1 - INHALT Seite 1. Geographische und physikalische Verhältnisse 2 1.1 Einzugsgebiet 2 1.2 Niederschläge 7 1.3 Zufluß 7 1.4 Pegel 7 1.5 Abfluß 8 1.6 Durchflußverhältnisse 8 1.7 Thermische Verhältnisse 9 1.8 Einschichtung der Bodenseezuflüsse 10 1.9 Strömungen 11 2. -

(Anatidae) Des Ermatinger Beckens (Bodensee) 24-71 © Deutschen Ornithologen-Gesellschaft Und Partner; Download F Die 24 F
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Vogelwarte - Zeitschrift für Vogelkunde Jahr/Year: 1965 Band/Volume: 23_1965 Autor(en)/Author(s): Szijj Josef Artikel/Article: Ökologische Untersuchungen an Entenvögeln (Anatidae) des Ermatinger Beckens (Bodensee) 24-71 © Deutschen Ornithologen-Gesellschaft und Partner; download www.do-g.de; www.zobodat.at f Die 24 F. A. Kipp, Beobachtungen am Felsenkleiber [Vogelwarte Derlei Vorkommnisse belegen übrigens, daß die potentiellen Verhaltensanlagen reicher sind als der Normalfall zeigt. Fehlt es zum geeigneten Zeitpunkt an einer Baum höhle, so kaim Sitta europaea den Wechsel zum „Felsnest“ unschwer vollziehen. Auch auf Seiten der Felsenkleiber gibt es Übergänge vom Baum- zum Felsnest. Nach Sarudny und H ärms nistet Sitta tephronota obscura noch gerne in Baumhöhlungen, baut jedoch auch Lehmnester an Felsen. Ob es sich dabei um Angehörige gleicher oder verschiedener Populationen handelt, müßte wohl noch geklärt werden, ist aber in unse rem Zusammenhang nicht wesentlich. Die fortgesetzte Steigerung derjenigen Verhaltensanlagen, welche schon bei den Baumkleibern deutlich zu erkennen sind, haben letzten Endes zum Felsenkleiber-Bau geführt. Wären die Felsenkleiber einer nicht-klebenden Vogelgruppe entsprungen, so würden sie nach der Weise anderer felsenbewohnenden Vogelarten ihre Nester in Vor gefundenen Spalten unterbringen, ohne die Eingänge zu verengern und ohne sich zu so luxurösen Baumeistern entwickelt zu haben. Da jedoch die Anlage zum Mörteln bei den baumbewohnenden Arten schon vorhanden und mit einer gewissen Verhaltensplastizität verbunden war, konnte sie beim Übergang zum Felsbiotop weitergeführt und noch wesentlich gesteigert werden. — Das Studium solcher Steigerungsreihen, bei welchen den inneren Verhaltensanlagen eine wichtige Rolle zukommt — wohl mehr als den äußeren Faktoren — , gehört zu den reizvollen Themen ornithologischer Forschung. -

Submerse Makrophyten Der Litoralzone Des Bodensees 1993 Im Vergleich Mit 1978 Und 1967
Ber. Int. Gewässerschutzkomm. Bodensee: 46, 1998 ISSN 1011-1263 Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee . Bericht Nr. 46 Submerse Makrophyten der Litoralzone des Bodensees 1993 im Vergleich mit 1978 und 1967 Bearbeiter: Dr. Klaus Schmieder Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie der Universität Hohenheim in / Zusammenarbeit mit dem Institut für Seenforschung Langenargen der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg im Auftrag der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee -1998- Submerse Makrophyten der Litoralzone des Bodensees 1993 im Vergleich mit 1978 und 1967 Bearbeiter: Dr. Klaus Schmieder Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie, Universität HQhenheim " in Zusammenarbeit mit dem Institut für Seenforschung Langenargen der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg Redaktionelle Bearbeitung: Dr. Reiner Kümmerlin Im Auftrag der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee 1998 Vorwort Dem Schutz des europaweit bedeutsamen Ökosystems Bodensee hat sich die INTERNATIONALE GEWÄSSERSCHUTZKOMMISSION FÜR DEN BODENSEE (IGKB) seit nunmehr bald 40 Jahren verschrieben. Anlass für ihre Gründung und ihre grässte Herausfor derung in den vergangenen Jahrzehnten war die drohende Überdüngung des Sees mit Phos phorverbindungen. Um dieser Gefahr zu begegnen, empfiehlt die IGKB den Staaten im Ein zugsgebiet geeignete Gegenmassnahmen und koordiniert sie, insbesondere im Abwasserbe reich. Gleichzeitig initiiert und fördert sie wissenschaftliche Untersuchungen, die für eine lau fende Überwachung und Beurteilung des Seezustandes notwendig sind. Den gemeinsamen Anstrengungen aller Staaten im Einzugsgebiet des Bodensees ist es zu verdanken, dass der für die Überdüngung massgebliche Phosphorgehalt im Freiwasser ent scheidend gesenkt werden konnte. Dieser Erfolg manifestiert sich zunehmend deutlicher in den verschiedensten Reaktionen des Sees. Augenfällig werden die Änderungen beispielswei se in der Algenbiozönose des Freiwassers und in der verbesserten Versorgung grundnaher Wasserschichten mit Sauerstoff. -
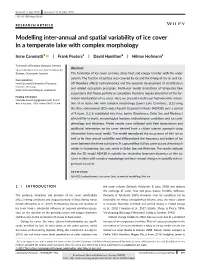
Modeling Inter-Annual and Spatial Variability of Ice Cover in a Temperate Lake with Complex Morphology
Received: 5 June 2019 Accepted: 15 October 2019 DOI: 10.1002/hyp.13618 RESEARCH ARTICLE Modelling inter-annual and spatial variability of ice cover in a temperate lake with complex morphology Irene Caramatti1 | Frank Peeters1 | David Hamilton2 | Hilmar Hofmann1 1University of Konstanz, Konstanz, Germany Abstract 2Australian Rivers Institute, Griffith University, Brisbane, Queensland, Australia The formation of ice cover on lakes alters heat and energy transfer with the water column. The fraction of surface area covered by ice and the timing of ice-on and ice- Correspondence Irene Caramatti, University of Konstanz, off therefore affects hydrodynamics and the seasonal development of stratification Konstanz, Germany. and related ecosystem processes. Multi-year model simulations of temperate lake Email: [email protected] ecosystems that freeze partially or completely therefore require simulation of the for- Funding information mation and duration of ice cover. Here we present a multi-year hydrodynamic simula- Deutsche Forschungsgemeinschaft, Grant/ Award Number: 298726046/GRK2272/A4 tion of an alpine lake with complex morphology (Lower Lake Constance, LLC) using the three-dimensional (3D) model Aquatic Ecosystem Model (AEM3D) over a period of 9 years. LLC is subdivided into three basins (Gnadensee, Zeller See and Rheinsee) which differ in depth, morphological features, hydrodynamic conditions and ice cover phenology and thickness. Model results were validated with field observations and additional information on ice cover derived from a citizen science approach using information from social media. The model reproduced the occurrence of thin ice as well as its inter-annual variability and differentiated the frequency and extent of ice cover between the three sub-basins. -

Die Entwicklung Der Strandrasen Am Unterseeufer in Den Letzten 100 Jahren
Die Entwicklung der Strandrasen am Unterseeufer in den letzten 100 Jahren Irene Strang, Michael Dienst und Markus Peintinger 199 Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft, Band 66 25 Seiten • 15 Abbildungen • Frauenfeld 2012 1 Einleitung Unter dem Begriff Strandrasen wird heute meist die Strandschmielen-Gesell- schaft (Deschampsietum rhenanae) verstanden, die erstmals von Oberdorfer (1957) als für den Bodensee endemische1 Pflanzengesellschaft beschrieben wurde. Häufig wird noch die Nadelbinsen-Gesellschaft (Littorello-Eleocharitetum acicularis) dazu gezählt (Thomas et al. 1987) und für Dienst et al. (2004) gehören auch die angrenzenden Flutrasen-Gesellschaften dazu. Charakterarten der Strandschmielen-Gesellschaft sind neben der namensge- benden Art der Strand-Schmiele (Deschampsia littoralis) das Bodensee-Vergiss- meinnicht (Myosotis rehsteineri, syn. M. caespititia), der Bodensee-Steinbrech (Saxifraga oppositifolia subsp. amphibia) und die Riednelke (Armeria purpurea). Diese vier Strandrasenpflanzen sind Endemiten1 des präalpinen Raums, wobei die beiden letztgenannten Taxa (Arten, Unterarten) als ausgestorben oder ver- schollen gelten (vgl. Lang 1968). Hinzu kommen noch zwei weitere seltene Arten: der Strandling (Littorella uniflora, syn. Plantago uniflora) und der Ufer-Hahnen- fuss (Ranunculus reptans) (Abbildung 1). Die genannten Strandrasenarten sind sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland als vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet eingestuft und daher besonders geschützt (BUWAL 2002, Breunig & Demuth -

ETH Zurich Research Collection
Research Collection Doctoral Thesis Environmental change and its impact on hybridising Daphnia species complexes Author(s): Hartmann Möst, Markus Publication Date: 2013 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-010076219 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library DISS. ETH NO. 21414 Environmental change and its impact on hybridising Daphnia species complexes A dissertation submitted to ETH ZURICH for the degree of Doctor of Sciences presented by MARKUS HARTMANN MÖST Mag.Biol., University of Innsbruck born on December 22nd, 1980 citizen of AUSTRIA accepted on the recommendation of PD Dr. Piet Spaak University Reader Dr. Chris Jiggins Prof. Dr. Christoph Vorburger 2013 Contents Summary .................................................................................................................................... 1 Zusammenfassung ..................................................................................................................... 3 Chapter 1: Introduction and outline of the thesis ..................................................................... 5 Chapter 2: A human‐facilitated invasion reconstructed from the sediment egg bank using genetic markers ........................................................................................................................ 19 Chapter 3: Environmental organic contaminants influence hatching -

Uferverbauungen Und Uferaufschüttungen Am Bodensee-Untersee
Erschienen in: Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft ; 67 (2014). - S. 47-83 Uferverbauungen und Uferaufschüttungen am Bodensee-Untersee Wolfgang Ostendorp & Jörg Ostendorp 47 Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft, Band 67 37 Seiten • 19 Abbildungen • 11 Tabellen • Frauenfeld 2014 Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS) URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-0-421124 1 Einleitung Wer bei spätsommerlich niedrigem Wasserstand den Untersee hinabfährt, wird feststellen, dass weite Strecken des Seeufers bebaut und mit Ufermauern oder Steinschüttungen befestigt sind. Kartierungen aus den späten 1970er-Jahren ergaben, dass 33% des baden-württembergischen Unterseeufers «geringen, stärkeren» oder «starken Eingriffen» durch Uferverbauungen ausgesetzt waren (Sießegger 1980). Bei erneuten Kartierungen 1999 und 2000 waren 31% der Uferlänge (ohne Seerhein) mit Ufermauern verbaut, weitere 22% mit künstlichen Böschungen versehen, und die restlichen rund 47% waren mit Schilf besiedelt (Teiber 2003). Über die Entstehung, das Alter und die Bauweise der Ufermauern, ihre Höhe und Lage zum mittleren Wasserspiegel, ihre räumliche Verteilung in den einzelnen Ufergemarkungen, in Flachwasserschutzzonen, Natur- und Landschaftsschutzgebieten liegen keine Angaben vor. Ebenso fehlen jegliche Angaben über das Ausmass der Ufervorschüttungen, die in den meisten Fällen Anlass für die Errichtung einer Ufermauer waren, sowie Angaben über die Nach- nutzungen der Vorschüttungsflächen und des Vorlandes. Damit sind -

Ostendorp W. & Dienst M
Geschichte der Seeuferröhrichte in der Grenzzone des Bodensee-Untersees Wolfgang Ostendorp und Michael Dienst 155 Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft, Band 66 43 Seiten • 16 Abbildungen • 3 Tabellen • Frauenfeld 2012 1 Einleitung Übergangslebensräume (Ökotone) sind für den Ökologen besonders reizvoll, denn hier ergeben sich auf engem Raum starke physikalische und chemische Gradienten, beispielsweise graduelle Unterschiede der Wasserversorgung, der Nährstoffverfüg- barkeit, des Lichtgenusses und bestimmter Stressoren. Ein sehr charakteristischer Übergangslebensraum ist das Seeufer-Ökoton, das zwischen den rein terrestrischen und den rein aquatischen Lebensräumen vermittelt. In einem schmalen Saum, der im Wesentlichen durch die maximalen Wasserstandsschwankungen und die Licht- durchlässigkeit des Wasserkörpers bestimmt wird, müssen sich die Pflanzen- und Tierarten entsprechend ihrer ökologischen Ansprüche einnischen, sodass ihre Populationen häufig in konzentrischen Gürteln entlang der Seeufer angesiedelt sind. Die aspektbestimmende Vegetation besteht an vielen Seen aus Röhrichten, die sich am Bodensee-Untersee überwiegend aus dem Schilf (Phragmites australis), der Seebinse (Schoenoplectus lacustris) und den beiden Rohrkolben-Arten Typha angustifolia und T. latifolia zusammensetzen. Baumann (1911a) widmete den Röhrich- ten einen breiten Raum, sodass wir ein lebendiges Bild von ihrer Bestandsstruktur und ihrem Aussehen bekommen. Damit drängen sich einige Fragen auf: Haben die Uferröhrichte schon immer so ausgesehen, -

UNESCO-Welterbe Alle Angaben in Dieser Broschüre Wurden Vor Drucklegung Sorgfältig Erfasst Und Waren Zum Zeitpunkt Der Drucklegung Gültig
Die Bilder stammen vom Pfahlbauten- Informationszentrum Baden-Württemberg im Landesamt für Denkmalpflege oder wurden uns von Tourist-Informationen und Leistungsträgern zur Verfügung gestellt. Alle Angaben in dieser Broschüre wurden vor Drucklegung sorgfältig erfasst und waren zum Zeitpunkt der Drucklegung gültig. Dennoch sind Änderungen vorbehalten. Wir UNESCO übernehmen keine Haftung für Veränderun- -Welterbe gen, die nach Drucklegung eingetreten sein EINE REISE ZU DEN SCHÄTZEN DER BODENSEE-GESCHICHTE mögen. Discover the treasures from Lake Constance’s past Gefördert aus Projektmitteln des Landkreises Konstanz Vorwort Foreword LIEBE BESUCHERINNEN UND BESUCHER, die internationale Bodenseeregion bildet durch die Vielzahl kultureller Schätze eine einzigartige Kulturlandschaft. Das zeigt sich insbesondere auch durch die Monumente, die von der UNESCO als Welt- erbestätten ausgezeichnet wurden. Sie haben die fantastische Möglichkeit, eine besondere Auswahl spannender Orte der Vergangenheit auf engstem Raum zu erleben – eine Reise von der Jungsteinzeit bis ins späte Mittelalter. Lassen Sie sich von unserer Zusammenstellung inspirieren und beginnen Sie schon heute Ihre unvergessliche Entdeckungstour in der einmaligen Kulturlandschaft Bodensee. Mit Ihrer Reise in die Vergangenheit unterstützen Sie uns dabei, das gemeinsame Natur- und Kulturerbe der internationalen Bodenseeregion für künftige Generationen zu erhalten. Herzlichen Dank! Dear Visitor, The multinational Lake Constance region is a fascinating landscape offering a wealth of cultural treasures. This is particularly reflected in the number of sites that have been granted World Heritage status by UNESCO. You have a fantastic opportunity to see a whole host of historical sites within a compact area – it is like taking a journey from the Neolithic Age to the late Middle Ages. We hope you will feel inspired by our brochure and embark on an unforgettable journey of discovery in the unique cultural landscape of Lake Constance.