Januar–März 2015
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jeder Treu Auf Seinem Posten: German Catholics
JEDER TREU AUF SEINEM POSTEN: GERMAN CATHOLICS AND KULTURKAMPF PROTESTS by Jennifer Marie Wunn (Under the Direction of Laura Mason) ABSTRACT The Kulturkampf which erupted in the wake of Germany’s unification touched Catholics’ lives in multiple ways. Far more than just a power struggle between the Catholic Church and the new German state, the conflict became a true “struggle for culture” that reached into remote villages, affecting Catholic men, women, and children, regardless of their age, gender, or social standing, as the state arrested clerics and liberal, Protestant polemicists castigated Catholics as ignorant, anti-modern, effeminate minions of the clerical hierarchy. In response to this assault on their faith, most Catholics defended their Church and clerics; however, Catholic reactions to anti- clerical legislation were neither uniform nor clerically-controlled. Instead, Catholics’ Kulturkampf activism took many different forms, highlighting both individual Catholics’ personal agency in deciding if, when, and how to take part in the struggle as well as the diverse factors that motivated, shaped, and constrained their activism. Catholics resisted anti-clerical legislation in ways that reflected their personal lived experience; attending to the distinctions between men’s and women’s activism or those between older and younger Catholics’ participation highlights individuals’ different social and communal roles and the diverse ways in which they experienced and negotiated the dramatic transformations the new nation underwent in its first decade of existence. Investigating the patterns and distinctions in Catholics’ Kulturkampf activism illustrates how Catholics understood the Church-State conflict, making clear what various groups within the Catholic community felt was at stake in the struggle, as well as how external factors such as the hegemonic contemporary discourses surrounding gender roles, class status, age and social roles, the division of public and private, and the feminization of religion influenced their activism. -
Frank Giering Filmreihe 22.07.-11.08 .2010 Im Babylon
IN ERINNERUNG AN FRANK GIERING FILMREIHE 22.07.-11.08 .2010 IM BABYLON ABSOLUTE GIGANTEN. BAADER. DAS SCHLOS S. DIE NACHT SINGT IHRE LIEDER . FREIGESPROCHEN. FUNNY GAMES. HIERANKL. KEINE ANGST. IN ERINNERUNG AN FRANK GIERING 22.07.-11.08 .2010 IM BABYLON «Weißt du was ich manchmal denke? Es müsste immer Musik da sein. Bei allem was du machst. Wenn’s so richtig scheiße ist, dann… ist wenigstens noch die Musik da. Und an der Stelle, wo… wo’s am allerschönsten ist, müsste die Platte springen und du hörst immer nur diesen einen Moment.» (SATZ AUS «ABSOLUTE GIGANTEN» VON FRANK GIERING ALS FLOYD…) Mit Filmen wie «Funny Games», «Baader», «Absolute Giganten» und «Hierankl» wurde er berühmt – nun ist der deut - sche Schauspieler Frank Giering im Alter von nur 38 Jahren gestorben. Wir zeigen diese Filme, als Berliner Erstaufführung «Freigesprochen» (mit Corinna Harfouch und Lavina Wilson), Hanekes Kafka Adaption «Das Schloss», den Berlinale- Wettbewerbsfilm «Die Nacht singt ihre Lieder» und einen der letzten Filme «Keine Angst» mit dem großartigen Frank Giering noch einmal auf der großen Leinwand. ABSOLUTE GIGANTEN D 1999, R: SEBASTIAN SCHIPPER, MIT FRANK GIERING, FLORIAN LUKAS, JULIA HUMMER, JOCHEN NICKEL, MUSIK: THE NOTWIST, 35MM, 80 MIN Drei Freunde, Floyd, Ricco und Walter, aus dem Hamburger Arbeitermilieuverleben ihren letzten gemeinsamen Abend. Einer von ihnen hat auf einem Frachter angeheuert, um so der trostlosen Enge des heimatlichen Alltags zu entkommen. Ziellos fahren sie durch die Nacht, auf der Suche nach dem Kick, um den nahenden Abschied zu verdrängen. — Frank Giering spielt den nachdenklichen, melancholische Floyd. «Was ist das für ein Film? Er erzählt die Geschichte einer einzigen Nacht und packt dabei das ganze Leben. -
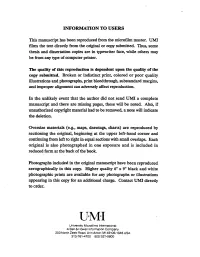
INFORMATION to USERS This Manuscript Has Been Reproduced
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI film s the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough* substandard margins, and improper alignment can adversely afreet reproductioiL In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these wül be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. UMI University Microfilms International A Bell & Howell Information Company 300 North Zeeb Road. Ann Arbor. Ml 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 Order Nnsaber 9816176 ‘‘Ordo et lîbertas”: Church discipline and the makers of church order in sixteenth century North Germany Jaynes, JefiErey Philip, Ph.D. -

Presskit Presseheft “58
Presskit Presseheft “58. festival internazionale del film locarno“ official selection in competition 3 Degrees Colder Press Contact MEDIA OFFICE Kurfürstendamm 11 D-10719 Berlin / Germany Tel.: +49-30-88 71 44-0 Fax: +49-30-88 71 44 22 [email protected] World Sales media luna entertainment GmbH & Co. KG Hochstadenstrasse 1-3 D-50674 Cologne / Germany Tel: +49-221-801 498 0 | 1 Fax: +49-221-801 498 21 [email protected] www.medialuna-entertainment.de Producers blue eyes Fiction GmbH & Co. KG Klenzestr. 11 D-85737 Ismaning / Germany Tel.: +49-89-96 98 93 481 Fax: +49-89-96 98 93 33 [email protected] www.blueeyes.de sabotage films GmbH Kastanienallee 56 D-10119 Berlin / Germany Tel.: +49-30-440 30 89 0 Fax: +49-30-440 30 89 9 [email protected] www.sabotage-films.de www.threedegreescolder.de www.dreigradkaelter.de Cast Marie Bibiana Beglau Jan Sebastian Blomberg Frank Johann von Bülow Jenny Meret Becker Steini Alexander Beyer Babette Katharina Schüttler Olli Florian David Fitz Father Engel Hubert Mulzer Mother Engel Grischa Huber Maren Brigitte Zeh René David Scheller Crew Director Forian Hoffmeister Written by Mona Kino & Florian Hoffmeister Director of Photography Busso von Müller Music composed by Adrian Corker & John Conboy Film Editor Susanne Hartmann Casting Anja Dihrberg Casting Production Designer Mona Kino 2| Costume Designer Daniela Selig Make-Up Artists Heiko Schmidt Marie-Eglantine Leibfried Original Sound by Frank Hoyer Sound Designer Moritz Hoffmeister Sound Mixer Klaus Peintner Production Manager Rainer Jeskulke Line Producer Markus Golisano Commissioning Editor Claudia Simionescu Producers Corinna Mehner Martin Husmann Martin Cichy Karsten Aurich Germany - 2005 113 min. -

The End of Imperialism Was the Birth of Nationalism, a Wave of Rising
New German Identity: Reworking the Past and Defining the Present in Contemporary German Cinema Constance McCarney Dr. Robert Gregg Spring 2008 General University Honors McCarney 2 The end of imperialism was the birth of nationalism, a wave of rising consciousness that swept over the conquered areas of the world and brought them to their feet with a defiant cry, “We are a Nation!” These new nations, almost all multiethnic states, struggled in defining themselves, found themselves locked in civil wars over what the citizen of this nation looked like and who s/he was. The old nations, locked in a Cold War, looked on, confident in their own national cohesion and unity. But the end of the Cold War proved to be the birth of complicated new identity concerns for Europe. Yugoslavia splintered in terrible ethnic conflict. France rioted over the expression of religious affiliation. Germany tried desperately to salvage the hope that brought down the Wall and stitch itself back together. For Germany the main questions of identity linger, not only who is a German, but what does it mean to be German? In the aftermath of the great upheavals in Germany’s recent past, the Second World War and the fall of the Third Reich, German films did their best to ignore these questions of identity and the complications of the past. But in the late 1960s and throughout the 1970s, a New German Cinema arose that sought to work through the complex issues of West Germany: the legacy of the Nazi Past, American occupation, the Berlin Wall and divided Germany, the radicalism of the time period in a global context, and the civil rights movements, particularly the women’s movement. -

Rigorózní Práce, M. Kučera
UNIVERSITÉ PALACKÝ À OLOMOUC FACULTÉ DES LETTRES DÉPARTEMENT DES ÉTUDES ROMANES MARTIN KU ČERA LA MISE EN SCÈNE DES PIÈCES DE PAUL CLAUDEL EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET DANS LE MONDE (1912-2012) OLOMOUC 2013 1 Je, soussigné, Martin Ku čera, déclare avoir réalisé ce travail par moi-même et à partir de tous les matériaux et documents cités. À Olomouc, le 11 juin 2013 2 REMERCIEMENT Ce travail est le résultat des recherches effectuées grâce au soutien financier inscrit dans le cadre du projet scientifique de l’Université Palacký à Olomouc. Je remercie également le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports de la République tchèque et le Gouvernement français de m’avoir accordé les bourses pour pouvoir mener notre recherche dans les archives et institutions en France (notamment au Département des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France à Paris et au Centre Jacques-Petit à Besançon). Il y a lieu de remercier tous les conseillers et tous les membres du personnel de certaines institutions scientifiques, centres de recherche et théâtres, car le rassemblement des matériaux n’aurait pas été possible sans leur collaboration disons directe ou indirecte, car sans leur assistance et complaisance il aurait été presque impossible de le réaliser. Je voudrais plus particulièrement adresser mes remerciements à Marie Voždová pour m’avoir donné la possibilité de découvrir le monde universitaire, c’est ainsi grâce à elle que j’ai pu participer activement à ses deux grands projets de recherche, l’un portant sur l’identification des pièces d’auteurs français et italiens sur la scène des théâtres de Moravie et de Silésie et l’autre, réalisé quelques années plus tard, avait pour objet d’identifier les livres d’auteurs français déposés dans la bibliothèque archiépiscopale du Château de Krom ěř íž. -

Quarterly 3 · 2009
cover_GFQ_3_2009heller.qxp:cover_GFQ_3_2009heller 24.07.2009 15:06 Uhr Seite 1 German Films Quarterly 3 · 2009 AT LOCARNO THE TWO HORSES OF GENHIS KHAN by Byambasuren Davaa AT MONTREAL ALIAS by Jens Junker ANNE PERRY-INTERIORS by Dana Linkiewicz CEASEFIRE by Lancelot von Naso AT VENEDIG DESERT FLOWER by Sherry Hormann SOUL KITCHEN by Fatih Akin PORTRAITS Almut Getto, Niko von Glasow, UFA Cinema, Alice Dwyer Inhaltsverz_GFQ3_2009.qxp:Inhaltsverz_GFQ3_2009 24.07.2009 15:01 Uhr Seite 1 German Films Quarterly 3 · 2009 directors’ portraits 4 A STROKE OF LUCK A portrait of Almut Getto 6 SHAKING AND STIRRING A portrait of Niko von Glasow producers’ portrait 8 NEW KIDS ON THE BLOCK A portrait of UFA Cinema actress’ portrait 12 SENSUALITY WITH PRINCIPLES A portrait of Alice Dwyer 14 news in production 18 BIS AUFS BLUT Oliver Kienle 18 BLACK DEATH Christopher Smith 20 FRECHE MAEDCHEN 2 Ute Wieland 20 GLUECKSRITTERINNEN Katja Fedulova 21 HABERMANN Juraj Herz 22 DER HUNGERWINTER 1946/47 Gordian Maugg 23 DIE JAGD NACH DER HEILIGEN LANZE Florian Baxmeyer 24 LUKS GLUECK Ayse Polat 25 NANGA PARBAT Joseph Vilsmaier 26 ORIENT EXPRESS THEATRE TRAIN Martin Andersson, Steffen Duevel 27 ORLY Angela Schanelec 27 RUMPE & TULI Samy Challah, Till Nachtmann, Stefan Silies 29 DER SANDMANN Jesper Moeller, Sinem Sakaoglu, Helmut Fischer 30 SATTE FARBEN VOR SCHWARZ Sophie Heldman 31 DAS SCHWEIGEN Baran bo Odar 32 THEMBA Stefanie Sycholt new german films 34 ALIAS Jens Junker 35 ANNE PERRY – INTERIORS Dana Linkiewicz 36 AYLA Su Turhan Inhaltsverz_GFQ3_2009.qxp:Inhaltsverz_GFQ3_2009 24.07.2009 15:01 Uhr Seite 2 37 BERLIN ’36 Kaspar Heidelbach 38 CHI L’HA VISTO Claudia Rorarius 39 DEUTSCHLAND NERVT MADE IN DEUTSCHLAND Hans-Erich Viet 40 DER ENTSORGTE VATER THE DISCARDED FATHER Douglas Wolfsperger 41 FLIEGEN FLY Piotr J. -

TV-Vorschau TV-Rückblick
Medien Fernsehen TV-Vorschau Fliege, von Opernarien und seichter sichtsloser. Dennoch gehen SS- Klaviermusik begleitet, neben Gottes- Schergen bei der Hitler-Jugend auf Hierankl diensten, Trauung und Taufe auch Heldenfang und schicken noch in noch einen Gospelchor gründet und den letzten Kriegswochen verblen- Montag, 20.45 Uhr, Arte 30000 Euro für den Umbau des Kinder- dete Kinder an die Front. In der Familienzwist statt Alpenglühen: Der gartens sammelt. heutigen zweiten Folge dieser Doku- preisgekrönte Debütfilm von Hans mentation berichten Zeitzeugen. Steinbichler ist ein Heimatfilm der Kriegskinder in Mitteldeutschland etwas anderen Art. Tochter Lene – Der Zusammenbruch Mauer des Schweigens (großartig: Johanna Wokalek) kehrt zum 60. Geburtstag ihres Vaters Dienstag, 22.05, MDR Freitag, 20.45 Uhr, Arte nach langen Jahren Abwesenheit Hunderte Kinder warten in Land- Betrunken läuft der 17-jährige Jamie zurück in die Chiemgauer Heimat. verschickungsheimen auf das Ende des (Callum Callaghan) durch einen düs- In „Hierankl“, so der Name des teren Londoner Vorort und Familienanwesens, scheint alles beim gerät in Streit mit den dort her- Alten. Unter der Oberfläche aber umlungernden Jugendlichen. brodelt es gewaltig: Vater Lukas Die kennen kein Erbarmen. (Josef Bierbichler) hat eine Geliebte, Mit Baseballschlägern und Mutter Rosemarie (Barbara Sukowa) Fußtritten prügeln sie ihn zu ein Verhältnis mit dem jungen Vin- Tode. Obwohl das halbe Viertel zenz (Alexander Beyer). Und dann Zeuge des Vorfalls wurde, will taucht auch noch der attraktive Götz später niemand etwas gesehen (Peter Simonischek) auf, ein Studien- haben. Ein ums andere Mal freund der Eltern – und mit ihm trifft Kommissar Tony Cottis kommen die düsteren Schatten der (Phil Davis) auf verschlossene Vergangenheit. -

Titel Kino 3/2003
EXPORT-UNION OF GERMAN CINEMA 3/2003 AT LOCARNO MEIN NAME IST BACH & DAS WUNDER VON BERN Piazza Grande AT VENICE ROSENSTRASSE in Competition AT SAN SEBASTIAN SCHUSSANGST & SUPERTEX in Competition FOCUS ON Film Music in Germany Kino Martin Feifel, Katja Riemann (photo © Studio Hamburg) Martin Feifel, Katja GERMAN CINEMA KINO3/2003 4 focus on film music in germany DON’T SHOOT THE PIANO PLAYER 14 directors’ portraits THE SUN IS AS MUCH MINE AS THE NIGHT A portrait of Fatih Akin 15 TURNING GENRE CINEMA UPSIDE DOWN A portrait of Nina Grosse 18 producer’s portrait LOOKING FOR A VISION A portrait of Bavaria Filmverleih- & Produktions GmbH 20 actress’ portrait BREAKING THE SPELL A portrait of Hannelore Elsner 22 KINO news in production 28 ABOUT A GIRL Catharina Deus 28 AGNES UND SEINE BRUEDER Oskar Roehler 29 DER CLOWN Sebastian Vigg 30 C(R)OOK Pepe Danquart 30 ERBSEN AUF HALB 6 Lars Buechel 31 LATTENKNALLER Sherry Hormann 32 MAEDCHEN MAEDCHEN II Peter Gersina 32 MARSEILLE Angela Schanelec 33 SAMS IN GEFAHR Ben Verbong 34 SOMMERBLITZE Nicos Ligouris 34 (T)RAUMSCHIFF SURPRISE – PERIODE 1 Michael "Bully" Herbig 35 DER UNTERGANG – HITLER UND DAS ENDE DES DRITTEN REICHES Oliver Hirschbiegel the 100 most significant german films (part 10) 40 WESTFRONT 1918 THE WESTERN FRONT 1918 Georg Wilhelm Pabst 41 DIE DREIGROSCHENOPER THE THREEPENNY OPERA Georg Wilhelm Pabst 42 ANGST ESSEN SEELE AUF FEAR EATS THE SOUL Rainer Werner Fassbinder 43 DER VERLORENE THE LOST ONE Peter Lorre new german films 44 V Don Schubert 45 7 BRUEDER 7 BROTHERS Sebastian Winkels -

Download Booklet
556788bk CC2004 2/4/04 10:12 PM Page 2 “Feel the love” “It was the perfect honeymoon ... Until it began” 8 ANGER MANAGEMENT (2003) 0 JUST MARRIED (2003) Director: Peter Segal Director: Shawn Levy Cast: Adam Sandler (Dave Buznik), Jack Nicholson (Dr Buddy Rydell), Marisa Tomei (Linda), Cast: Ashton Kutcher (Tom), Brittany Murphy (Sarah), Christian Kane (Peter Prentiss), David John Turturro (Chuck), Luis Guzmán (Lou), Jonathan Loughran (Nate), Kurt Fuller (Frank Moscow (Kyle), Monet Mazur (Lauren), David Rasche (Mr McNerney), Thad Luckinbill (Willie Head), Krista Allen (Stacy) McNerney), David Agranov (Paul McNerney) Story: After a silly misunderstanding over a headset aboard an airplane when everything Story: That there is truth in the saying “For better or for worse” is amply demonstrated to careers completely out of control, diffident businessman Dave Buznik is ordered by a court to Sarah and Tom as they start out on their European honeymoon. Not only do they have to undergo anger management therapy by specialist Dr Bobby Rydell, whom he had in fact met contend with giant cockroaches and eccentric locals, Sarah’s disapproving parents send along on the airplane where it all started. Dr Rydell’s highly radical methods include moving in with her ex-boyfriend, Christian, to make sure that the honeymoon is a disaster and break up the Buznik who must finally decide to speak up for himself or go back to square one. marriage. Music: ‘I Feel Pretty’ from the musical ‘West Side Story’ by Leonard Bernstein (1918-1990) Music: Bridal Chorus from the opera ‘Lohengrin’ by Richard Wagner (1813-1883) “This ship is our home. -

Good Bye, Lenin! (2003) Und Das Leben Der Anderen (2006)
AUDIODESKRIPTION UND KULTUR- SPEZIFISCHE ELEMENTE VON ZWEI FILMEN ÜBER DIE DDR: GOOD BYE, LENIN! (2003) UND DAS LEBEN DER ANDEREN (2006) Aantal woorden: 17.795 Fien De Bruycker Studentennummer: 01401228 Promotor: Prof. dr. Hildegard Vermeiren Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad master in het vertalen Academiejaar: 2017 – 2018 AUDIODESKRIPTION UND KULTUR- SPEZIFISCHE ELEMENTE VON ZWEI FILMEN ÜBER DIE DDR: GOOD BYE, LENIN! (2003) UND DAS LEBEN DER ANDEREN (2006) Aantal woorden: 17.795 Fien De Bruycker Studentennummer: 01401228 Promotor: Prof. dr. Hildegard Vermeiren Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad master in het vertalen Academiejaar: 2017 – 2018 Verklaring i.v.m. auteursrecht De auteur en de promotor(en) geven de toelating deze studie als geheel voor consultatie beschikbaar te stellen voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie. Het auteursrecht betreffende de gegevens vermeld in deze studie berust bij de promotor(en). Het auteursrecht beperkt zich tot de wijze waarop de auteur de problematiek van het onderwerp heeft benaderd en neergeschreven. De auteur respecteert daarbij het oorspronkelijke auteursrecht van de individueel geciteerde studies en eventueel bijhorende documentatie, zoals tabellen en figuren. VORWORT Gern möchte ich beim Anfang dieser Masterarbeit einigen Personen danken, die mir bei dieser Masterarbeit begleitet haben. Erstens möchte ich meiner Promotorin, Prof. Dr. Hildegard Vermeiren, für die gute Betreuung meinen Dank aussprechen. Sie stand immer bereit und hat mir hindurch der Arbeit viele Hinweise gegeben. Daneben möchte ich auch Herrn Christophe Wybraeke für die Sprachberatung danken. -

Berlin” in Selected Pre- and Post-Unification German Films
“The Wall in the Head”: Reading “Berlin” in Selected Pre- and Post-Unification German Films by Rachel E. Beattie B.A. A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Film Studies Carleton University OTTAWA, Ontario (September 23, 2005) 2005, Rachel E. Beattie Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. Library and Bibliotheque et Archives Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-18242-0 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-18242-0 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library permettant a la Bibliotheque et Archives and Archives Canada to reproduce,Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve,sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par I'lnternet, preter, telecommunication or on the Internet,distribuer et vendre des theses partout dans loan, distribute and sell theses le monde, a des fins commerciales ou autres, worldwide, for commercial or non sur support microforme, papier, electronique commercial purposes, in microform,et/ou autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in et des droits moraux qui protege cette these. this thesis. Neither the thesis Ni la these ni des extraits substantiels de nor substantial extracts from it celle-ci ne doivent etre imprimes ou autrement may be printed or otherwise reproduits sans son autorisation.