241-249 Jesuiten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Die Kunst Der 68Er Oder Die Macht Der Ohnmächtigen Zeitbilder Andreas Beitin Und Eckhart J
1968 – kaum ein anderes Jahr ist im 20. Jahrhundert so symbol- trächtig, kaum eines so besetzt mit Mythen, Vorurteilen und Emotionen. Das Signum „1968“ steht für den Höhe- und Wende- punkt einer internationalen Emanzipationsbewegung und für gesellschaftliche Umbrüche weltweit. Zahlreiche Essays von Autorinnen und Autoren unterschiedlicher Flashes of Disziplinen, Zeitzeugenberichte und Interviews sowie rund 550 Abbildungen beleuchten das globale „1968“. Sie werfen Schlaglichter auf die wichtigsten Schauplätze in Deutschland, Frankreich und den USA, in der Tschechoslowakei und der UdSSR, aber auch in Indien, Kuba und Mexiko. Der Blick richtet sich dabei insbesondere auf die impulsgebende Rolle der bildenden Kunst, die gesellschaftliche Vorgänge auf eine bis dahin nicht gekannte, innovative Weise visualisierte, kommen- the Future Die Kunst der 68er tierte und kritisierte. oder Die Macht der Ohnmächtigen Flashes of the Future. DieFlashes der Kunst 68er the Future. of oder Die Macht der Ohnmächtigen Andreas Beitin und Eckhart Gillen (Hrsg.) J. Zeitbilder Herausgegeben von Andreas Beitin und Eckhart J. Gillen Andreas Beitin / Eckhart J. Gillen (Hrsg.) Flashes of the Future Die Kunst der 68er oder Die Macht der Ohnmächtigen Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung Flashes of the Future. Die Kunst der 68er oder Die Macht der Ohnmächtigen Ludwig Forum für Internationale Kunst Aachen 20. April –19. August 2018 Schirmherr der Ausstellung: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Impressum Bonn 2018 © Bundeszentrale für politische Bildung / bpb Adenauerallee 86, 53113 Bonn Bestellungen: www.bpb.de/shop > shop Bestellnummer: 3989 ISBN 978-3-8389-7172-8 Bundeszentrale für Ludwig Forum für Redaktionsschluss: Februar 2018 politische Bildung Internationale Kunst Adenauerallee 86 Jülicher Str. 97 –109 Diese Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Bundes 53113 Bonn 52070 Aachen zentrale für politische Bildung dar. -

Susann Dietrich Studium
Vita Susann Dietrich *1984 Weißenfels, Sachsen-Anhalt, Deutschland Studium | Schule 2017 Diplom Kommunikationsdesign bei Prof. Gosbert Adler (Fotografie) und Prof. Ulrike Stoltz (Typografie) 2014 Meisterschülerabschluss Freie Kunst, Fachklasse Malerei, Prof. Wolfgang Ellenrieder, Hochschule für Bildende Künste Braunschweig 2013/14 Meisterschülerstudium Freie Kunst, Fachklasse Malerei, Prof. Wolfgang Ellenrieder, HBK Braunschweig 2012 Diplom Freie Kunst (mit Auszeichnung), Fachklasse Fotografie, Prof. Dörte Eißfeldt, HBK Braunschweig 2011 Reise- und Arbeitsstipendium in Istanbul, Türkei 2009/10 Studienaufenthalt an der Zürcher Hochschule der Künste, Departement Kunst, Vertiefung Fotografie bei Prof. André Gelpke und Prof. Thilo König 2008/09 Studienaufenthalte in Brasilien, Spanien, Niederlande, Israel 2007 Parallelstudium Freie Kunst, Fachklasse Fotografie, Prof. Dörte Eißfeldt, HBK Braunschweig 2004 Beginn des Studiums an der HBK Braunschweig, Kommunikationsdesign (Dipl.) bei Prof. Michael Ruetz und Prof. Gosbert Adler 2004 Abitur, Gymnasium Martineum, Halberstadt Ausstellungen 2017/18 Preis des Kunstvereins Hannover 20 Jahre Stadtmaler-Stipendium, Gaildorf Unisono, Eugeniusz Geppert Akademie Wroclaw, Polen Das Unsichtbare sichtbar | Blicke in die Asse, Westwendischer Kunstverein e. V., Gartow 2016 ALCHEMIE DES LICHTS, Raumstation, Bielefeld Kunst ist ein Transportproblem, Kunstverein Neue Galerie, Landshut DAS UNSICHTBARE SICHTBAR, Landesvertretung Niedersachsen, Berlin 2015 DUNKLER ALS WEISS HELLER ALS SCHWARZ, RWE Tower Dortmund (Solo) ORT UND IRRTUM, Galerie 52 – Folkwang Universität der Künste, Essen N_7 – ORT UND IRRTUM, Galerie BOHAI e. V., Hannover KUNSTBOX 2015 FOTOGRAFIE – Die Kunstmesse im Depot, Dortmund LICHT.LABOR, Steinhuder Merr – Insel Wilhelmstein (Solo) DER SCHMETTERLING UND DAS LICHT, Galerie Eichen- müllerhaus, Lemgo (Solo) Weiterreichung, kunstraum t 27 – Kunstverein Neukölln e. V., Berlin PLAKATIV IV, Galerie Altes Rathaus, Worpswede 2014/15 INTERFERENZEN, Galerie im Kornhaus, Kirchheim unter Teck (Solo) 2014 Offenes Atelier, Echternstr. -

Download Download
Downloaded from the Humanities Digital Library http://www.humanities-digital-library.org Open Access books made available by the School of Advanced Study, University of London ***** Publication details: Writing and the West German Protest Movements: The Textual Revolution by Mererid Puw Davies https://humanities-digital-library.org/index.php/hdl/catalog/book/writing- west-german-protest-movements DOI: 10.14296/0420.9780854572762 ***** This edition published 2020 by UNIVERSITY OF LONDON SCHOOL OF ADVANCED STUDY INSTITUTE OF MODERN LANGUAGE RESEARCH Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU, United Kingdom ISBN 978-0-85457-276-2 (PDF edition) This work is published under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. More information regarding CC licenses is available at https://creativecommons.org/licenses Writing and the West German Protest Movements The Textual Revolution imlr books Established by the Institute of Modern Languages Research, this series (fomerly known as igrs books) aims to bring to the public monographs and collections of essays in the field of modern foreign languages. Proposals for publication are selected by the Institute’s editorial board, which is advised by a peer review committee of 36 senior academics in the field. To make titles as accessible as possible to an English-speaking and multi-lingual readership, volumes are written in English and quotations given in English translation. For further details on the annual competition, visit: http://modernlanguages.sas.ac.uk/publications/igrs-books/ Editorial Board Professor Catherine Davies (Hispanic) Dr Dominic Glynn (French) Dr Katia Pizzi (Italian) Dr Godela Weiss-Sussex (Germanic) imlr books Volume 11 Volume Editor Dr Joanne Leal Writing and the West German Protest Movements The Textual Revolution by Mererid Puw Davies SCHOOL OF ADVANCED STUDY UNIVERSITY OF LONDON Institute of Modern Languages Research 2016 This book is published under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. -

Das 20. Jahrhundert 278
Das 20. Jahrhundert 278 Neue Fotobücher Antiquariat Frank Albrecht · [email protected] 69198 Schriesheim · Mozartstr. 62 · Tel.: 06203/65713 Das 20. Jahrhundert 278 D Verlag und A S Neue Fotobücher Antiquariat 2 Frank 0. J Albrecht A Inhalt H R Fotobücher ...................................................................... 1 H Register ......................................................................... 39 69198 Schriesheim U Mozartstr. 62 N Tel.: 06203/65713 D FAX: 06203/65311 E Email: R [email protected] T Die Abbildung auf dem Vorderdeckel USt.-IdNr.: DE 144 468 306 D zeigt eine Original-Fotographie Steuernr. : 47100/43458 A von Larry Fink, auf der Rückseite S numeriert und signiert (Katalognr. 81) 2 0. J A H Spezialgebiete: R Autographen und H Widmungsexemplare U Belletristik in Erstausgaben N Illustrierte Bücher D Judaica Kinder- und Jugendbuch E Kulturgeschichte R Kunst T Unser komplettes Angebot im Internet: Politik und Zeitgeschichte http://www.antiquariat.com Russische Avantgarde Sekundärliteratur D und Bibliographien A S Gegründet 1985 2 Geschäftsbedingungen 0. J Alle angebotenen Bücher sind grundsätzlich vollständig und, wenn nicht an- Mitglied im ders angegeben, in gutem Erhaltungszustand. Die Preise verstehen sich in Euro P.E.N.International A (€) inkl. Mehrwertsteuer. Das Angebot ist freibleibend; Lieferzwang besteht und im Verband H nicht. Die Lieferungen sind zahlbar sofort nach Erhalt. Der Versand erfolgt auf Deutscher Antiquare R Kosten des Bestellers. Lieferungen können gegen Vorauszahlung erfolgen. Es H besteht Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB bis zur vollständigen Bezah- lung. Dem Käufer steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht des Vertrages nach § U 361a BGB zu, das bei der Lieferung von Waren nicht vor dem Tag ihres Ein- Sparkasse Heidelberg N IBAN: DE87 6725 0020 gangs beim Empfänger beginnt und ab dann 14 Tage dauert. -

Steidl Kunst Fotografie Sachbuch Herbst 2014
Steidl Kunst Fotografie Sachbuch Herbst 2014 1 Steidl Kunst Fotografie Sachbuch Herbst 2014 — Editorial Inhaltsverzeichnis — — Das neue Programm des Steidl Verlags präsentieren 5 Raymond Depardon: Berlin wir Ihnen dieses Mal in drei Portionen: 7 Karl Lagerfeld: Choupette Den ersten Katalog haben Sie bereits erhalten, ein 9 Karl Lagerfeld: The Little Black Jacket Hardcover, in dunkelrotes Büttenpapier gebunden: 11 Horst von Harbou: Metropolis Darin finden Sie unsere literarischen Neuerscheinungen 13 Axel Hoedt: Fast Nacht und das Programm von L.S.D. 15 Lois Hechenblaikner: Hinter den Bergen Der zweite Katalog, in dem Sie jetzt gerade blättern, 17 Michael Ruetz: Die absolute Landschaft enthält unsere deutschsprachigen Kunst- und Foto- 19 Michael Ruetz: Family of Dog grafietitel und Sachbücher. 20 Manfred Heiting: Autopsie, Band 1 + 2 Der dritte, englischsprachige Katalog präsentiert unser 23 Robert Voit: New Trees internationales Kunst- und Fotografieprogramm. Wenn 25 Harf Zimmermann: Brand Wand Sie Interesse an dieser Vorschau haben, und sie bislang 27 Michael von Graffenried: Bierfest noch nicht erhalten haben, senden Sie uns bitte eine 29 Dirk Alvermann: schwarz auf weiss E-Mail an [email protected] (Buchhandel) oder an 31 Dirk Reinartz und Wolfram Runkel: Rheinhausen 1988 [email protected] (Presse). 33 Hagen Bonifer: Abschied. Im Gegenlicht 34 Ebert / Zell (Hg.): Klima Kunst Kultur Herzlich grüßt 35 Ebert / Grätz (Hg.): Menschenrechte und Kultur Ihr 37 Kehrbaum / Negt / Ostolski / Zeuner: Steidl Verlag Stimmen für Europa 39 Museum Folkwang (Hg.): Inspiration Japan 41 René Grohnert (Hg.): Think Big 43 Tobias Burg (Hg.): Von Andy Warhol bis Gerhard Richter 45 Museum Folkwang (Hg.): (Mis)Understanding Photography 47 Jim Dine: My Tools 48 Roland Scotti: Pendler zwischen den Welten Fotografie auf dem Umschlag aus Horst von Harbou: Metropolis (siehe Seite 11) Raymond Depardon, geboren 1942 in Villefranche-sur-Saône, ist Fotograf und Regisseur. -

Michael Ruetz
Nimbus. Kunst und Bücher Herbst 2017 Michael Ruetz 50 Jahre 1968 1968: Viele der Fotos, die das kollektive Bild ge - auch auf Fotos aus der ehemaligen DDR, aus Polen, dächtnis über diese Zeit ausmachen, stam men aus Auschwitz. Es ist ein einzigartiges Zeitpano - von Michael Ruetz: Rudi Dutschke am Mikrofon, rama, wie es kein anderer West-Fotograf in diesen die Demonstrationen nach Benno Ohne sorgs Tod, Jahren zeichnen konnte. Gudrun Ensslin mit Kinderwagen und Protestpla - Michael Ruetz hat in seinen Fotografien die Ge - katen. Es sind Bilder, die jeder kennt. 50 Jahre sichter der Menschen von damals gesucht, um sie später hat sich Ruetz die Frage gestellt: Habe ich in ihrer Individualität zu bewahren. Detailansich - eigentlich wirklich gesehen, was ich damals foto - ten, Blow-ups der von ihm gewählten Aus schnitte grafierte? Und sind die bekannten Aufnahmen lassen die uns die vertrauten Bilder in einer neuen auch die wesentlichen? Lesart erscheinen. Was in den groß gezeigten Ge - In den Bildern, die zwischen 1964 und 1974 ent - sichtern der Zuschauer, der Mitläufer, der Mit - standen, zeigt Michael Ruetz die Menschen, wie denker, der Streikenden, Kämpfenden in den sie ihm in den 1960er-Jahren begegneten – nicht 1960er-Jahre geschrieben steht, deutet sich der nur auf den Fotos 1968er der Revolution, sondern heutige Betrachter am besten selbst. Gegenwind Facing the Sixties Michael Ruetz, geb. 1940, hat bei Otto Steinert an der Folkwang-Schu le in Essen das Examen abgelegt, da - nach war er Mitglied der STERN- Re - daktion, Ver tragsautor der New York Graphic Society in Boston und Pro - fessor für Kommunikationsdesign. Er erhielt zahlreiche Preise, darunter den Preis der Villa Massi mo, den Otto-Steinert-Preis und andere. -

Ria Us a T Q .Com Mn
buchantiquariat Internet: http://comenius-antiquariat.com 113512 • Amelung, Heinz [Hrsg.], Lili in ihren Briefen. Leipzig: Insel-Verlag, [1919]. 61 Seiten, Datenbank: http://buch.ac Fraktursatz. Pappband (gebunden). CHF 10 / EUR 6.60 • Insel-Bücherei; 255. - Gebräunt, Rücken leicht A Q Wochenlisten: http://buchantiquariat.com/woche/ beschädigt, Buch schwach gewölbt. Kataloge: http://antiquariatskatalog.com A RI AGB: http://comenius-antiquariat.com/AGB.php 97384 • Ammann, Egon und Eugen Faes [Hrsg.], Literatur aus der Schweiz. Texte und Materialien. .COM M N US ! com Frankfurt: Suhrkamp, 1978. 538 Seiten mit Bio-Bibliographien und Literaturverzeichnis. Kartoniert. CHF T 16 / EUR 10.56 • suhrkamp taschenbuch; 450. - Anstreichungen Seite 38-46. 117217 • Ammann, Katharina und Christoph Vögele, Von ferne lässt grüssen. Schweizer Orientmalerei des 19. Jahrhunderts. Heidelberg: Kehrer, 2001. 120 Seiten mit Abbildungen. Pappband (gebunden). Grossoktav. CHF 35 / EUR 23.10 • Ausstellung Kunstmuseum Katalog Literatur- und Sprachwissenschaft Solothurn, 24.11.01 - 10.2.02. - Obere Ecke leicht bestossen. 104054 • Ammann, Paul, Der künstlerische Aufbau von Tacitus, Historien I 12-II 51 (Kaiser Otho). COMENIUS-ANTIQUARIAT • Staatsstrasse 31 • CH-3652 Hilterfingen Fax 033 243 01 68 • E-Mail: [email protected] Zürich: Leemann, 1931. 105 Seiten. Broschiert. Grossoktav. CHF 18 / EUR 11.88 • Bern, Philol. Diss. - Einzeltitel im Internet abrufen: http://buch.ac/?Titel=[Best.Nr.] Gebräunt. Stand: 14/03/2010 • 2754 Titel 94696 • Ammer, Karl, Einführung in die Sprachwissenschaft. Band 1. Halle: VEB Niemeyer, 1958. VIII, 212 Seiten. Leinen. Grossoktav. CHF 20 / EUR 13.20 85065 • Ackerknecht, Erwin, Gottfried Keller. Geschichte seines Lebens. 10.-14. Tausend. Leipzig: 63693 • Amrouche, Jean, Gespräche mit Paul Claudel. Heidelberg: Kerle, 1958. -

Four Quarters Volume 204 Number 1 Four Quarters (Second Series): Spring Article 1 1990 Vol
Four Quarters Volume 204 Number 1 Four Quarters (Second Series): Spring Article 1 1990 Vol. 4, No. 1 4-1990 Four Quarters (Second Series): Spring 1990 Vol. 4, No. 1 Follow this and additional works at: http://digitalcommons.lasalle.edu/fourquarters Recommended Citation (1990) "Four Quarters (Second Series): Spring 1990 Vol. 4, No. 1," Four Quarters: Vol. 204 : No. 1 , Article 1. Available at: http://digitalcommons.lasalle.edu/fourquarters/vol204/iss1/1 This Complete Issue is brought to you for free and open access by the University Publications at La Salle University Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Four Quarters by an authorized editor of La Salle University Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. |t)|€lO|Q| Quarter^ VOL. 4, NO. 1 Second Series SPRING, 1990 Four Dollars Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Lyrasis IVIembers and Sloan Foundation http://www.archive.org/details/fourquarters411990unse m€)\oo\<^our' Quarter^ VOLUME 4, NUMBER 1, SECOND SERIES SPRING, 1990 Table of Contents QUARTER NOTES Eugene Fitzgerald, Selective Indignation: Art and the Government Bill Wine, Rude Awakening John Lukacs, A Valley's Voyage Through Time 9 Nancy Fox, "Treadle" 16 Vincent Kling, A Conversation with Bobbie Ann Mason 17 Jack Hart, "Teaching Literature" 22 Jane Sathcr,"A Prayer in Four Seasons," "Death in Midwinter* 23-24 Sonya Senkowsky, Grandfather's Wake 25 David Curtis, "Creative Process," 27 "Mater Diminuendo" 28 Michael Toner, Phantom Soldiers 29 Claude Koch, "A Nurse Addresses Her Patron" 36 Mary Clearman Blew, The Snowies, The Judiths (short story) 37 Kairen Green. -

VITA SUSANN DIETRICH.Indd
VITA SUSANN DIETRICH *1984 Weißenfels, Deutschland Lebt und arbeitet in Halberstadt, Lemgo und Istanbul Mail [email protected] Tel + 49 (0) 1578 823 59 79 STUDIUM 2014 Meisterschülerabschluss Freie Kunst, Fachklasse Malerei, HBK Braunschweig 2013/14 Meisterschülerstudium Freie Kunst, Fachklasse Malerei, Prof. Wolfgang Ellenrieder, Hochschule für Bildende Künste Braunschweig 2012 Diplom Freie Kunst (mit Auszeichnung), Fachklasse Fotografie, HBK Braunschweig 2011 Reise- und Arbeitsstipendium in Istanbul, Türkei 2009/10 Studienaufenthalt an der Zürcher Hochschule der Künste im Departement Kunst Vertiefung Fotografie bei Prof. André Gelpke und Prof. Thilo König 2008/09 Studienaufenthalte in Brasilien, Spanien, Niederlande, Israel 2007 Parallelstudium Kunst, Fachklasse Fotografie, Prof. Eißfeldt, HBK Braunschweig 2004 Beginn des Studiums an der HBK Braunschweig, Kommunikationsdesign (Dipl.) bei Prof. Michael Ruetz und Prof. Gosbert Adler 2004 Abitur, Gymnasium Martineum Halberstadt AUSSTELLUNGEN 2016 DAS UNSICHTBARE SICHTBAR, Landesvertretung Niedersachsen, Berlin 2015 DUNKLER ALS WEISS HELLER ALS SCHWARZ, RWE Tower Dortmund (Solo) ORT UND IRRTUM, Galerie 52 – Folkwang Universität der Künste, Essen N_7 – ORT UND IRRTUM, Galerie BOHAI Hannover KUNSTBOX 2015 FOTOGRAFIE – Die Kunstmesse im Depot, Dortmund LICHT.LABOR, Steinhuder Merr – Insel Wilhelmstein (Solo) DER SCHMETTERLING UND DAS LICHT, Galerie Eichenmüllerhaus, Lemgo (Solo) Weiterreichung, kunstraum t27 – Kunstverein Neukölln e.V., Berlin PLAKATIV IV, Galerie Altes Rathaus, Worpswede -

New Books on Art and Culture
Presort Std | DIS U.S. Postage PAID T R I Minneapolis MN BU Permit No. 3723 T ED AR T PU DISTRIBUTED ART PUBLISHERS B LISH ER S , I NC . S P R I NG 2008 BOOK Distributed Art Publishers S ON AR bi-annual catalogue, the T AN source for international D C books on art, fashion, U L TU photography and design. R E It’s an art lover’s treasure. —S.S. Fair, NEW The New York Times BOOKS ON ART AND ISBN 978-1-933045-82-5 $3.50 CULTURE DISTRIBUTED ART PUBLISHERS, INC. 155 SIXTH AVENUE 2ND FLOOR NEW YORK NY 10013 WWW.ARTBOOK.COM SPRING 2008 Sharon Helgason Gallagher Credits Executive Director [email protected] Avery Lozada Vice President, Trade Sales Director [email protected] Front cover image: Marlene Dumas,“The Supermodel,” watercolor on paper, 26 x 19.75 inches, 1995. From Marlene Dumas: Catalogue Editor Yvonne Puffer Measuring Your Own Grave, published by The Museum of Contemporary Art, Los Angeles/D.A.P. Courtesy of The Museum of Cory Reynolds Vice President, Comptroller Modern Art, New York. Gift of Jan Christiaan Braun in honor of Marie-Josée Kravis. © 2007 Marlene Dumas. [email protected] Art Direction Jane Brown Back cover image: Luigi Ghirri,“Lucerne,” from Paesaggi di cartone (Cardboard Landscapes), 1971–72. From Luigi Ghirri: It’s Stacy Wakefield Forte Vice President, West/National Beautiful Here, Isn’t It..., published by Aperture. ©/Courtesy of the Estate of Luigi Ghirri. Accounts Director Image Production [email protected] Image on page 2 & 3: Andy Warhol: Catalogue Published on the Occasion of the Andy Warhol Exhibition at Moderna Cliff Borress Museet in Stockholm, February-March 1968, published by Steidl, page 9. -
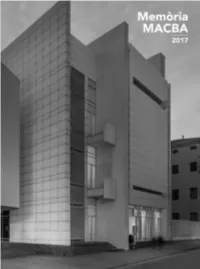
Macba Memoria2017 Cat.Pdf
Índex 5 Presentació 7 105 Centre d’Estudis i Documentació 109 A. Incorporacions 1 7 Òrgans de govern 111 B. Catalogació 9 A. Consell General 112 C. Consultes 10 B. Comissió Delegada 113 D. Difusió 114 E. Programa de suport a la 2 13 Pla Estratègic investigació 3 21 Exposicions 8 117 Comunicació 119 A. Premsa 4 35 Programes Públics i Educatius 122 B. Campanyes 37 A. Programes Públics 55 B. Programes Educatius 9 131 Patrocinis 66 C. Programa d’Estudis Independents (PEI) 10 139 Informació financera i de gestió 69 D. Ràdio Web MACBA 141 A. Pressupost 2017 70 E. Programa Amics del MACBA 144 B. Gestió 71 F. Accessibilitat 11 149 Públic 5 77 Col·lecció 151 A. Públic presencial 79 A. Incorporacions 155 B. Públic web i xarxes socials 81 B. Catalogació i manteniment del fons 12 159 Annexos 81 C. Difusió de la Col.lecció 161 A. Convenis i acords de col·laboració 86 D. Relacions amb altres centres i signats amb altres institucions i el institucions MACBA el 2017 88 E. Conservació i Restauració 167 B. Llistat d’altes i baixes a les 92 F. Projectes de recerca col·leccions del MACBA durant 93 G. Repositori digital el 2017 189 C. Llistat d’altes i baixes a l’Arxiu 6 95 Publicacions i la Biblioteca del MACBA durant el 2017 315 D. Pràctiques professionals per a estudiants MACBA EN XIFRES 7/8 90.189 Exposicions / Itineràncies Seguidors al Facebook 79 83.199 Activitats anuals Seguidors al Twitter (cursos, conferències, seminaris i d’altres) 5.248 136.064 Obres d’art Col·lecció Registre (Biblioteca i Arxiu) 259.679 2.015.530 Visitants Pàgines vistes (web) 5 Presentació Les accions durant l’any 2017 del Museu d’Art la sobrevisibilització dels drames humans sembla Contemporani de Barcelona han anat dirigides a generar immunitat davant d’aquests. -

Das 20. Jahrhundert 226
Das 20. Jahrhundert 226 Wolf von Niebelschütz – eine Sammlung sowie Kunst Teil 1 Antiquariat Frank Albrecht · [email protected] 69198 Schriesheim · Mozartstr. 62 · Tel.: 06203/65713 Das 20. Jahrhundert 226 D Verlag und A Wolf von Niebelschütz – eine Sammlung S Antiquariat sowie Kusnt Teil 1 2 Frank 0. J Albrecht A Inhalt H R Wolf von Niebelschütz .................................................. 1 H Kunst ............................................................................. 6 69198 Schriesheim U Register ....................................................................... 44 Mozartstr. 62 N Tel.: 06203/65713 D FAX: 06203/65311 E Email: R Die Abbildung auf dem Vorderdeckel [email protected] T zeigt eine Orig.-Farblithographie von Marc Chagall aus Katalognummer 137. USt.-IdNr.: DE 144 468 306 D Steuernr. : 47100/43458 A S 2 0. J A H Spezialgebiete: R Autographen und H Widmungsexemplare U Belletristik in Erstausgaben N Illustrierte Bücher D Unser komplettes Angebot im Internet: Judaica http://www.antiquariat.com Kinder- und Jugendbuch E Kulturgeschichte R Kunst T Politik und Zeitgeschichte Russische Avantgarde D Sekundärliteratur und Bibliographien A S Geschäftsbedingungen Gegründet 1985 2 Alle angebotenen Bücher sind grundsätzlich vollständig und, wenn nicht an- 0. ders angegeben, in gutem Erhaltungszustand. Die Preise verstehen sich in Euro J (€) inkl. Mehrwertsteuer. Das Angebot ist freibleibend; Lieferzwang besteht Mitglied im A nicht. Die Lieferungen sind zahlbar sofort nach Erhalt. Der Versand erfolgt auf P.E.N.International Kosten des Bestellers. Lieferungen können gegen Vorauszahlung erfolgen. Es und im Verband H besteht Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB bis zur vollständigen Bezah- Deutscher Antiquare R lung. Dem Käufer steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht des Vertrages nach § H 361a BGB zu, das bei der Lieferung von Waren nicht vor dem Tag ihres Ein- U gangs beim Empfänger beginnt und ab dann 14 Tage dauert.