Michiel De Ruyter in Der Ungarischen Erinnerung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Doktori (Ph.D.) Disszertáció
Doktori (Ph.D.) disszertáció Zachar Péter Krisztián Bécs versus Buda-Pest. Az 1848 őszi nyílt dinasztikus ellenforradalmi fordulat politikai-katonai háttere (október 4. – december 16.) 2005 Ph.D. disszertáció Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományok Doktori Iskola (D.Sc. Gergely Jenő) XIX-XX. századi magyar történeti program, XIX. századi magyar történelem alprogram Zachar Péter Krisztián Bécs versus Buda-Pest. Az 1848 őszi nyílt dinasztikus ellenforradalmi fordulat politikai-katonai háttere (október 4. – december 16.) Témavezető: Hermann Róbert Ph.D. Budapest, 2005 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék ................................................................................................................1 Köszönetnyilvánítás...........................................................................................................2 Rövid historiográfiai ismertetés.........................................................................................3 Bevezetés .........................................................................................................................15 I. Vészjósló helyzet..........................................................................................................27 II. Az 1848. október 3-i manifesztum és politikai-katonai következményei...................39 II. 1. A Lamberg-küldetés............................................................................................39 II. 2. Az október 3-i manifesztum megszületése .........................................................47 -

1848–1849 Traumájának Felidézése Az 1852-Es Császári Utazás Során 649
TÖRTÉNELMI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE LVII. ÉVFOLYAM, 2015. 4. SZÁM Szerkesztők TRINGLI ISTVÁN (felelős szerkesztő) FÓNAGY ZOLTÁN, OBORNI TERÉZ, PÓTÓ JÁNOS, ZSOLDOS ATTILA (rovatvezetők) GLÜCK LÁSZLÓ (szerkesztőségi munkatárs) Szerkesztőbizottság FODOR PÁL (elnök), BORHI LÁSZLÓ, ERDŐDY GÁBOR, GLATZ FERENC, MOLNÁR ANTAL, ORMOS MÁRIA, OROSZ ISTVÁN, PÁLFFY GÉZA, PÓK ATTILA, SOLYMOSI LÁSZLÓ, SZAKÁLY SÁNDOR, SZÁSZ ZOLTÁN, VARGA ZSUZSANNA A szerkesztőség elektromos postája: [email protected] TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK Weisz Boglárka: Ki volt az első kincstartó? A kincstartói hivatal története a 14. században 527 Tóth-Barbalics Veronika: A dualizmus kori főrendiház elnökei és alelnökei 541 Ábrahám Barna: Szlovák sajtó és kormányzati sajtópolitika a nagy háború évei alatt 565 Varga Zsuzsanna: Földreformok a II. világháború után Közép- és Kelet-Európában 583 MŰHELY Bácsatyai Dániel: Jogi műveltség, történetírás és kancellária a 14. századi Magyarországon 607 Vadas András: Terminológiai és tartalmi kérdések a középkori malomhelyek körül 619 Manhercz Orsolya: 1848–1849 traumájának felidézése az 1852-es császári utazás során 649 MÉRLEG A birodalmi toposzok rombolója (Vajnági Márta) 663 ÉLETMŰ Biográfi á(k)ban elbeszélni. H. Balázs Éva (1915–2006), a felvilágosodás korának kutatója (Krász Lilla) 671 MANHERCZ ORSOLYA 1848‒1849 traumájának felidézése az 1852-es császári utazás során Pajkossy Gábornak tisztelettel A megtorlás évei Az orosz csapatok segítségével -

Hadtörténelmi Közlemények 1998. 1.Sz
NAGY SÁNDOR KÉT AFFÉR A FELSŐ-TISZAI HADSZÍNTÉREN 1849 JANUÁRJÁBAN A Franz Schlik gróf altábornagy parancsnoksága alatt december óta Felső- Magyarországon működő cs. kir. csapatok 1849 januárjának derekán támadást indítottak a Tokaj előterében Debrecent fedező, Klapka György ezredes vezette magyar felső-tiszai hadtest ellen, hogy azt a Tiszán átdobva megteremtsék egy soron következő, a magyar kormány székhelyére összpontosított offenzíva feltételeit. A január 17-től Kassa körzetében gyülekező császári főerő – összesen mintegy 4– 5 000 fő, erős tüzérséggel – Schlik közvetlen vezényletével Abaújszántón, Tállyán, Mádon át nyomult előre Tarcal–Tokaj felé. Az ettől meglehetősen elszakadt balszárny – nagyjából 1000–1500 fő – Joseph Herzmanovsky őrnagy vezetésével január 21-én Sátoraljaújhelyen egyesült, majd Sárospatakot, Olaszliszkát érintve Bodrogkeresztúrnak irányozta menetét. A kibontakozó támadást Klapka ezredes először, a szántói elővéd- ütközetet (január 19.) követően, Tállya körül gondolta megállítani, de mivel balszárnyán problémák adódtak – Dessewffy Arisztid alezredes dandárja Szikszóról a Tisza mögé hátrált –,csapatait hamarosan a Tarcal–Bodrogkeresztúr–Tokaj háromszögbe vonta vissza és ott várta be az ellenség érkezését. A Mád irányából felbukkanó császári sereg, élén Schlik altábornaggyal, január 22-én délben ütközött a Tarcalnál állást foglalt, Jerzy Bułharyn ezredes vezette hadosztály előörseibe. Ezek, mivel a vidéket uraló sűrű ködben későn észlelték az ellenség közeledését, elkéstek a jelentéstétellel, így a hadosztály zöme még Tarcalon készülődött az ebédhez, amikor Joseph Edler von Fiedler vezérőrnagy első lépcsős dandárja már támadásra fejlődött fel. Szerencsére a kiszemelt állásban visszahagyott magyar egységek, csatárláncot képezve, hatásos tüzükkel képesek voltak mindaddig feltartóztatni Fiedler embereit, amíg a tarcaliak nagy nehezen úrrá lettek a meglepetésen és megkezdték pozícióik elfoglalását. Schlik a támadás elakadását követően a jobbszárnyán álló lovasság egy részét, az 1. -

Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Deníky Hraběte Františka
Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Deníky hraběte Františka Josefa Jindřicha Schlika Jitka Šedinová Diplomová práce 2010 University of Pardubice Faculty of Arts and Philosophy The diaries of count František Josef Jindřich Schlik Jitka Šedinová Thesis 2010 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré prameny a literatura, které jsem využila jsou uvedeny v seznamu pramenů a literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména ze skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněná ode mě požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně Univerzity Pardubice. V Turnově dne 29. 3. 2010 Poděkování Poděkování bych chtěla věnovat především vedoucí této práce, prof. PhDr. Mileně Lenderové, CSc., za její podporu a vstřícnost. Mé díky také patří pracovníkům SOA Zámrsk, SObA Jičín, Vojenskému historickému ústavu Praha, Vojenskému ústřednímu archivu Praha a Kriegsarchivu ve Vídni za zpřístupnění a vyhledání pramenné základny nutné pro vypracování této práce. Děkuji též mé kolegyni Bc. Pavle Janáčkové, rodině a přátelům za všestrannou pomoc, podporu a inspiraci. Souhrn Tato práce se zabývá deníky Františka Jindřicha Schlika, generála kavalérie, z let 1803 až 1809. Na základě výzkumu těchto deníků, dalších písemných pramenů a literuratury jsme rekonstruovali život tohoto šlechtice, žijícího v 19. století. -
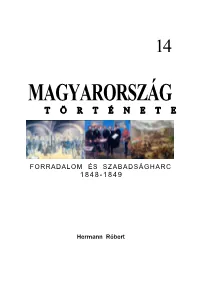
T Ö R T É N E
14 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1848-1849 Hermann Róbert HERMANN RÓBERT Forradalom és szabadságharc 1848-1849 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Hermann Róbert Főszerkesztő: Romsics Ignác Sorozatszerkesztő: Nagy Mézes Rita Képszerkesztő: Demeter Zsuzsanna A térképeket készítette: Nagy Béla A kötetet tervezte: Badics Ilona Kiadói programvezető: Szuba Jolanta Kiadói programkoordinátor: Winter Angéla A képek válogatásában részt vett: Vajda László Közreműködő intézmények: Budapesti Történeti Múzeum, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Országos Levéltár, Országos Széchényi Könyvtár, amelyek a sorozat képanyagát a rendelkezésünkre bocsátották. Egyéb források: Bencés Főapátság (Pannonhalma), Civertan, Hermann Róbert gyűjteménye, Magyar Képek Archívuma, MTI Fotók: Bakos Ágnes, Dabasi András, Kocsis András Sándor, László János, Mudrák Attila, Nagy Ferenc, Nagy Zoltán, Soós Ferenc, Szalatnyay Judit, Szelényi Károly, Szikits Péter, Tihanyi Bence ISBN 978-963-09-5692-5 Minden jog fenntartva © Kossuth Kiadó 2009 © Hermann Róbert 2009 Felelős kiadó Kocsis András Sándor a Kossuth Kiadó zRt. elnök-vezérigazgatója A kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének a tagja Műszaki vezető Badics Ilona Nyomdai előkészítés Veres Ildikó Korrektor Török Mária Képkidolgozás GMN Repró Stúdió A nyomtatás és a kötés a debreceni nyomdászat több mint négy évszázados hagyományait őrző Alföldi Nyomda zRt. munkája Felelős vezető György Géza vezérigazgató www.kossuth.hu / e-mail: -

Manhercz Orsolya Magas Rangú Hivatalos Utazások
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ MANHERCZ ORSOLYA MAGAS RANGÚ HIVATALOS UTAZÁSOK MAGYARORSZÁGON A BACH-KORSZAKBAN FERENC JÓZSEF MAGYARORSZÁGI LÁTOGATÁSAI 1849 ÉS 1859 KÖZÖTT Történelemtudományok Doktori Iskola Dr. Székely Gábor egyetemi tanár (DSc), a Doktori Iskola vezetője Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Program Dr. Erdődy Gábor tanszékvezető egyetemi tanár (DSc), a Doktori Program vezetője A bizottság tagjai és tudományos fokozatuk: Elnök: Dr. Erdődy Gábor tanszékvezető egyetemi tanár (DSc) Felkért bírálók: Dr. habil. Pajkossy Gábor egyetemi docens (CSc) Dr. Somogyi Éva (DSc) Titkár: Dr. G. Etényi Nóra egyetemi docens (CSc) Tagok: Dr. habil. Miru György egyetemi docens (CSc) Dr. habil. Deák Ágnes egyetemi docens (CSc), póttag Dr. Majoros István egyetemi tanár (DSc), póttag Témavezető: Dr. Gergely András egyetemi tanár (DSc) Budapest, 2012 2 Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás 8 Historiográfiai áttekintés 10 Saját kutatások 12 Az értekezés felépítése 14 Bevezetés 15 Az uralkodói utazás műfaja 15 A Habsburg-reprezentáció megosztottsága és különlegessége 17 Első fejezet 19 Ferenc József elődeinek utazásai 19 Néhány tipikus utazás 19 Kategorizálás 20 Az utazások mint az udvari propaganda eszközei 22 Az utazások mint a szimbolikus politika megnyilvánulásai 23 Az udvari reprezentáció szimbolikája 34 Második fejezet 37 Ferenc József utazásai 1830–1849 37 Ferenc József utazásai főhercegként 37 A fiatal császár első látogatásai Magyarországon 43 Harmadik fejezet 45 Változások a birodalomban és Magyarországon 1849 után 45 A magyar helyzet Albrecht főherceg levelei alapján 46 A Magyar Királyság 1851–1852-ben 50 Negyedik fejezet 53 Az 1852-es körút 53 Az utazás előkészületei 53 1. A program kialakítása 54 2. Az utazás végleges programja 60 3. A temesvári látogatás 63 4. -

Musicals in Post-Globalization: the Case of “Ever-Growing” Musicals from Vienna Via Japan
ReVisions Musicals in Post- Globalization: the Case of “Ever-Growing” Musicals from Vienna via Japan Rina Tanaka Published on: Mar 14, 2017 Updated on: Jan 04, 2018 ReVisions Musicals in Post-Globalization: the Case of “Ever-Growing” Musicals from Vienna via Japan 1. Introduction The end of the globalization era meant the beginning of new methods, regardless of regional predominance. Today, a new style of performances is coming from non-English-speaking countries even in the genre of musical, which is originally from English-speaking countries. However, it has been overlooked due to the commercial or even mass productive nature of musicals (McMillin 2006, pp. 28- 29), which has been a dominant pattern in musicals for decades[1]. How have musicals been changing in the post-globalization era? This paper analyzes the interactions established between Vienna and Japan by musicals since the 1990s as a possible illustration of the post- global theater. It consists of the following four parts. Section 1 presents two key concepts of this paper, “post-global” and “interweaving cultures in performances” as well as the current situation regarding musicals. Section 2 deals with the short history of musicals in Vienna in the post-war era until the launch of the first successful “Wiener [Viennese]” musical Elisabeth. As Vienna started taking its musical productions to the world, Japan was the first importer of Elisabeth. Section 3 considers two adaptations of Elisabeth in Japan as examples, indicating the reactions of other countries as well as Vienna, including the “re-import” phenomenon. After the great popularity of the Wiener musicals in Japan and the successive adaptations in the world, a new type of co-production developed in Japan. -

The Drink Tank
Cover—A Tribute to Sweeney Todd by Maurine Starkey!!! Page 3—Editorial by Alissa McKersie Page 4—My Favorite Musicals by Chris Garcia Art from Sheryl Birkhead Page 6—How a Boy from Albuquerque Came to Love Musicals by Ron Oakes Art by Sheryl Birkhead Page 10—Theatrical Problems by Bernadette Durbin Art by Chris Page 12—Jubilee: Around the World with Cole Porter and Moss Hart by Laura Frankos Page 18—First Broadway: First Date by Steven H Silver and Melanie Silver Photo courtesy Steven H Silver Page 22—The Rocky Horror Picture Show by Juan Sanmiguel Page 24—Regina Love Victorious by Jay Hartlove Photos courtesy Jay Hartlove (And remember to nominate The Mirror’s Revenge for Best Dramatic Presentation Short Form in 2019!) Page 25—Two Shades of Musicals by Richard von Busack Art by Michele Wilson Page 34—Musicals on the Far East End of Broadway by Kurt Erichsen Page 45—Teaneck Tanzi by Chris Page 47—Some Quick Shots from Ron Oakes Page 49—Galavant by Espana Sheriff Page 51—Musicals by Graham CHarnock Page 53—Gilbert & Sullivan & Murder: 10 Mysteries Set around G&S Productions By Petrea Mitchell When I was four-years-old, my mum took me to audition for my first musical, The Sound of Music. I knew the song I was supposed to sing, and we practiced in the restroom be- forehand. When it came time to sing in front of people, I really did NOT want to sing “Do-Re -Mi”. I wanted to sing “Twinkle, Twinkle”, and they let me. -

Hadmérnökök a Szabadságharcban
AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA Hadmérnökök a szabadságharcban KEDVES GYULA Török Ignác és a honvéd mérnökkar szervezése HAJAGOS JÓZSEF Török Ignác tevékenysége Komárom védelmének megszervezésében HERMANN RÓBERT Heinrich Hentzi, a budavári Leonidász BAJZIK LÁSZLÓ Adalékok gyulai Gaál Miklós 1848-1849- es honvédtábornok mérnöki tudásáról és műveltségéről KOVÁCS ISTVÁN , Lengyel mérnökkari tisztek a 28. evt. szabadságharcban 2013 2. szám Bemutatjuk Michael Brenner történészt Az AETAS történettudományi folyóirat. Megjelenik évente négy alkalommal. Kiadója az AETAS Könyv- és Lapkiadó Egyesület. A lap főként történeti tárgyú tanulmányokat, forrásokat, kritikákat, ismertetéseket, interjúkat közöl, de szívesen fogad írásokat a társadalomtudományok más ágaiból is. * Az AETAS megjelenését döntően alapítványi támogatás teszi lehetővé. Az AETAS több vagy akár egy száma is megrendelhető a szerkesztőség címén. A folyóirat előfizetési díja egy évre 4000 Ft. A lap ára egy szám megrendelése esetén 1000 Ft + postaköltség, könyvesboltban 1100 Ft. * Az AETAS-t a szerkesztőség terjeszti. A lap megvásárolható: Budapest: ELTE BTK könyvárus, VIII. ker., Múzeum krt. 6-8.; Gondolat Könyvesház, X. ker., Károlyi Mihály u. 16.; írók Boltja, Parnasszus Kft., VI. ker., Andrássy út 45.; Könyvtárellátó Kht., XIII. ker., Váci út 19. MNM Verano Könyvesbolt, V. ker. Magyar u. 40.; Párbeszéd Könyvesbolt, VIII. ker. Horánszky u. 20.; Teleki Téka, VIII. ker., Bródy Sándor u. 46. Szeged: Egyetemi könyvárus, Petőfi S. sgt.; Katedrális Bt., Sík Sándor Könyvesbolt, Oskola -

2020 “Vienna's the City, the Place to Become the Top of the Line.”
2020 “Vienna’s the city, the place to become the top of the line.” – Billy Joel – er ernitz Wu fan te d/S Boar urist To enna Vi © o ienna.inf .v www 2 Monika and Sylvester Levay and Gayle Berry- Zöchbauer granted us an exclusive look at their private apartments. They live in famous tourist destinations: Schönbrunn Palace and the MuseumsQuartier. We went to see them and talked about what it was like to live in a monument! And we have another special feature story for you: have you ever looked at a bee hive at close quarters? We will treat you to a fascinating insight into the colorful world of Vienna’s honey bees. And we tell you why these insects are so important for the city. And if bees could talk, they would surely agree that Vienna is the world’s most livable city. Dear reader, If anyone still needs convincing, in this Vienna Journal we share ten good reasons why the city deserves the title. It’s not for nothing that in 2019 There’s music in the air. And there is no better air the international consultants at Mercer named the for it than in Vienna, the Capital of Music – this was Austrian capital the most livable city in the world also clear to Ludwig van Beethoven, who selected for the tenth year in a row! In another coup for the Austrian capital as his new home in 1792 before Vienna, respected UK magazine The Economist rising to stardom in the city. 2020 will mark the named us ‘The World’s Most Liveable City’ for the 250th anniversary of his birth. -

Pre-Owned 1970S Sheet Music
Pre-owned 1970s Sheet Music 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 PLEASE NOTE THE FOLLOWING FOR A GUIDE TO CONDITION AND PRICES PER TITLE ex No marks or deterioration Priced £15. good As appropriate for age of the manuscript. Slight marks on front cover (shop stamp or owner's name). Possible slight marking (pencil) inside.Priced £12. fair Some damage such as edging tears. Reasonable for age of manuscript. Priced £5 Album Contains several songs and photographs of the artist(s). Priced £15+ condition considered. Year Year of print.Usually the same year as copyright (c) but not always. Photo Artist(s) photograph on front cover. n/a No artist photo on front cover LOOKING FOR THESE ARTISTS?You’ve come to the right place for The Bee Gees, Eric Clapton, Russ Conway, John B.Sebastian, Status Quo or even Wings or “Woodstock”. Just look for the artist’s name on the lists below. 1970s TITLE WRITER & COMPOSER CONDITION PHOTO YEAR $7,000 and you Hugo & Luigi/George David Weiss ex The Stylistics 1977 ABBA – greatest hits Album of 19 songs from ex Abba © 1992 B.Andersson/B.Ulvaeus After midnight John J.Cale ex Eric Clapton 1970 After the goldrush Neil Young ex Prelude 1970 Again and again Richard Parfitt/Jackie Lynton/Andy good Status Quo 1978 Bown Ain‟t no love John Carter/Gill Shakespeare ex Tom Jones 1975 Airport Andy McMaster ex The Motors 1976 Albertross Peter Green fair Fleetwood Mac 1970 Albertross (piano solo) Peter Green ex n/a ©1970 All around my hat Hart/Prior/Knight/Johnson/Kemp ex Steeleye Span 1975 All creatures great and Johnny -

Heroji FINAL.Indd 1 23.9.2013 9:18:29 Heroji FINAL.Indd 2 23.9.2013 9:18:29 Heroji FINAL.Indd 3
Heroji_FINAL.indd 1 23.9.2013 9:18:29 Heroji_FINAL.indd 2 23.9.2013 9:18:29 Heroji in slavne osebnosti na Urednik: Božidar Jezernik Slovenskem Ljubljana 2013 Heroji_FINAL.indd 3 23.9.2013 9:18:29 Heroji in slavne osebnosti na Slovenskem Zbirka: Zupaničeva knjižnica, št. 38 (ISSN 1855-671X) Urednik: Božidar Jezernik Lektorica: Danijela Tamše Uredniški odbor zbirke: Mojca Bele, Jože Hudales, Božidar Jezernik, Boštjan Kravanja, Mirjam Mencej, Rajko Muršič, Jaka Repič Fotografija na naslovnici: Božidar Jezernik Recenzenta: Boštjan Kravanja, Jaka Repič Imensko in stvarno kazalo: Sara Špelec © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2013. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je prepovedano repro- duciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev, dajanje na voljo javnosti (internet), predelava ali vsaka druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Odstranitev tega podatka je kazniva. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Za založbo: Branka Kalenić Ramšak, dekanja Filozofske fakultete Izdal: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Ljubljana, 2013 Naklada: 400 izvodov Zasnova zbirke: Mojca Turk Oblikovanje in priprava za tisk: Jure Preglau Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Cena: 24,90 EUR Publikacija Heroji in slavne osebnosti na Slovenskem je nastala v okviru projekta Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi (J6-5558, 2013–2016, vodja: Božidar Jezernik), ki ga omogoča Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 929(=163.6)(082) HEROJI in slavne osebnosti na Slovenskem / glavni ured- nik Božidar Jezernik ; [imensko in stvarno kazalo Sara Špelec].