Korrekturen Umsetzungskonzep
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bildungskatalog 2019/2020 Unter Finden Sie Die Regelmäßig Aktualisierte Version Des Bildungskatalogs 2019/2020
Bildungskatalog 2019/2020 Unter www.steyrland.at/bildungskatalog finden Sie die regelmäßig aktualisierte Version des Bildungskatalogs 2019/2020. Sie können uns gerne jederzeit Ihr Bildungsangebot senden, an E-Mail: [email protected] Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Verein zur Förderung eines Technologie- und Dienstleistungszentrum Ennstal • c/o TDZ Ennstal GmbH • Eisenstraße 75 • 4462 Reichraming • Austria • Sprecher der Initiative „steyrland – wir rocken die region!“ MMag. Johannes Behr-Kutsam • Ansprechpartnerin für den Bildungskatalog: Karin Fachberger, [email protected], Tel.: 0664 8241139 • Fotos Cover: 7 x Shutterstock • Druck: Mittermüller • Idee, Konzeption und Artwork: Kommhaus Bad Aussee, www.kommhaus.com • Vorbehaltlich Änderungen, Irrtümer und Druckfehler • Genderhinweis: Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Aufgrund der Lesbarkeit der Texte wird bei Bedarf nur eine Geschlechtsform gewählt. Dies impliziert keine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Editorial Die Initiative steyrland – wir rocken die Region! macht Steyr-Land noch attraktiver – für Unternehmen, Gemeinden, Vereine, Bildungseinrichtungen und Familien. Zahlreiche Projekte unterstreichen die Bedeutung des Wirtschaftsstandorts Steyr-Land. Nach dem Erfolg der ersten Auflage konnten wir in dieser zweiten Auflage unser Bildungsangebot erweitern. 58 regionale Betriebe, Bildungseinrich- tungen, Gemeinden, Verbände und Vereine laden mit mehr als 90 Angeboten Schülerinnen und Schüler ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Sie bieten den jungen Menschen kostenlos und mit persönlicher Betreuung die Gelegenheit, verschiedene Bereiche der regionalen Wirtschaft schon © Susanne Weiss frühzeitig kennenzulernen. Johannes Behr-Kutsam (2. v. l.), Sprecher der Initiative mit seinen Stellvertretern Martin Hartl, Judith Ringer und Alois Gruber (v. l.). Nicht im Bild: Peter Guttmann Die Schülerinnen und Schüler können so in unterschiedliche Branchen hilfe für den weiteren Karriereweg. -

Haflinger- Markt Weyer
HAFLINGER- MARKT WEYER Samstag, 1. Oktober 2011 1 Liebe Beschicker und Besucher des dies- jährigen Haflingermarktes! Einer der traditionellsten Pferdemärkte in Oberösterreich findet zur Freude aller Züchter und Pferdeliebhaber am 1.Okto- ber wieder statt! Ich bedanke mich ganz besonders bei den Verantwortlichen für die mühevolle Vor- bereitung und Durchführung! Durch das gute Zusammenwirken von Gemeinde, Zuchtverband und Pferdehof Krenn/Edtbauer erleben wir sicher auch heuer wieder eine tolle Präsentation der beliebten Pferde, verschiedener Rassen! Auch den Züchtern, Besitzern und allen Mitwirkenden sei herzlich ge- dankt! Erst seit den von Pferd Austria in Auftrag gegebenen und nun vorlie- genden Studien über den sozialen, wirtschaftlichen und touristischen Wert der Pferdewirtschaft in Österreich ist die Bedeutung des Pferdes ins richtige Licht gerückt worden! Nun ist auch der Öffentlichkeit be- wusst, wie wichtig das Pferd heute vorwiegend im Freizeitbereich und dem Sport ist! Als Obmann der österreichischen Pferdezucht freue ich mich auf den Haflingermarkt und wünsche allen Beschickern und den Besuchern sehr viel Freude! Herzliche Grüße KommR Wolfgang Schürrer 2 Liebe Besucherinnen, liebe Besucher des Haflingermarktes in Weyer! Der Reiterhof Krenn/Edtbauer ist mit seinen Anlagen der ideale Austragungs- ort des Weyrer Haflingermarktes. Bereits zum vierten Mal wird dieser traditionelle Markt am neu adaptierten Gelände beim Edtbauer abgehalten. Eine lange Tradition verbindet diesen Erbhof mit dem Haflinger und die Familie Krenn ermöglicht vielen Pferdesportlern das ganze Jahr über die Ausübung ihres Hobbys. Die Bedeutung des Haflingers hat in den letzten Jahren laut einigen Studien als Sport- und Freizeitpartner wieder stark zugenommen. Die Aktion JUGEND UND PFERD führt Kinder und Jugendliche an den verantwortungsvollen Umgang, die Haltung und die Zucht von Pfer- den heran. -
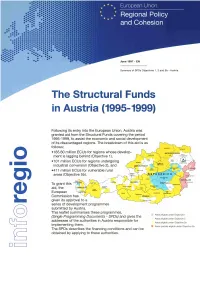
Inforegio June 1997
European Union ····· 2*2········*· •·2··Σ·ΣΣ· •ζ·· •Σ·:·3: •·ϊ·\ •Î:;·:·:·:·:·Σ·Σ·Σ· Regional Policy ·Σ·Σ·Σ·.•Σ·«ϊ :Σ:· and Cohesion 2·ί· ·Σ·5···5« .5:·: Σ .·:.:: ·Ζ··· ··:·; :·; ··· ··· ··· ··· ··· •ι·;· ······ ·!·Ϊ·ί • ··· ···Σ·Σ·Σ· •Σ·ϊ· ·Σ****· * ·Σ·Σ·Σ·· : ·Σ·Σ··! June 1997 - EN Summary of SPDs Objectives 1, 2 and 5b - Austria The Structural Funds in Austria (1995-1999) Following its entry into the European Union, Austria was granted aid from the Structural Funds covering the period 1995-1999, to assist the economic and social development of its disavantaged regions. The breakdown of this aid is as follows: • 165.60 million ECUs for regions whose develop ment is lagging behind (Objective 1), •101 million ECUs for regions undergoing industrial conversion (Objective 2), and •411 million ECUs for vulnerable rural areas (Objective 5b). To grant this aid, the European Commission has given its approval to a series of development programmes submitted by Austria. This leaflet summarises these programmes, (Single Programming Documents - SPDs) and gives the Areas eligible under Objective 1 Areas eligible under Objective 2 addresses of the authorities in Austria responsible for Areas eligible under Objective 5b implementing them. Areas partially eligible under Objective 5b The SPDs describes the financing conditions and can be obtained by applying to these authorities. α Eligible areas The Burgenland ¡s ¡n Eastern Austria and Burgenland borders on the Slovak Republic, Hungary and Slovenia. It has a surface area of 3 966 km2 and a population of 270 880. Objective ι Nordburgenlaríd Average GDP in the Burgenland is well below the Austrian GDP. -

Leuchtende Kinderaugen Bei Der Sandkistenaktion Des ÖAAB Ternberg
Ausgabe 01 /201 7 © R. Kohlbauer Leuchtende Kinderaugen bei der Sandkistenaktion des ÖAAB Ternberg >> Der Vizebürgermeister informiert >> Stelzer ist neuer Landeshauptmann >> Freitagsprojekt in der Volksschule >> Aus den Vereinen 2 BLICKPUNKT Geschätzte Ternbergerinnen und Ternberger, geschätzte Trattenbacherinnen und Trattenbacher! nformiert: Vizebürgermeister i Der Foto: E. Ahrer sammlungen vieler ortsan- "Vereins-/Ehrenamtoholic" ver- Nach dem doch sehr strengen sässiger Vereine und Organisa- bringen können. Alfred hat mir Winter hat sich der Frühling tionen sind in den letzten Mona- erzählt, dass er jetzt mehr Zeit durchgesetzt und die Garten- ten über die Bühne gegangen. Bei für sich und seine Lieben hat und saison ist voll im Laufen. In vielen all den Terminen wird immer wie- das auch genießt. Ich danke ihm Gesprächen habe ich vernom- der eines deutlich: Es gibt Gott nochmals für seinen jahrelangen men, dass bei Vielen die Sorge sei Dank eine Vielzahl an Men- Einsatz und wünsche ihm viele besteht, der Winterdienst und die schen in unserem Ort, die ihre schöne, nun stressfreie Stunden Salzstreuung würden mit über- Freizeit dem Gemeinwohl und im Kreise der Familie, Freunde mäßigem Aufwand durchgeführt. Ehrenamt widmen. Daher freut und natürlich in den Vereinen in Vor allem in Richtung Salzstreu- es mich besonders, dass ich am denen er tätig ist. ung kann ich hier die Gemüter Trattenbacher Ostermarkt den Es ist gut zwei Jahre her, als ich beruhigen - für Interessierte "pensionierten" langjährigen Ob- Mag. Thomas Stelzer zum ersten habe ich mir beim Unternehmen mann des Museumsdorfes - Mal persönlich getroffen habe. Hubert Großtessner-Hain die Alfred Luidold - zuversichtlich An Thomas Stelzer schätze ich verwendetet Salzmenge pro m² und voller Tatendrang für seine besonders seine Besonnenheit zeigen lassen. -

Federal Waste Management Plan 2017 Part 1 Imprint
FEDERAL WASTE MANAGEMENT PLAN 2017 PART 1 IMPRINT IMPRINT Media owner and publisher: FEDERAL MINISTRY FOR SUSTAINABILITY AND TOURISM Stubenring 1, 1010 Wien bmnt.gv.at Text and editorial team: Section V Picture credits – Part 1: Special thanks to all organisations having provided pictures! Mag. Stefanie Grüssl/BHÖ – Thanks to the Airborne Police of the Austrian Federal Ministry of the Interior: p. 12, p. 26, p. 131, p. 137, p. 169 Court of Justice of the European Union (G. Fessy©CJEU): p. 15 European Commission: p. 19 TINA Vienna GmbH: p. 34 NUA Abfallwirtschaft GmbH - A company of the Brantner group: p. 36, p. 119 Ecobat Technologies: p. 67 Pixabay.com: p. 128, p. 150, p. 243, p. 245, p. 277 bottom, p. 281 OECD (Michael Dean): p. 193 BALSA GmbH: p. 81, p. 293, p. 296, p. 297, p. 300 Büro Pieler ZT GmbH: p. 301 Pöttinger Entsorgungstechnik GmbH: p. 103 Bioenergie Schlitters GmbH: p. 220 Verwertungsanlage Schöcklland Erde Handels GmbH: p. 105, p. 120 Seiringer Umweltservice GmbH: p. 104 Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H.: p. 102, p. 221 Municipal Department 48 – City of Vienna: © Felicitas Matern: p. 57, p. 154, p. 215 UBA: p. 83, p. 109, p. 117, p. 284, p. 298 Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management: p. 17, p. 23, p. 29, p. 31, p. 39, p. 43, p. 45, p. 46, p. 54, p. 61, p. 66, p. 68, p. 69, p. 75, p. 80, p. 84, p. 86, p. 88, p. 90, p. 93, p. 98, p. 108 top, bottom, p. -

Official Journal C 394 Volume 37 of the European Communities 31 December 1994
ISSN 0378-6986 Official Journal C 394 Volume 37 of the European Communities 31 December 1994 Information and Notices English edition Notice No Contents Page I Information European Economic Area Standing Committee of the EFTA States 94/C 394/01 List of credit institutions authorized in Austria, Finland , Iceland , Norway and Sweden provided for in Article 3 ( 7 ) of Directive 77/780/EEC 1 Price: ECU 18 31 . 12 . 94 Official Journal of the European Communities No C 394/1 I (Information) EUROPEAN ECONOMIC AREA STANDING COMMITTEE OF THE EFTA STATES List of credit institutions authorized in Austria, Finland, Iceland, Norway and Sweden provided for in Article 3 ( 7 ) of Directive 77/780/EEC ( 94/C 394/01 ) General Articles 3 ( 7 ) and 10 ( 2 ) (*) of First Council Directive 77/780/EEC of 12 December 1977 on the coordination of laws , regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of credit institutions ( 2 ) require the Commission to draw up and publish a list of all credit institutions authorized to do business in Member States . Paragraph 6 ( b ) of Protocol 1 to the EEA Agreement requires that facts , procedures, reports and alike regarding the EFTA States shall be published in a separate section of the Official Journal of the European Communities when corresponding information is to be published regarding the EC Member States . This is the first occasion on which the Standing Committee of the EFTA States complies with the abovementioned requirement, in accordance with paragraph 6 ( b ) of Protocol 1 to the EEA Agreement and Article 1 ( 1 ) ( b ) of Protocol 1 to the Agreement on a Standing Committee of the EFTA States . -

Steyrer £Ntomologenrunde Steyr, Am 14.10.1961 Abschlußbericht
© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at Steyrer £ntomologenrunde Steyr, am 14.10.1961 ABSCHLUßBERICHT • über die Fangsaison des Jahres 1961 1.) Durchgeführte Excursionen (Köder-, Licht- und Tagfang) Angeregt durch die in Arbeit befindliche iandesfauna, wurde auch im heurigem ^ahr wiederum verstärkt dem Schmetterlings- fang nachgegangen. So können wir wieder auf eine stolze Reihe von Excursionen-zurückblicken. Der Erfolg wäre vielleicht • noch höher ausgefallen, wenn nicht Kollege Deschka aus beruf- lichen Gründen und bedingt durch Krankheit (31inddaimoperation) seine Tätigkeit stark einschränken hätte müssen. Der zweite "Pechvogel" wenn man so sagen darf, war Kollege Wesely, der. durch Wohnungsangelegenheiten stark an Fang behindert war und sich daher auf die Anfertigung von 4-0 Insektenkassetten verlegte Daß es uns aber trotzdem gelang, wieder an das Vorjahr "anzu- knüpfen" ja sogar zahlenmäßig zu übertreffen, ist vor allem als Verdienst unseres nimmermüden, dafür aber auch von besonderem Erfolg begünstigtem Samraelfreund. Kremslehner zu werten. Die Excursionen verteilen sich wie folgt : . Kremslehner 60 Excursionen (davon etwa 40' Lichtfang- abende) in Ehnstal, St# Yalentin_u. Arbe sbach", _ N • ö • Göstl 30 X^avon 14 mal Paukenrraben bei Ternberg, 3 nial Schober- stej.n_ji_?__l_mal_>ro ckgebiest)__ Wesely 21 mm n "CLaüssa, Mühlbach, Brunnen- • 8chutzgebiet Steyr) Hofmann 20 mm n XArbesbach, N.Ö•, Hoserboden und_ Veißsee, Salzburg Lichteriberger 15 Xclavon Kleinreifling und Nockgebiet) " * . Heim 15 .» It "(davon 4 Excursionen im Bur- genland; Göls. Neusiedl a.See 1 mal_in Linz; Mayrhofer 15 _ II (davon 3 Wochen, in Spanien) • Deschka, etwa 10 mm * (Fang u.Urlaub am Moserboden und__Wei3see, Salzburg) Müllner 10 _ M Tin Steyr und Paukengraben b. -

Presse-Protokoll Drucken
Protokoll 17.11.2019 - Abschnitt 1 Seite 1 12:54 Bezirksschwimmen 2019 11.11.2018 Bewerb 1 - 25m Brust Damen Bambini II weiblich (Jhg. 2013) 1. Gröbl, Olivia 2013 AUT Losenstein 00:31,62 2. Obermaier, Anna 2013 AUT Losenstein 00:34,63 3. Buchberger, Sophia 2013 AUT Ternberg 00:38,38 4. Dreier, Heidi 2013 AUT Gaflenz 00:41,53 5. Hollnbuchner, Sofia 2013 AUT Garsten 00:55,56 6. Maderthaner, Julia 2013 AUT Losenstein 01:00,94 Kinder I weiblich (Jhg. 2012) 1. Löser, Emilia 2012 AUT Ternberg 00:32,79 2. Stöllnberger, Luisa 2012 AUT Ternberg 00:33,24 3. Zopf, Ella 2012 AUT Losenstein 00:47,00 Kinder III weibich (Jhg. 2010) 1. Löser, Helene 2010 AUT Ternberg 00:29,28 2. Penkova, Viktoria 2010 AUT Reichraming 00:40,60 ---- Peterseil, Hannah 2010 AUT Losenstein n.a.Start ! Gäste Kinder I- III weiblich (Jhg. 2009 u. jünger) 1. Kleinhagauer, Sophia 1601 Gäste 00:53,62 Bewerb 2 - 25m Brust Herren Bambini I männlich (Jhg. 2014 und jünger) 1. Ahrer, Nicolas 2014 AUT Aschach an der Steyr 00:41,42 2. Zeilermayr, Jonas 2014 AUT Losenstein 01:05,25 Kinder I männlich (Jhg. 2012) 1. Ecker, Jonas 2012 AUT Losenstein 00:44,41 Kinder II männlich (Jhg. 2011) 1. Salzer, Joshua 2011 AUT Aschach an der Steyr 00:34,29 2. Rogger, Matthias 2011 AUT Losenstein 00:38,69 Kinder III männlich (Jhg. 2010) 1. Steindler, Christoph 2010 AUT Laussa 00:31,12 Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2017.1008. ASVOE-SV-Losenstein - Sektion Schwimmen Protokoll 17.11.2019 - Abschnitt 1 Seite 2 12:54 Bezirksschwimmen 2019 11.11.2018 Bewerb 3 - 50m Brust Damen Schüler I weiblich (Jhg. -

Schiedlberg R D B O September H .Kutsam.A E E a D Ortsreportage L N N L Ab Seite14 E D T D
Steyr Ortsreportage Schiedlberg ab Seite 14 12.09.2018 / KW 37 / www.tips.at Oktoberfest Die kleine Gemeinde Schiedlberg wird am 14. und 15. September wieder zu Oberösterreichs Party- hochburg. Wie jedes Jahr geben die Veranstalter auch heuer eine Stimmungsgarantie ab. Seite 14 / Foto: Nina Danninger 51.254 Stk. | OÖ 674.842 Stk. | Gesamt 1.021.906 Stk. | RedaktionRekordumsätze +43 (0)72 52 / 711 45 in den Freibädern Seite 4 Österreichische Post AG | RM 02A034591K | 4010 Linz age |Steyr Aufl www.kutsam.at BAD HALL MODE TTRENDREND 22. und 23. September 2018 AABENDBEND AB 18:30 EINTRITT www.kollmitzberger-kirtag.at Freitag, FREI 28. September 2 Regionales Land & Leute Steyr 37. Woche 2018 BILdunGSReFORM Schuljahr startet mit Änderungen ReGIOn SteYR. Diese Woche noch Schüler rauchen. Auch Eltern ging auch in Oberösterreich der oder andere Personen dürfen, so- Schulalltag wieder los. Neue Re- fern sie sich auf dem Schulgelän- gelungen treten in Kraft. de be nden (bei Elternsprechtagen oder Ähnlichem), nicht zur Ziga- von DANIEL LEITNER rette greifen. Klassen, die dazu dienen, die Kin- Steyr schon länger rauchfrei der und Jugendlichen durch einen Rauchverbote sind auch vor der Bil- massiven Deutschschwerpunkt dungsreform an den Steyrer Schulen besser zu integrieren, Kataloge keine Seltenheit gewesen. „Mittels zur Beurteilung der Reife für den eines Beschlusses des Schülerpar- Schuleintritt und härtere Strafen laments wurde das Rauchverbot für Schulschwänzer sind nur eini- am Schulgelände bei uns schon vor ge der Änderungen, die durch die zwei Jahren beschlossen“, sagt bei- neue Bildungsreform in Kraft tre- spielsweise Franz Reithuber, Direk- ten. Eine andere Neuerung ist das Ab sofort darf auf dem gesamten Schulgelände nicht mehr geraucht werden. -
Cretaceous Ammonites from Upper Austria 59-79 © Biologiezentrum Linz/Austria; Download Unter
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Denisia Jahr/Year: 2014 Band/Volume: 0032 Autor(en)/Author(s): Lukeneder Alexander Artikel/Article: Cretaceous ammonites from Upper Austria 59-79 © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Cretaceous ammonites from Upper Austria A. LUKENEDER Abstract: Lower Cretaceous ammonite faunas from Upper Austria are presented. Lithological, sedimentological and palaeoeco- logical studies over the last decade of the Lower Cretaceous (Northern Calcareous Alps, Upper Austria) uncovered rich spectra of Valanginian-Barremian ammonites. Distinct ammonite faunas derive from limestones, marls and sandstones of well know tec- tonical nappes from Upper Austria (e.g. Ternberg Nappe, Reichraming Nappe, Staufen-Höllengebirgs Nappe, Langbath Unit). The main sections are, from north to south, the KB1-A Klausrieglerbach 1 section (Schrambach Formation), the KB1-B Klaus- rieglerbach 2 section (Schrambach Formation), the Hirner section (Schrambach Formation), the Eibeck Section (Rossfeld For- mation), the Hochkogel section (Rossfeld Formation), the Traunkirchen section (Tannheim Formation) and the Kolowratshöhe section (Rossfeld Formation). Thousands of ammonite specimens were collected, prepared and described. The ammonite assemblages clearly indicate a Mediter- ranean character with intermittent short pulses of Boreal immigrants. The composition of the ammonite assemblages is clearly linked -
Dietach Garsten Großraming Sierning Ternberg Waldneukirchen Weyer
Dietach Großraming Reichraming Garsten Bad Hall . Das Zuhause ist der wichtigste Platz auf der Zuhause ist dort, wo man sich wohl fühlt. Welt. Das Betreubare Wohnen ist eine zusätzliche Im Bezirk Steyr-Land wird in 11 Gemeinden Der Großteil der älteren Menschen möchte in Alternative zu den bestehenden Angeboten Betreubares Wohnen angeboten. In den einer. vertrauten Umgebung, am liebsten in der Betreuung zu Hause bzw. in einem Alten- Gemeinden Bad Hall, Dietach, Gaflenz, den eigenen vier Wänden, ihren Lebensabend und Pflegeheim. Bei bestimmten Garsten, Großraming, Reichraming, Sierning, verbringen. Sie wünschen sich Pflegesituationen wird jedoch eine Ternberg, Waldneukirchen, Weyer und Wohnmöglichkeiten, bei denen eine aktive Übersiedlung in ein Heim erforderlich sein. Wolfern stehen insgesamt 116 Wohnplätze zur Lebensgestaltung verbunden mit einem Verfügung. Höchstmaß an Betreuung und Sicherheit gegeben ist. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner in diesen Wohnungen sind zwischen 65 und 75 Mit dem Betreubaren Wohnen geht der Jahre alt und beim Einzug noch rüstig. Das Bezirk Steyr-Land auf die speziellen Interesse an diesem selbstständigen Wohnen Bedürfnisse und Wünsche der Seniorinnen ist sehr groß, da es mit der Sicherheit und Senioren ein. Ziel ist es, älteren verbunden ist, bei Bedarf Hilfe zu erhalten. Menschen in ihrem gewohnten sozialen Umfeld adäquate Wohnmöglichkeiten und Gaflenz professionelle Hilfe zu bieten. Sierning Ternberg Weyer Wolfern Waldneukirchen Die Leistungen des Betreubaren Wohnens umfassen: x altersgerechtes Wohnen, d.h. eine zentral gelegene, barrierefreie und behindertengerecht gestaltete Kleinwohnung (50m²) Anmeldung für das Betreubare Wohnen: x 24-Stunden-Betreuungssicherheit (Rufhilfe) Die Anmeldung für das Betreubare Wohnen ist bei der Standortgemeinde oder Ihrer x soziale Betreuung durch eine fachlich Heimatgemeinde möglich. -
Austrian Museum in Linz (Austria): History of Curatorial and Educational Activities Concerning Molluscs, Checklists and Profiles of Main Contributers
The mollusc collection at the Upper Austrian Museum in Linz (Austria): History of curatorial and educational activities concerning molluscs, checklists and profiles of main contributers E r n a A ESCHT & A g n e s B ISENBERGER Abstract: The Biology CentRe of the UppeR AuStRian MuSeum in Linz (OLML) haRbouRS collectionS of “diveRSe inveRtebRateS“ excluding inSectS fRom moRe than two centuRieS. ThiS cuRatoRShip exiStS Since 1992, Since 1998 tempoRaRily SuppoRted by a mol- luSc SpecialiSt. A hiStoRical SuRvey of acceSSion policy, muSeum’S RemiSeS, and cuRatoRS iS given StaRting fRom 1833. OuR publica- tion activitieS conceRning malacology, papeRS Related to the molluSc collection and expeRienceS on molluSc exhibitionS aRe Sum- maRiSed. The OLML holdS moRe than 105,000 RecoRded, viz laRgely well documented, about 3000 undeteRmined SeRieS and type mateRial of oveR 12,000 nominal molluSc taxa. ImpoRtant contRibuteRS to the pRedominantly gaStRopod collection aRe KaRl WeS- Sely (1861–1946), JoSef GanSlmayR (1872–1950), Stephan ZimmeRmann (1896–1980), WalteR Klemm (1898–1961), ERnSt Mikula (1900–1970), FRitz Seidl (1936–2001) and ChRiSta FRank (maRRied FellneR; *1951). Between 1941 and 1944 the Nazi Regime con- fiScated fouR monaSteRieS, i.e. St. FloRian, WilheRing, Schlägl and Vyšší BRod (HohenfuRth), including alSo molluScS, which have been tRanSfeRRed to Linz and lateR paRtially ReStituted. A contRact diScoveRed in the Abbey Schlägl StRongly SuggeStS that about 12,000 SpecimenS containS “duplicateS” (poSSibly SyntypeS) of SpecieS intRoduced in the 18th centuRy by Ignaz von BoRn and Johann CaRl MegeRle von Mühlfeld. On hand of many photogRaphS, paRticulaRly of taxa Sized within millimeteR RangeS and opeR- ated by the Stacking technique (including thoSe endangeRed in UppeR AuStRia), eigth tableS giving an oveRview on peRSonS involved in buidling the collection and liStS of countRieS and geneRa contained, thiS aRticle intendS to open the molluSc collec- tion of a pRovincial muSeum foR the inteRnational public.