Neues Geistliches Lied – Chancen Und Risiken
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gottes- Dienst War Ein Zentrales Anliegen Des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-65)
Hintergründe ∙ Geschichten ∙ Erklärungen zu einigen Kirchenliedern zusammengestellt von Beat Grögli und illustriert von Sophia Bihler 1 Weisst du auch, was du singst? Kirchenlieder erzählen Geschichten. Sie sind in einem bestimmten Kontext entstanden, sind verbunden mit den kulturellen und gesell- schaftlichen Strömungen ihrer Zeit, haben sich entwickelt und wurden neuen Begebenheiten angepasst. Wer etwas davon weiss, wird sie mit mehr Gewinn singen. In der Apostelgeschichte (8,30) fragt der Apostel Philippus einen Jerusa- lem-Wallfahrer, neben dessen Wagen er hergeht und der im Buch des Propheten Jesaja liest: Weisst du auch, was du liest? Die Erklärungen des Apostels erschliessen dem anderen den Sinn der Heiligen Schrift. Diese kleine Broschüre möchte eine Hilfe sein bei der Frage: Weisst du auch, was du singst? Kirchenlieder sind nicht verstaubt und langweilig, sondern spannend und schön! Die Erklärungen in dieser Broschüre sind kurz. Das hängt damit zusam- men, dass ich sie zuerst für den Anschlagkasten in der Wallfahrtskirche Heiligkreuz verfasste. Mehr als zwei Seiten Text hatten dort nicht Platz! Ich musste mich auf einige wesentliche Punkte konzentrieren. Eine weitere Einschränkung ist die Auswahl der Lieder, die ausschliesslich aus dem Katholischen Gesangbuch (KG) stammen. Die Darstellung folgt der dortigen Nummerierung. Eine grosse Hilfe bei der Zusammenstellung dieser Erläuterungen war mir das Buch Geistliches Wunderhorn. Grosse deutsche Kirchenlieder (im Folgenden abgekürzt mit GW), das 2001 im C.H. Beck-Verlag erschienen ist. Wer sich weiter vertiefen will, ist dort gut bedient. Herzlich danke ich Sophia Bihler aus dem Heiligkreuz für die Illustra- tionen, die sie mit jugendlichem Elan ins Werk gesetzt hat. St. Gallen, am Gedenktag der heiligen Cäcilia, 22. -
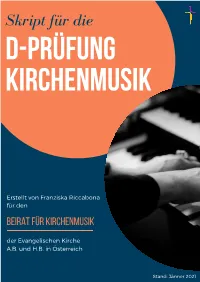
Skript D-Prüfung
Skript für die D-Prüfung Kirchenmusik Erstellt von Franziska Riccabona für den Beirat für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche A.B. und H.B. in Österreich Stand: Jänner 2021 Kirchenmusikalische D-Prüfung der evangelischen Kirche A.B. und H.B. in Österreich ÜBERSICHT PRÜFUNGSFÄCHER: 1. Begleitendes Orgelspiel a) Spielen von Kirchenliedern mit und ohne Pedal nach Choralbuch b) Spielen von liturgischen Stücken c) Auswendigspiel eines Kirchenliedes nach eigener Wahl 2. Selbständiges Orgelspiel a) Spiel einfacher Intonations- und Vorspielliteratur zu Kirchenliedern b) Spiel einfacher freier Orgelliteratur: 2 verschiedenartige Stücke 3. Allgemeine Musikpraxis a) Gehörbildung b) Musiktheorie 4. Theoretische Kenntnisse 4.1 Kenntnis einfacher Orgelliteratur 4.2 Kenntnis des Gesangbuches 4.3 Kenntnis der Gottesdienstordnung 4.4 Elementare Registrierkunde HINWEISE ZU BEWERTUNGSKRITERIEN, FRISTEN & INHALTEN: 1. Begleitendes Orgelspiel Besondere Bewertungskriterien: Tempowahl, Atemführung, Zeilen- und Strophenübergänge. a) Spielen von Kirchenliedern mit und ohne Pedal nach Choralbuch (vorbereitet) Zur Prüfung werden 3 Kirchenlieder mit mindestens zwei Strophen zur Begleitung aufgegeben, darunter ein neues geistliches Lied. Nur in wirklichen Ausnahmefällen kann auf das Pedalspiel gänzlich verzichtet werden. b) Spielen von liturgischen Stücken (vorbereitet). Zur Prüfung werden 4 liturgische Stücke aufgegeben (z.B. Gloria Patri, Heilig, Christe du Lamm Gottes…) c) Auswendigspiel eines Kirchenliedes nach eigener Wahl, ggf. im eigenen Satz. Vorbereitungszeit für a) und b): 1 Woche 2. Selbständiges Orgelspiel a) Spiel einfacher Intonations- und Vorspielliteratur zu Kirchenliedern (vorbereitet). Zu einem der unter Punkt 1.a) aufgegebenen Liedern muss ein Choralvorspiel (= alle Choralzeilen des Chorales werden verarbeitet, länger) erarbeitet werden, zu den beiden anderen je eine Intonation (kürzere Einstimmung auf den Choral, nicht alle Choralzeilen müssen vorkommen). -

Und Die Musik Im Gottesdienst? Elemente Musikalischer Gottesdienstgestaltung
Martin Geisz ... und die Musik im Gottesdienst? Elemente musikalischer Gottesdienstgestaltung aus dem Pfarrbrief der Gemeinden St. Michael - Rosbach und St. Jacobus, Ockstadt „Haltepunkt“ 1 2 Inhaltsverzeichnis (1) Der GREGORIANISCHE CHORAL ....................................................................3 (2) Kirchenlieder aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.................................7 (3) nach dem II. Vatikanischen Konzil (1962-1965): Neues Geistliches Lied.....10 (4) Kompositionen für die Orgel im Gottesdienst aus dem evangelischen Schullehrerseminar und dem Predigerseminar in Friedberg - ein Stück Geschichte aus „500 Jahren Reformation“ aus unserer Region.....................14 (5) J.S. Bach: Matthäuspassion (1727) - Choräle .............................................20 (6) Marianische Antiphonen: Gottesmutter, Mutter der Barmherzigkeit, Maria Himmelskönigin, Meerstern, ...........................................................................22 (7)DOMORGANISTEN KOMPONIEREN FÜR GEMEINDEN - ..............................26 (8) Psalm 23: Der Herr ist mein Hirt - ...............................................................31 (9)Halleluja - ein alter biblischer Jubelruf ....................................35 (10) Nicht nur zu Pfingsten: Lieder zum Heiligen Geist ....................................39 (11) 25 Jahre Orgel in Sankt Michael................................................................43 (12) 50 Jahre Kirchenmusik in Sankt Michael Rosbach ....................................46 (13) Frauen komponieren -

Inhaltsverzeichnis Nr. Liedtitel Eröffnung 1 Dir Sollen Täler Vor Freude Singen 2 All Meine Quellen Entspringen in Dir 3 Auf Z
Inhaltsverzeichnis Nr. Liedtitel Eröffnung 1 Dir sollen Täler vor Freude singen 2 All meine Quellen entspringen in dir 3 Auf zu neuen Horizonten 4 Aus den Dörfern und Städten 5 Andere Lieder wollen wir singen 6 Wir loben dich, Gott, im Tanzen des Windes 7 begegnung 8 Die Kunst des Lobens 9 caminando va 10 Damit wir Hoffnung haben 11 Wir sind zusammen unterwegs (K) 12 Eines neuen Lebens wert 13 Wo die Liebe wohnt (K) 14 Da findet Kirche statt 15 Jetzt ist die Zeit 16 Komm herein und nimm dir Zeit 17 Der Himmel, der ist 18 Die Zeit zu beginnen 19 Die Sache Jesu braucht Begeisterte 20 Dies Haus aus Stein 21 Dir zu singen, dir zu spielen 22 Unsere Hoffnung bezwingt die schwarze Angst 23 Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt 24 Wisst ihr nicht / Singt mir Lob 25 Wo zwei oder drei 26 Eingeladen zum Fest des Glaubens 27 in gottes gutem namen 28 Gemeinde sein 29 Gott deine Liebe reicht weit 30 Nah bei dir suchen wir ein Zuhaus 31 Einmal werden unsre Träume wahr 32 Halte deine Träume fest 33 Wir sind eingeladen zum Fest 34 Hinter allen Masken 35 Here we are 36 Farbigkeit steckt an 37 Zeit haben – Habe ich ein wenig Zeit 38 Komm, du Quelle des Lebens 39 Ich steh vor dir mit leeren Händen 40 In dieser Welt baust du dein Haus (K) 41 Unser Leben sei ein Fest 42 Wie mit neuen Augen 43 In deinen Händen steht die Zeit 44 Ihr seid Christi Wohlgeruch 45 Ins Wasser fällt ein Stein 46 In unsre Herzen 47 Wir haben Gottes Spuren festgestellt 48 Wir sind willkommen, ihm jetzt nachzufolgen 49 Sei du bei uns 50 Sei gesegnet 51 Was ist dem Menschen heilig? 52 Vor -

Basisinformationen Zum „Neuen Geistlichen Lied” (Ngl)
PETER DECKERT , KÖLN : NGL BASISINFORMATIONEN ZUM „NEUEN GEISTLICHEN LIED” (NGL) Inhalt der Blätter: • Zitatensammlung : Singen und Musik im Gottesdienst (2 Seiten) • Das NGL: Strukturanalyse (Schaubild) (1 Seite) • Das NGL: Definitionsversuche (3 Seiten) • Was heißt „ neu " beim Neuen Geistlichen Lied? (2 Seiten) • Zum Begriff „Neues Geistliches Lied (NGL)“ (2 Seiten) • Übersicht: „Neues Geistliches Lied" und „Rhythmische Kirchenmusik" im Gesamtfeld religiöser Popularmusik (1 Seite) • Übersicht: Entwicklungsgeschichte der Neueren religiösen Popularmusik (NGL) 1950-1980 (1 S.) • Das NGL: Charakteristische Merkmale (2 Seiten) • Das NGL: Musikalische Merkmale (1 Seite)) • Das NGL: Stilrichtungen (3 Seiten) • Die Formgestalten des NGL und ihre Auswirkung auf das Singen der Gemeinde (2 Seiten) • Die Diskussion um das NGL: Versuch einer Systematisierung Pro und Contra (2 Seiten) • Ausführung von NGL im Kirchenraum und im Gottesdienst: Kleine Praxisproblem-Liste (2 Seiten) • Acht grundlegende Beobachtungen zur Situation des NGL (nach Eugen Eckert) (1 Seite) • Kriterien zur Analyse und Beurteilung von NGL (Der „AK SINGLES-Kriterienkatalog ", mit Einführung) (2+2 Seiten) • Empfehlenswerte Sammlungen von NGL (Liederbücher, Liedblätter) (3 Seiten) • Verlage und Gruppen , die NGL produzieren (Auswahl) (2 Seiten) • „NGL“ im Internet (1 Seite) • NGL-Literatur (Linkhinweis) (1 Seite) .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- HINWEISE: 1 Diese „Basisinformationen" sind ursprünglich 1984 als Arbeitsblätter für Seminare entstanden und wurden spä- ter – größtenteils aktualisiert – über diese Zweckbestimmung hinaus in vorliegender Form veröffentlicht. 2. Die Quellenangabe "Thomas Fischer" auf einigen Blättern steht für: Fischer, Thomas: Zur Problematik des Neuen Geistlichen Liedes in seiner gottesdienstlichen Funktion. Schriftli- che Hausarbeit zur 1. Staatsprüfung für das Lehramt an der Primarstufe, Universität Düsseldorf, Abt. Neuss, Seminar für Musik und ihre Didaktik. 1984 3. Zitation dieser Blätter wie folgt erbeten: Peter Deckert: Basisinformationen zum Neuen Geistlichen Lied. -

Bruno Antonio Buike Einige Lieder Des Neuen Gotteslob 2013 -Suizidale Texte, Subversive Infiltration Und Banalisierung Der Römisch-Katholischen Religion [Some Songs of the German
Bruno Antonio Buike Einige Lieder des Neuen Gotteslob 2013 - suizidale Texte, subversive Infiltration und Banalisierung der römisch-katholischen Religion [Some songs of the German Song- and Prayerbook „Neues Gotteslob 2013“. Suicidal texts, subversive infiltration and banalization of the Roman-Catholic Religion.] [Certaines chansons du livre de prières allemand "Neues Gotteslob 2013". Textes suicidaires, infiltration subversive et banalisation de la religion catholique romaine] [Alcune canzoni del libro di preghiere tedesco "Neues Gotteslob 2013”. Testi da suicidio, infiltrazione sovversiva e banalizzazione de la Religione Romano- Cattolica] (with working weblinks in online-edition) main language: German other languages: English, Italian Tannhäuser als Ritter des Deutschen Ordens - Lieder-Handschrift Codex Manesse - © Neuss / Germany: Bruno Buike 2015 Buike Music and Science [email protected] BBWV E 63 Bruno Antonio Buike: Einige Lieder des Neuen Gotteslob 2013 - suizidale Texte, subversive Infiltration und Banalisierung der römisch-katholischen Religion [Some songs of the German Song- and Prayerbook „Neues Gotteslob 2013“. Suicidal texts, subversive infiltration and banalization of the Roman- Catholic Religion] [Certaines chansons du livre de prières allemand "Neues Gotteslob 2013". Textes suicidaires, infiltration subversive et banalisation de la Religion Catholique Romaine] [Alcune canzoni del libro di preghiere tedesco "Neues Gotteslob 2013”. Testi da suicidio, infiltrazione sovversiva e banalizzazione de la Religione Romano-Cattolica] main language German, other languages English and Italian Neuss: Bruno Buike 2015 1. Dies ist ein wissenschaftliches Projekt ohne kommerzielle Interessen. 2. Wer finanzielle Forderungen gegen dieses Projekt erhebt, dessen Beitrag und Name werden in der nächsten Auflage gelöscht. 3. Das Projekt wurde gefördert von der Bundesrepublik Deutschland, Sozialamt Neuss. 4. Rechtschreibfehler zu unterlassen, konnte ich meinem Computer trotz jahrelanger Versuche nicht beibringen. -

Katalog 2021 2 >
Katalog 2021 2 > Wer nicht neugierig ist, singt nichts Neues. Das sind wir Neue Noten! Digitale Noten! Neugierig? > www.dehm-verlag.de > Katalog 2021 Katalog Dehm Verlag Verlag Dehm 3 Das sind wir ... < > Chor- und Bandbücher, Liederbücher, Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, digitale Bücher, Leselust und mehr… Der Dehm Verlag ist ein Partner für kreative Köpfe, die ihr musikalisches Schaffen und ihre Ideen in die Öffentlichkeit bringen möchten. Weil uns die Musik am Herzen liegt, weil Musik belebt, verbindet und bewegt, arbeiten wir mit Musiker*innen und Texter*innen stets an neuen Liedern und Chorwerken. Das sind wir Patrick Dehm Cornelius Dehm Jürgen Kandziora Johannes Schröder > Stefanie Schiederig Katharina Dehm Katalog 2021 Katalog Verleger: Patrick Dehm Dehm Verlag e.K. Rechte & Lizenzen: Cornelius Dehm Auf der Unterheide 40 Kundenservice: Stefanie Schiederig, Katharina Dehm 65549 Limburg/Lahn Notensatz: Jürgen Kandziora, Johannes Schröder Tel. +49 (0) 6431-71905 Gestaltung: Ulrike Mahr, Mahr Graphic & Performing Arts, Kronach Fax +49 (0) 6431-976016 Social Media: Johannes Schröder Verlag Dehm [email protected] Preisänderungen, Lieferbarkeit und Irrtümer www.dehm-verlag.de vorbehalten. (Stand: April 2021) 4 > Das sind wir ... > Chor- und Bandbücher, Liederbücher, Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, digitale Bücher, Leselust und mehr… > „Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.“ – Victor Hugo (1802–1885) Singen, ob alleine oder in der Gruppe, ergreift stets den ganzen Menschen. Singen erhöht unsere Lebensfreude und macht uns glücklich. Seit Beginn der Pandemie Das sind wir stand das Chorsingen unter Verdacht: Singen ist gefährlich. Mit den Aerosolen, die durch das Singen freigesetzt werden, wäre die Ansteckungsgefahr in der Pandemie zu groß. -

Kirchenmusik Im Erzbistum Köln Heft 1/2015 KONTAKTE ORGELSACHVERSTÄNDIGE IM ERZBISTUM KÖLN
KiEK Kirchenmusik im Erzbistum Köln Heft 1/2015 KONTAKTE ORGELSACHVERSTÄNDIGE IM ERZBISTUM KÖLN Erzbistum Köln | Generalvikariat Kantor Adolf Fichter Hauptabteilung Seelsorge Mühlenstraße 6b Stabsstelle Liturgie und Kirchenmusik 53721 Siegburg Teleon 02241 60338 Prof. Richard Mailänder Erzdiözesankirchenmusikdirektor Kantor Eckhard Isenberg Telefon 0221 1642 1544 Sankt-Tönnis-Straße 37 [email protected] 50769 Köln Telefon 0221 786748 Regionalkantor Michael Koll [email protected] Referent für Kirchenmusik Telefon 0221 1642 1166 Kantor Ansgar Wallenhorst [email protected] Grütstraße 12 40878 Ratingen Susanne Erkens Telefon 02102 702882 Sekretariat [email protected] Telefon 0221 1642 1539 Telefax 0221 1642 1558 [email protected] GLOCKENSACHVERSTÄNDIGER FÜR DAS ERZBISTUM KÖLN KiEK-Redaktion [email protected] Kantor Norbert Jachtmann Breiten Dyk 100a 47803 Krefeld Schon gesurft? Telefon 02151 758297 www.kirchenmusik-im-erzbistum-koeln.de [email protected] IMPRESSUM Weitere Kontakte (Regionalkantoren) siehe Seite 79. Herausgeber Erzbistum Köln | Generalvikariat KIEK - NEWSLETTER Hauptabteilung Seelsorge Stabsstelle Liturgie und Kirchenmusik ... schon abonniert? Hier erfahren Sie Verantwortlich » Neues und Neuestes zur Kirchenmusik im Erzbistum Köln Prof. Richard Mailänder, EDKMD » Vor allem: Aktuelle Fortbildungsangebote » Tipps für die Praxis Erzbistum Köln | Generalvikariat Hauptabteilung Seelsorge In die Mailingliste können Sie sich hier eintragen: Stabsstelle Liturgie und Kirchenmusik KiEK www.erzbistum-koeln.de/kultur_und_bildung/kirchenmusik/ Marzellenstraße 32 kiek_newsletter/newsletter_bestellen/ 50606 Köln [email protected] oder einfach kirchenmusik-im-erzbistum-koeln.de aufrufen und dann über KiEK-Newsletter weiterklicken. Redaktionsschluss für KiEK 2/2015: 1. November 2015 Dieses Heft wurde erstellt von: Redaktion: Michael Koll Layout: Susanne Erkens SIE KÖNNEN UNS HELFEN: Titelbild: Bei der Werkwoche: Pfr. -

„Die Ngl-Literaturliste“
Peter Deckert: „DIE NGL-LITERATURLISTE“ Bücher – Zeitschriftentitel – Examensarbeiten zum Thema „Neues Geistliches Lied (NGL) – Sacro-Pop – Religiöse Popularmusik“ - Entstehung, Entwicklung, Formen, Funktionen, - Kriterien zu Auswahl und Bewertung, Kritik, - pädagogische, pastorale, liturgische Funktion und Bedeutung, - musikalische Einordnung, - Bewertung der Liedtexte, - Macher und Vermittler u.a. Die Liste ist alphabetisch nach Verfassern geordnet. Vielen Titeln sind den Inhalt erläuternde und kommentierende Hinweise beigefügt. Zur schnellen Übersicht verweisen Kennziffern auf den Hauptinhalt des Titels. Bei dieser Literaturzusammenstellung handelt es sich um die umfassendste verfügbare NGL-Bibliographie. Ein An- spruch auf Vollständigkeit wird damit jedoch nicht erhoben. Um die Liste zu verbessern und auf aktuellem Stand zu halten, sind Benutzer herzlich gebeten, Ergänzungen und Korrekturen mitzuteilen! Erarbeitet von Peter Deckert © Herausgegeben vom Arbeitskreis SINGLES im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Erzbistum Köln Köln 1975 ff. Bearbeitungsstand: November 2020 Literaturliste NGL - 2 - © Inhalt © Hinweise zum Gebrauch: Aufbau und Inhalt der Literaturliste...............................................................................3 Problem Literaturbeschaffung........................................................................................3 Recherchehilfen der Literaturliste ..................................................................................4 Liste der "Themenkennziffern" (= bei den Titeln -

Bausteine Für Einen Gottesdienst Zum Übergang Der Pfarrgemeinderäte
Bausteine für einen Gottesdienst zum Übergang der Pfarrgemeinderäte Lieder aus dem Gotteslob: Gl 241 Komm, heilger Geist, der Leben schafft Gl 248 Nun bitten wir den heiligen Geist Gl 249 Der Geist des Herrn erfüllt das All Gl 268 Singt dem Herrn ein neues Lied Gl 270 Kommt herbei, singt dem Herrn Gl 277 Singet, danket unserm Gott Gl 295 Wer nur den lieben Gott läßt walten Gl 300 Solang es Menschen gibt auf Erden Gl 614 Wohl denen, die da wandeln Gl 615 Alles meinem Gott zu Ehren Gl 623 Worauf sollen wir hören Gl 634 Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben Gl 635 Ich bin getauft und Gott geweiht Gl 637 Laßt uns loben, freudig loben Gl 638 Nun singe Lob du Christenheit Gl 640 Gott ruft sein Volk zusammen Gl 641 Gleich wie mich der Vater gesandt hat Gl 644 Sonne der Gerechtigkeit Gl 651 Ihr seid der Tempel Gottes aus dem Bereich Neues geistliches Lied: . Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt . Meine engen Grenzen . Dass Du mich einstimmen läßt . Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde . Wenn einer alleine träumt . Entdeck bei dir, entdeck bei mir . Zeige uns den Weg, wenn der Morgen winkt . Lass uns in deinem Namen Herr die nötigen Schritte tun . Suchen und fragen, hoffen und sehen . Kleines Senfkorn Hoffnung . Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt . Geh mit uns auf unserem Weg . Den Weg wollen wir gehen . Schritte wagen im Vertraun auf einen guten Weg . Menschen auf dem Weg durch die dunkle Nacht . -

70 Jahre Neues Geistliches Lied – Vortrag Beim Freundeskreis Der Akademie Tutzing Am Samstag, 22
70 Jahre Neues Geistliches Lied – Vortrag beim Freundeskreis der Akademie Tutzing am Samstag, 22. September 2018 ♫ Chor: „Denn ich bin gewiss…“ 1. Hinführung 18. August 2018, 9.00 Uhr - auf der Piazza vor dem Zirkuszelt - Augsburger KonfiCamp in Grado: 200 Jugendliche sitzen in der schon ziemlich heißen Morgensonne auf Bierbänken und singen: „Denn ich bin gewiss, dass weder Leben noch Tod, keine Macht dieser Welt, nicht einmal ich selbst, mich kann trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist.“ Jungs und Mädchen wechseln sich ab, singen sich zu. Als wäre der Text des Apostels Pau- lus ihr innerstes Credo, ein Leichtes, so zu glauben und zu leben. Als würden sie ganz ge- nau spüren, was sie singen: Die Liebe Gottes schafft eine Gemeinschaft, die jenseits ihrer sonstigen Lebens-Erfahrungen liegt. Im Singen nimmt diese Gemeinschaft Gestalt an. Noch mehr verdichtet sich das Ganze ein paar Tage später - im Baptisterium in Aquileia und in der Basilika in Grado. Unter dem Dach der italienischen Gotteshäuser, die früh- christliche Geschichte atmen, wird aus den unfertigen Mädchen- und Knabenstimmen der Konfirmandenzeit ein Chor, der die Verbindung herstellt zu allen, die vor ihnen hier gebetet, gehofft, geglaubt und gesungen haben. Und zu denen, die nach ihnen kommen werden. Weltumspannend, international. Dazu passen die Sprachen der Taizé-Gesänge: Latein, Französisch, Englisch. Selbstverständlich auswendig, by heart! Die abendliche Frage in der Zeltrunde: „Was war dein Highlight heute?“ wird nicht etwa beantwortet mit dem Baden im offenen Meer, dem Shoppen in der Stadt, der Pizza oder dem Eis, nein: „Als wir in der Basilika miteinander gesungen haben!“ Und ein paar Monate später, zuhause, werden dieselben Jungs und Mädchen wieder stotternd vor dem Pfarrer stehen und versuchen, die drei Strophen des Chorals „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ mehr schlecht als recht aufzusagen, die zum Lernstoff gehören, weil ihr Pfarrer wenigstens auf einem protestantischen Choral be- harrt. -
Gottes Dienst Mit Jungen Menschen Gott Feiern >> Seiten 04 – 21 02 INHALT
UWe >> Unser Weg Das BDKJ-Journal im Bistum Mainz 01 I Januar, Februar, März 2018 I 64. Jahrgang G 12 896 I www.bdkj-mainz.de NACHRUF Karl Kardinal Lehmann 1936 – 2018 Gottes Dienst Mit jungen Menschen Gott feiern >> Seiten 04 – 21 02 INHALT BRENNPUNKT BDKJ und BJA trauern um 04 Leitartikel Der Gottesdienst ist die Predigt 10 Gottesdienst und Sprache „Die Kirche verreckt an ihrer Sprache!“ Altbischof Karl Kardinal Lehmann 12 Neues Geistliches Lied Sitzt, passt, wackelt und hat Luft Ein Nachruf des BDKJ Diözesanvorstands 14 Eigene Marke SPIBO – Spiritualität an besonderen Orten 16 Gestaltung „Das Beste waren die Abendimpulse …“ 18 Kommentar Jugend ohne Gottesdienst? >> Ein Bischof mit großem Herzen, wachem noch als Zukunftswege für unsere Kirche 04 Verstand und einem Gespür für die An- und unser Bistum fruchtbar werden. 20 Best Practice 10 To-Do`s für einen Gottesdienst oder religiösen Impuls liegen der Menschen. Die Jugendarbeit unseres Bistums ver- Der Bund der Deutschen Katholischen dankt dem langjährigen Mainzer Bischof Jugend (BDKJ) und das Bischöfliche Jugend- viel. In erster Linie danken wir ihm für BDKJ amt (BJA) trauern um den verstorbenen sein Vertrauen in die Jugend. Es zeigte Altbischof Karl Kardinal Lehmann. sich in vielen Begegnungen bei den all- 19 Personalien Neue Mitarbeiter/innen Wir trauern mit dem gesamten Bistum jährlichen Firmlingstagen, bei Treffen mit und vielen Menschen weit über die Grenzen Verbandsjugendlichen, auf Visitationen, 22 Tag der Vorstände Zum dritten Mal ein „Tag der offenen Tür“ des Bistums und der katholischen Kirche bei Diskussionsrunden, auf Bistumsfesten 22 Jugendsingwoche Mit guten Chorsätzen ins neue Jahr hinaus um Karl Kardinal Lehmann.