Landesmusikplan Bremen 2010
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Reencuentro (Slow Milonga by Juan Maria Solare)
Juan María Solare Reencuentro milonga para piano Reunion - for piano Wiederbegegnung - für Klavier Duración: ~ 3 minutos El Escorial, Worpswede & Berlín, marzo-abril de 2008 Juan María Solare Reencuentro Ø Original para piano (Worpswede 7 de abril & Berlín 9 de abril 2008) Ø Segunda versión: para piano a cuatro manos (Köln, 17 de abril de 2008, correcciones en Köln, 7 de noviembre de 2008) Ø Tercera versión: para saxofón tenor y piano (Ginebra, 15-16 de agosto de 2008) Ø Cuarta versión: para violín y piano (Worpswede, 31 de agosto de 2008) Ø Quinta versión: para cello y piano (Worpswede, 6 de octubre de 2008) Ø Sexta versión: para bandoneón, saxo tenor y piano (Buenos Aires, 19/MAR & 14/ABR/2009) Ø Séptima versión: para viola y piano (Bremen, 25 de enero de 2010) Milonga anotada tras una visita al cementerio de El Escorial (España) el 30 de marzo de 2008. Es la típica obra que se va destilando en etapas: primero una versión "parrilla", luego una primera versión sencilla para piano, que luego se va tornando más compleja. La versión "sencilla" para piano solo fue escrita en el 7 de abril de 2008 y terminada en Berlín el 9 de abril de 2008. Estreno (versión original para piano solo): por el compositor el 3 de julio de 2008 en el teatro de la Universidad de Bremen, durante un concierto de la Orquesta No Típica. Estreno en el continente americano por Iván Pérez Faccaro el 27 de noviembre de 2008 en el Conservatorio Superior de Música de Buenos Aires (Argentina) "Ástor Piazzolla". -

Ausgabe 2016 (Pdf, 1
Bremen in Zahlen 2016 ISSN 2199 – 0751 (Digital) ISSN 0175 – 7385 (Print) Zeichenerklärung P vorläufiger Zahlenwert r berichtigter Zahlenwert s geschätzter Zahlenwert . Zahlenwert ist unbekannt oder geheim zu halten ... Zahlenangaben fallen später an – Zahlenwert ist genau null (nichts) x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend () Wert mit beschränkter Aussagekraft / Kein Nachweis, weil Ergebnis nicht ausreichend genau Im Allgemeinen wird ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelwerten geringfügige Abwei- chungen in der Endsumme ergeben. Herausgeber: Statistisches Landesamt Bremen Gestaltung: Trageser GmbH Bremen / Statistisches Landesamt Bremen Foto S. 7: © Helmut Gross / bremerhaven.de Satz und Druck: Statistisches Landesamt Bremen Erschienen im August 2016. 2. korrigierte Auflage (S. 35) © Statistisches Landesamt Bremen, Bremen, 2016. Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet. Bremen in Zahlen 2016 2 › Inhalt ‹ Seite › Zwei Städte - ein Land: Ein Blick zurück ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 4 › Bremen in Zahlen ‹ 1 › Lage und Flächennutzung ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 8 2 › Bevölkerung ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 10 3 › Haushalte und Familien ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 15 4 › Wahlen ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 17 5 › Erwerbstätigkeit und Arbeitsmarkt -

Fifty-Ninth National Conference October 27–29, 2016 Santa Fe, New Mexico ABSTRACTS & PROGRAM NOTES Updated September 12, 2
Fifty-Ninth National Conference October 27–29, 2016 Santa Fe, New Mexico ABSTRACTS & PROGRAM NOTES updated September 12, 2016 Alberti, Alexander Paper: From Beatboxing to Bach: Applications of Collegiate A Cappella Across the Music Curriculum In recent decades, collegiate a cappella groups have flourished on campuses across the nation, yet a cappella’s place in the study of classical art music has been unclear, despite such benefits as practical ear training, group cohesion, applications of music arrangement, and engaging vocal practice. St. Jean (2014) investigated a cappella’s benefits to the undergraduate ensemble singer’s skillset; however, the literature has yet to expand this into a broader range of musical disciplines. To address this gap, the present study explored how the collegiate a cappella experience may supplement, improve, and coexist with the traditional music curriculum at the college level, using a qualitative methodology known as experience-sampling (Zirkel, Garcia, Murphy, 2015). Undergraduates in various music degree programs, simultaneously engaged in a cappella organizations, submitted weekly reports of the integration of their a cappella skills into their courses, lessons, and classwork. Coupled with interviews, this information was thematically coded and analyzed through the lens of Kolb’s Experiential Learning Model to discover how skills gained in a cappella supported students’ experience in the music curriculum, regardless of concentration. Results of this study may better inform curriculum development and professional development opportunities across the entire music discipline. Alhadeff, Peter Paper: Berklee’s Fair Music and Transparency Report: A Critique Berklee’s Fair Music Report has made headlines by highlighting much opacity in the engagement of talent by a variety of music intermediaries. -
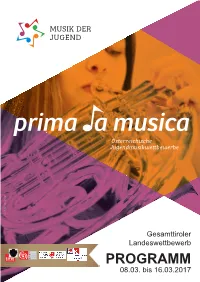
Programm 08.03
Gesamttiroler Landeswettbewerb TIROLER M USIK S CHUL W ERK PROGRAMM 08.03. bis 16.03.2017 Auszug aus dem Ortsplan von Wattens Inhaltsangabe Infos zum Wettbewerb und Teilnehmerstatistik ..........................................................................................................2 Grußwort der Kulturlandesrätin von Tirol ....................................................................................................................3 Grußwort des Kulturlandesrates von Südtirol .............................................................................................................4 Grußwort des Bürgermeisters Thomas Oberbeirsteiner .............................................................................................5 Die Musikschule Wattens ...........................................................................................................................................6 Adressen, Telefonnummern ........................................................................................................................................7 Austragungsorte .........................................................................................................................................................8 Swarovski Kristallwelten ............................................................................................................................................9 Preisträgerkonzert und Sonderpreise .......................................................................................................................10 -

Den Schulischen Sportunterricht Ergänzen
WIR FÖRDERN IN BREMEN-MITTE WIR FÖRDERN IN IHRER NÄHE Sa 5.5. bis So 6.5. g Sparkasse Bremen. Bei der ›finden!‹ Bildnachweis: › Michael Bahlo (01, 02, 03); Sportgarten e. V. (04); finden; Sebastian Kobs; Auf gute Nachbarschaft – ›Sportakademie‹ handelt es 11–18 Uhr Ingo Arndt; Vanessa Kisuule (poetry on the road): Alisa Fineron; Ingo Wagner; Josef Scharl, Pariser Straßenszene, 1930, Galerie Nierendorf, Berlin ©Susanne Fiegel; E+N, Deutscher Kari Bremer Marktplatz und Markt für feines Handwerk und Design sich um eine Kooperation des katurenpreis; Kreissportbund BremenStadt; Kunsthalle Bremen, Toma Babovic; Katrin Schneider; seit über 190 Jahren! Sportgartens mit Schulen und Untere Rathaushalle Apollon Theater Bremen; M. Menke; Jan Meier; Felix Bröde; Robbie Lawrence; Nikolai Wolff, Bereits zum neunten Mal findet der Kunsthandwerkmarkt im Fotoetage; concept bureau UG; Kunsthalle Bremen, Karen Blindow Vereinen, die den Sportunter- Herzen der Bremer City statt. Insgesamt 50 Kunsthandwerker Kennen Sie eine Bank mit einer Geld-zurück-Garantie? Wir richt in den Schulen ergänzen, Eintritt: frei und Designer aus ganz Deutschland präsentieren ihre Arbeiten schon! Die Sparkasse Bremen arbeitet seit mehr als 190 Jah- um den Schülerinnen und Infos: (0421) 498 93 67 und laden zum Stöbern und Bummeln ein. Neben einer großen ren nach dem Gemeinwohlprinzip. Das bedeutet, dass nicht www.finden-bremen.de Große Freude mit Fußball und Schülern noch mehr Bewe- Auswahl an handgefertigten Schmuckstücken und Holzarbeiten die Gewinnmaximierung oberstes Ziel ist, sondern der Nut- Skateboard: Laura Alexander gung zu ermöglichen und den gibt es unter anderem Hüte, Keramik und Porzellan sowie zen für Sie, unsere Kunden, und für unsere Stadt. -

Jay Byrnes Final DMA Recital Notes 2
Jay Byrnes Final DMA Recital Saxophone Semester 6 13th April 2016 7.00pm ‘El Asunto del Tango’ figure 1. Associate Artists Daniel Rojas – Piano Michael Kluger – Accordion Isabella Brown – Double Bass Carmen Nieves – Alto Saxophone Ben Carey – Soprano Saxophone Nathan Henshaw – Tenor Saxophone Michael Duke – Baritone Saxophone 1 Program 1. From the Guardia Vieja to La Epoca de Oro Anibal Troilo (1914-1975) Che, Bandoneon (1950) Alto Saxophone, Accordion, Piano Arr. Jay Byrnes, Michael Kluger Carlos Gardel (1890-1935) Volver (1935) Baritone Saxophone, Piano Arr. Jay Byrnes, Daniel Rojas Gerardo Matos Rodríguez (1897-1948) La Cumparsita (1916) Soprano Saxophone, Alto Saxophone, Piano Arr. Jay Byrnes, Fernando Muslera Julián Plaza (1928-2003) Nocturna Soprano Saxophone, Accordion, Piano, Double Bass Arr. Jay Byrnes 2. Nuevo Tango – The genius of Piazzolla Astor Piazzolla (1921-1992) Soledad (1969) Baritone Saxophone, Alto Saxophone, Accordion, Piano, Double Bass Arr. Jay Byrnes, C. Nieves Libertango (1974) Baritone Saxophone, Alto Saxophone, Soprano Saxophone, Accordion, Piano, Double Bass Arr. Jay Byrnes Resurrección del Angel (1969) Baritone Saxophone and Saxophone Quartet Arr. Jay Byrnes 3. Vanguardia – Tango’s Future Fernando Lerman (b. 1965) Entongue Tango (2015) Baritone Saxophone, Accordion Jorge Retamoza (b. 1958) Estudio no.1 (2014) Alto Saxophone Fernando Muslera (b.1975) Nostalgia City (2015) Baritone Saxophone, Piano Arr. Fernando Muslera 2 Acknowledgements I would like express my sincere gratitude to all those who made this DMA possible. A doctoral recital is no small undertaking and without the support and commitment from a number of people, this work could not have been achieved. Firstly, a huge thank you to my performance supervisor, Dr. -

Febrero-Marzo 2005 2,80 € EDUCACIÓN 1 La Reforma En Los
EDUCACIÓN 1 La reforma en los conservatorios del sur de Galicia 1 Razones para la creación de currículos y centros integrados 1 Musicología y juventud, notas de un Encuentro1 INSTRUMENTOS 1 El cantante Ismael en sus colecciones musicales 1 Francisco González: Premio artesano madrileño tradicional 1 PUBLICACIONES 1 libros, partituras y discos 1 OTRAS SECCIONES 1 Música y Medicina, Actualidad, Conciertos para niños (propuestas, críticas, agenda). • CUADERNO DE NOTAS 1 La ESMUC estrena sus nuevas instalaciones 1 1 Actualidad, Publicaciones, Cursos y Concursos, Pequeños anuncios. revista de información musical febrero-marzo 2005 2,80 € Conéctate a Internet desde tu Clavinova CVP VERDADERAMENTE GRANDIOSOS Con un sonido magnífico y un aspecto elegante, los nuevos Clavinovas serie CVP de Yamaha, incorporan un nuevo diseño atractivo que está basado en lo mejor de los anteriores modelos CVP. Los sonidos extraordinariamente auténticos y los estilos dinámicos ofrecen un sonido realmente profesional, mientras que las características sofisticadas y al mismo tiempo fáciles de usar de este instrumento como su conexión directa a Internet, lo convierten en una fuente inagotable de disfrute musical para usuarios de todas las edades. Pulsa una tecla y comprenderás... por qué los pianos digitales de la nueva serie CVP, son verdaderamente grandiosos. www.yamaha.es YAMAHA YAIVIAHA-HAZEN MÚSICA, S.A. 902 3 9 88 88 EN PORTADA: Zarza ardiente, 2003. Escultura de Carlos Schwartz; (cortesía Galería Fúcares). De este artista podrá verse, del 20 de enero al 26 de febrero 2005, una exposición en la Galería Fúcares de Madrid, calle Conde Xiquena, 12, 1°. N°45 FEBRERO-MARZO 2005 uropa es la noticia. -

Förderung Der Kulturellen Bildung in Der Stadt Bremen
BREMISCHE BÜRGERSCHAFT Drucksache 19/808 S Stadtbürgerschaft 19. Wahlperiode 26.06.18 Antwort des Senats auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP Förderung der kulturellen Bildung in der Stadt Bremen Antwort des Senats auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP vom 4. Mai 2018 „Förderung der kulturellen Bildung in der Stadt Bremen“ Die Fraktion der FDP hat folgende Kleine Anfrage an den Senat gerichtet. „Kulturelle Bildung ist elementar für ein demokratisches alltägliches Zusammenleben. Hier werden die Grundlagen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt vermittelt. Im Rahmen der kulturellen Bildung setzt der einzelne Bürger sich mit sich, der Gesellschaft und der Umwelt durch künstlerische Ausdrucksformen auseinander. Kulturelle Bildung wirkt integrativ und fördert die Ausbildung gemeinsamer Werte. Diese Möglichkeit zur Teilhabe an kulturbezogener Kommunikation und Ausdrucksform trägt zur Inklusion des Einzelnen in die Gesellschaft bei. Auf der Internetseite der Staatsministerin für Kultur und Medien heißt es: „Kultur und kulturelle Bildung vermitteln Traditionen, Kenntnisse und Werte, die eine Gesellschaft erst lebenswert machen. Kulturelle Bildung hat eine überragende Bedeutung für die individuelle Persönlichkeitsentfaltung wie auch für das Selbstverständnis und die Teilhabe an unserer Gesellschaft.“ In Bremen ist Stadtkultur e.V. ein zentraler Akteur der kulturellen Bildung. Der Zusammenschluss von Kultureinrichtungen ermöglicht durch niedrigschwellige, künstlerische Projekte jedem die Teilhabe an kultureller Bildung in Bremen. Die Träger der kulturellen Bildungsangebote sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf die Unterstützung durch die Stadt Bremen angewiesen. Damit die Unterstützung Bremens auch tatsächlich in der Praxis ankommt, sind die Verwaltungsaufgaben der Institutionen in der kulturellen Bildung möglichst effizient und unbürokratisch zu gestalten. Die Praxis der senatorischen Behörden scheint dem allerdings nicht gerecht zu werden. -

Bremen Innenstadt 2025
1 Der Senator für Umwelt, Bremen Innenstadt Bau und Verkehr 2025 Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen Entwurf Bremen Innenstadt 2025 Der Senator für Umwelt, Der Senator für Wirtschaft, Bau und Verkehr Arbeit und Häfen Impressum Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen Handelskammer Bremen Bearbeitung pp aIs pesch partner architekten stadtplaner BDA SRL Prof. Dr. Franz Pesch Dipl.-Ing. Gudrun Neubauer Dipl.-Ing. Philip Schmal Dr. Tilman Sperle mit Dipl.-Ing. Andreas Binkele, cand. arch. Till Krüger cand. arch. Carolin Proepper, cand. arch. Sara Vian, B.A. Roswitha Beck Redaktion: Holger Everz Layout: Doris Fischer-Pesch Layout (Titel): Stadt Bremen Firnhaberstraße 5, 70174 Stuttgart Fon 0711.2200763.10 Fax 0711.2200763.90 [email protected] | www.pesch-partner.de In Kooperation mit SHP Ingenieure Dr.-Ing. Wolfgang Haller Dipl.-Ing. Harald von Lübke Dipl.-Ing. Sabrina Stieger Plaza de Rosalia 1, 30449 Hannover Fon 0511.3584-450 Fax 0511.3584-477 [email protected] | www.shp-Ingenieure.de Geschäftsführung Marianne Grewe-Wacker (Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen) Rainer Imholze (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr) Olaf Orb (Handelskammer Bremen) Auftraggeberrunde Bernd Bluhm (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr) Robert Bücking (Ortsamt Bremen-Mitte) Heiko Fischer (WFB-Wirtschaftsförderung Bremen) Marianne Grewe-Wacker (Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen) Franz-Josef Höing (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr) Rainer Imholze (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr) Dr. Dirk Kühling (Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen) Olaf Orb (Handelskammer Bremen) Dr. Andreas Otto (Handelskammer Bremen) Gunnar Polzin (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr) Bianca Urban (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr) Prof. -

The Devil's Horn and the Music of the Brothel
THE DEVIL’S HORN AND THE MUSIC OF THE BROTHEL APPROACHING ADAPTATION AND PERFORMANCE OF TANGO FOR THE CLASSICAL SAXOPHONIST A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts at the Sydney Conservatorium of Music The University of Sydney Jonathan Byrnes 200108443 October 2015 Abstract The purpose of this thesis is to establish a concise and well-considered approach to the performance of tango music by a classical saxophonist. It explores the significance of adaptation to a saxophonist by investigating the integral role it has had on the performance, promotion and education throughout the instrument’s history. To this end, this thesis also traces the tradition of adaptation in Western Classical music. When approaching the adaptation of tango it is important to recognise the differences in the music’s culture. We are ultimately changing the context of the music by arranging it for another instrument. Therefore, a fervent discussion of the issues surrounding the idea of schizophonic mimesis are explored in an effort to maintain due respect for the original composition while bringing something new to it. The impact of schizophonic mimesis on our audience’s expectations, the stylisation of music, and the respect to the tradition of the other culture are discussed, and establish the need for a well- informed and stylistic approach. To help address the various issues, this thesis gives a historical account of, what we will refer to as the tango’s ‘tangible’ and ‘intangible’ stylistic traits, and will propose a new approach to saxophone tango performance through a series of established and novel techniques. -

Geschenketipps Plädoyer Für Das Leben Made in Bremen
November 2020 Made in Bremen Neuer Store in der Stadtwaage Geschenketipps Spezial: Lokales unterm Weihnachtsbaum RECHT & GELD Finanzen und Plädoyer für das Leben Nachhaltigkeit GOP Varieté-Theater: „Der kleine Prinz auf Station 7“ Dar Salim, Luise Wolfram und Jasna Fritzi Bauer ermitteln im Bremer „Tatort“ Das neue Team Urban trifft grün, Qualität trifft Innovation Eigentumswohnungen in Nähe des Bürgerparks 1 bis 5 Zimmer Hell & barrierefrei Bodentiefe Fenster High-Speed-Internet Echtholzparkett & Mindestens 1 Balkon Fußbodenheizung oder Terrasse JETZT INFORMIEREN! TELEFON: WEBSITE: BAUHERR & VERKAUF: 0421 · 30 80 68 91 www.findorff-living.de 2 EDITORIAL Alle gemeinsam! Mit uns in besten Händen! Sie möchten verkaufen… wir suchen Immobilien aller Art in Bremen u. Umland… Werteinschätzung für Sie kostenlos! ovember: Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu, biegt Eine marktgerechte Bewertung ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermittlung. sozusagen auf die Zielgerade ein. Die Tage werden wieder Wir verfügen über das Know-how und langjährige Erfahrung, kompetent und seriös deutlich kürzer und es sind nur noch ein paar Wochen bis erledigen wir für Sie die gesamte Abwicklung, vom ersten Kontakt bis zur notariellen N Beurkundung des Kaufvertrages und darüber hinaus bleiben wir selbstverständlich Weihnachten. Normalerweise beginnt die Vorbereitung auf ein ihr Ansprechpartner, lernen Sie uns kennen! geruhsames Fest, es ist die Hochzeit für Konzert-, Theater- und Kinobesuche sowie der ideale Zeitpunkt, das gastronomische An- gebot der Stadt einmal genau- Telefon: 0421 – 61 44 21 er unter die Lupe zu nehmen. Mobil:28277 Bremen 0173 2404099• Tel. 0421-614421/-87189063 / 0177 3381293 Stattdessen dräut der nächste [email protected]: 0173 2404099 / 0177 3381293 Lockdown. -
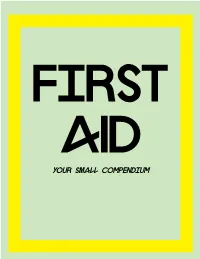
Your Small Compendium Editorial
First aID your sMall compendium Editorial DeaR fReshmen, HeRe we go! Let youR studies at HfK begin. The FiRst aid Team welcomes you waRmly and hopes you’ll feel at home veRy soon. To facilitate youR staRt in BRemen, we summed up some infoRmation foR you on the following pages. also, you‘Re VeRy Welcome to check out ouR favouRite places in town that we added in heRe. Just click on the Pictures to get moRe information. We wish you joy, eneRgy and cuRio- sity to all the things waiting heRe foR you. youRs FiRst aid Any further questions? www.facebook.com/groups/erstehilfehfk/ [email protected] Table of Contents 1 GeneRal 6 The UniveRsity of the aRts BRemen infoRmation about TRavel diRections the HfK Opening houRs 1.1 Contact PeRsons 8 InteRnational Office Student SeRvices office Event office Music 9 Faculty administRation 1.2 InteRnal 12 communication platfoRm foR communication all HfK membeRs at the HfK web-poRtal aRtist InfoRmation coRRidoR 13 WiReless LaN and email addRess aSta Student union 14 Telephone numbeRs 2 Studying at 16 SemesteR dates and the HfK national holidays 2013 � 2014 17 OveRview and stRuctuRe of study pRogRammes 18 OveRview Faculty of Fine aRts and Design OveRview Faculty of music 19 CouRse book IntRoductoRy meetings of the study pRogRammes RegulaR events at HfK 20 Food 2.1 Useful 23 EnRolment infoRmation Re-enRolment SemesteR contRibution SemesteR ticket 23 Health insuRance 24 Liability insuRance Resident peRmit 25 ERasmus � visiting students 26 InteRnational student caRd 27 Studying with childRen 2.2 Facilities