Liquid Democracy in Der Piratenpartei
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
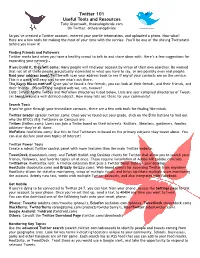
Twitter 101 Useful Tools and Resources Toby Greenwalt, Theanalogdivide.Com on Twitter: @Theanalogdivide
Twitter 101 Useful Tools and Resources Toby Greenwalt, theanalogdivide.com On Twitter: @theanalogdivide So you’ve created a Twitter account, entered your profile information, and uploaded a photo. Now what? Here are a few tools for making the most of your time with the service. You’ll be one of the shining Twitteratti before you know it! Finding Friends and Followers Twitter works best when you have a healthy crowd to talk to and share ideas with. Here’s a few suggestions for expanding your network. If you build it, they will come: Many people will find your account by virtue of their own searches. Be warned that not all of these people are actually interested in what you have to say, or are possibly even real people. Raid your address book: Twitter can scan your address book to see if any of your contacts are on the service. This is a quick and easy way to see who’s out there. The Kevin Bacon method: Once you’ve found a few friends, you can look at their friends, and their friends, and their friends… Discover the tangled web we, um, tweave! Lists: Similar to the Twibes and WeFollow directories listed below, Lists are user-compiled directories of Tweet- ers based around a well defined subject. How many lists are there for your community? Search Tools If you’ve gone through your immediate contacts, there are a few web tools for finding like minds. Twitter Grader (grader.twitter.com): Once you’ve found out your grade, click on the Elite buttons to find out who the BTOCs (Big Twitterers on Campus) are. -

Title: “How to Make Every Year a Year for Citizens!”
Draft version of 18 October 2013 2013 EUROPEAN CLOSING CONFERENCE YEAR OF CITIZENS Venue: Seimas (Lithuanian National Parliament), Vilnius Dates: Thursday, 12 December & Friday, 13 December Title: “How to make every year a year for citizens!” THURSDAY 12 DECEMBER 2013 BLOCK 1 “The role of Civil Society in European Democracy” 12:00 – 14:30 Arrival of participants and registration 14:30 – 15:00 Plenary session : "Taking stock of the 2013 European Year” Welcome words by Lithuanian Presidency Chair: Ylva Tivéus, Director 'Citizens', DG Communication, European Commission Opening speeches (7 minutes each): 1. Ylva Tivéus (European Commission) 2. Jean-Marc Roirant, chairman of EYCA (France) 3. Andris Gobiņš, European Economic and Social Committee, Rapporteur on EYC2013 (Latvia) 15:00 – 16:30 15:00 – 16:30 Parallel Session 1 Parallel Session 2 The role and the future of civil society Shaping Europe from the bottom up! organisations in building our Europe Chair: Sophie Beernaerts, Head of Unit, Chair: Andris Gobiņš, Member of European ‘Citizens programme’, DG Communication, Economic and Social Committee, President of European Commission European Movement - Latvia Panellists: Panellists: 1. Niccolo Milanese, European Alternatives – 1. (tbc) … Unit ‘General Institutional Issues’ , Citizens Pact (UK) Secretariat General, European Commission 2. Danny Sriskandarajah, Secretary General, (European Citizens Initiative-ECI) CIVICUS (Australia) 2. Alessandro Giordani, Head of sector 3. Oliver Henman, President of the Board of “Communication, information and networks”, Directors, The European Network of European Commission Representation National Civil Society Associations – Office in Rome (Citizens’ Dialogues) ENNA 3. Philippe Cayla, Euronews Development – 4. Edgaras Leichteris, Knowledge Economy Forum (Lithuania) ECI: “Let us vote” (France) 5. -

Good' Platform-Political Reasons for ‚Bad' Platform-Data. Zur Sozio-Technischen Geschichte Der Plattformaktivitäten F
www.medialekontrolle.de (3.1/2014) 1 Johannes Paßmann und Carolin Gerlitz ‚Good‘ platform-political reasons for ‚bad‘ platform-data. Zur sozio-technischen Geschichte der Plattformaktivitäten Fav, Retweet und Like Abstract: In this article, we explore the relation between platform activities and their usage practices. Taking departure from predefined activities offered by social media platforms, this paper inquires into what may happen if platform features cater to opposing user practices. The paper investigates whether the data they produce can be considered as ‘bad’ platform data, just as Harold Garfinkel conceptualized ‘bad’ clinical records, and does so by engaging with the socio-technical history of Facebook’s Like and Twitter’s retweet and favourite button and their associated cultures of usage. In a first step, we question popular bottom-up narratives that presenti platform features as appropriations of emergent user practices, such as in the case of the retweet button. In a second step, we draw on ethnographic research on the German Favstar sphere – a group of popular Twitter amateurs with specific cooperation practices – to trace the divergent and at points even contradictory user practices in the case of the favourite button. In both cases, the politics of data visibility are of central importance, and a third group of actors appears besides the platform and its users, which recombines existing platform data into new contexts according to specific practices of usage for features. Such ‘satellite platforms’, we argue, can provide ‘good’ platform- political reasons for platform activities to produce ‘bad’ data. Social-Media-Plattformen wie Twitter oder Facebook ermöglichen Nutzerinteraktionen durch eine Vielzahl vordefinierter Handlungs- optionen: Auf Twitter können Nutzer durch Retweets, @replies oder Favorites auf Inhalte reagieren, bei Facebook gibt es Likes, Shares und Kommentare als Reaktionsmöglichkeiten. -

The Relevance of Gatekeeping in the Process of Contemporary News Creation and Circulation in Saudi Arabia
The Relevance of Gatekeeping in the Process of Contemporary News Creation and Circulation in Saudi Arabia Abdullah Almaghlooth A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Digital Media at the University of Salford School of Arts and Media 2013 i Table of Contents List of tables and illustrations ........................................................................................... v Acknowledgements ......................................................................................................... vii Abbreviations ................................................................................................................. viii Abstract ............................................................................................................................ ix Chapter 1: Introduction 1.1 Objectives .................................................................................................................... 1 1.2 Rationale for the study ................................................................................................ 1 1.3 Significance of the study ............................................................................................. 3 1.3.1 Contribution to knowledge ...................................................................................... 3 1.3.2 Importance of the study to Saudi Arabia................................................................. 4 1.4 Research questions ..................................................................................................... -

Twitter and Society
TWITTER AND SOCIETY Steve Jones General Editor Vol. 89 The Digital Formations series is part of the Peter Lang Media and Communication list. Every volume is peer reviewed and meets the highest quality standards for content and production. PETER LANG New York Washington, D.C./Baltimore Bern Frankfurt Berlin Brussels Vienna Oxford TWITTER AND SOCIETY Edited by Katrin Weller, Axel Bruns, Jean Burgess, Merja Mahrt, & Cornelius Puschmann PETER LANG New York Washington, D.C./Baltimore Bern Frankfurt Berlin Brussels Vienna Oxford Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Twitter and society / edited by Katrin Weller, Axel Bruns, Jean Burgess, Merja Mahrt, Cornelius Puschmann. pages cm. ----- (Digital formations; vol. 89) Includes bibliographical references and index. 1. Twitter. 2. Online social networks. 3. Internet-----Social aspects. 4. Information society. I. Weller, Katrin, editor of compilation. HM743.T95T85 2 006.7’54-----dc23 2013018788 ISBN 978-1-4331-2170-8 (hardcover) ISBN 978-1-4331-2169-2 (paperback) ISBN 978-1-4539-1170-9 (e-book) ISSN 1526-3169 Bibliographic information published by Die Deutsche Nationalbibliothek. Die Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the ‘‘Deutsche Nationalbibliografie’’; detailed bibliographic data is available on the Internet at http://dnb.d-nb.de/. Cover art: Klee, Paul (1879---1940): Twittering Machine (Zwitscher-Maschine), 1922. New York, Museum of Modern Art (MoMA). Watercolor, and pen and ink on oil transfer drawing on paper, mounted on cardboard. DIGITAL IMAGE ©2012, The Museum of Modern Art/Scala, Florence. The paper in this book meets the guidelines for permanence and durability of the Committee on Production Guidelines for Book Longevity of the Council of Library Resources. -

Emergent Structure, Semantics and Usage of Social Streams
Emergent Structure, Semantics and Usage of Social Streams Dipl.-Ing. Claudia Wagner, Bakk.rer.soc.oec. DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der technischen Wissenschaften der Studienrichtung Informatik an der Technischen Universit¨atGraz Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr.techn. Markus Strohmaier Institut f¨urWissensmanagement Technische Universit¨atGraz Graz 2013 For my parents Senat Deutsche Fassung: Beschluss der Curricula-Kommission für Bachelor-, Master- und Diplomstudien vom 10.11.2008 Genehmigung des Senates am 1.12.2008 EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst, andere als die angegebenen Quellen/Hilfsmittel nicht benutzt, und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommene Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Graz, am …………………………… ……………………………………………….. (Unterschrift) Englische Fassung: STATUTORY DECLARATION I declare that I have authored this thesis independently, that I have not used other than the declared sources / resources, and that I have explicitly marked all material which has been quoted either literally or by content from the used sources. …………………………… ……………………………………………….. date (signature) Abstract Social streams are aggregations of data that are produced by a temporal sequence of users' activities conducted in an online social environment like Twitter or Facebook where others can perceive the manifestation of these activities. Although previous research shows that social streams are a useful source for many types of information, most existing approaches treat social streams as just another textual document and neglect the fact that social streams emerge through user activities. This thesis sets out to explore potential relations between the user activities which generate a stream (and therefore impact the emergent structure of a stream) and the semantics of a stream. -

Pressemappe Bundesparteitag 2014.1 Bochum 4.1
Pressemappe Bundesparteitag 2014.1 Bochum 4.1. und 5.1.2014 Inhalt Inhalt 2 Grußwort 3 Über den 14. Bundes parteitag 4 Bundesparteitag in Zahlen 4 In eigener Sache: Piraten haben Mitglieder, keine Delegierten! 5 Piraten Parteitagskultur 5 Vorgesehene Tagesordnung 6 Programm am Samstag 4. Januar 2014 7 Programm am Sonntag 5. Januar 2014 7 Die Kandidaten zur Europawahl stellen sich vor 8 Die Piratenpartei - Selbstverständnis und Ziele 14 Unser Selbstverständnis 15 Unsere Ziele 15 Starke Grundrechte und freie Menschen 15 Transparenz und mehr Demokratie 16 Teilhabe an Wissen und Kultur 16 Teilhabe an der Gesellschaft 16 Der Bundesvorstand stellt sich vor 19 Die Geschichte der Piratenpartei(en) 20 Meilensteine der Piratenpartei 21 Zahlen und Fakten zur Piratenpartei 22 Landesverbände 22 Mandate 24 Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin 25 Piratenfraktion im Landtag Schleswig-Holstein 27 Piratenfraktion im Landtag Saarland 28 Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen 29 Parteinahe Organisationen 32 Ansprechpartner Pressestelle: 33 Grußwort 2014 wird ein spannendes Jahr für die Piratenpartei. Nach der Kommunalwahl in Bayern im März stehen für den 25. Mai die Europawahl und weitere Kommunalwahlen in 10 Bundesländern vor der Tür. Dann noch die Landtagswah- len in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Mit Kreativität, Enthusiasmus und echter Beteiligung innerhalb der Partei und unseren Fraktionen können die Piraten dem Politik- betrieb, wie er bis dato existiert, ein Lehrstück in Sachen Demokratie erteilen. Unsere Parteitage sind nicht durchchoreographiert, wie wir es von CDU oder SPD gewohnt sind. Wir streiten um unsere Punkte und wählen Piraten aus unserer Mitte. Das ist ein neues Bild in der Parteienlandschaft und gerade das zeichnet uns aus. -

Guía De Twitter
Un recorrido por la herramienta que se convirtió en plataforma Miguel Jorge, Carlos Rebato, Eduardo Arcos, Marilín Gonzalo, Bárbara Pavan, Elías Notario, Juan Jesús Velasco, Inti Acevedo Índice 1 Introducción 3 Grandes momentos en la breve historia de Twitter 4 Jack Dorsey, la mente que creó Twitter 6 Twitter: Historia de la empresa 11 Todo lo que sucedió en y a través de Twitter: comunicación, sociedad y política 21 Los números de Twitter 24 Qué es Twitter y cómo usarlo 25 Cómo usar Twitter y por qué 28 Consejos para elegir tu nombre de usuario en Twitter 30 La importancia de las personas que componen tu timeline 33 Cómo conseguir más seguidores y retweets en Twitter 36 Las cinco etapas de la aceptación de Twitter 38 Cómo aumentar las visitas a tu web desde Twitter y medirlas de manera efectiva 42 Cómo buscar información en Twitter 50 Recomendaciones para crear buenos hashtags 53 Consejos para crear mensajes de 140 caracteres en Twitter… y no morir en el intento 55 Diez errores comunes en Twitter 58 Diez listas en Twitter que todo usuario debería crear 62 Más de 10 formas creativas y útiles de usar Twitter 67 Ecosistema Twitter: aplicaciones recomendadas 68 Servicios y aplicaciones para tuitear desde el escritorio 74 Aplicaciones para tuitear desde el móvil 77 Herramientas para postear imágenes en Twitter 81 Herramientas de búsqueda de información y seguimiento de temas en Twitter 85 Herramientas de medición en Twitter 89 Las 20 mejores aplicaciones relacionadas con Twitter 94 Listas de usuarios recomendados 95 Los 150 usuarios de Twitter que escriben en español que deberías seguir 100 Cuentas de Twitter de las publicaciones de Hipertextual 101 Cuentas de Twitter del equipo de Hipertextual 103 Cuentas de Twitter recomendadas de Telefónica Twitter: 5 años | Introducción Todo el mundo habla de Twitter, en Twitter y sobre Twitter. -

Informacyjne Samostanowienie W Programie Piratenpartei Deutschland
dr Marcin Piechocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa [email protected] INFORMACYJNE SAMOSTANOWIENIE W PROGRAMIE PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND Streszczenie: Ograniczanie swobód obywatelskich, w tym prawa do prywatności, w imię walki z realnymi lub rzekomymi zagrożeniami, stało się częstą praktyką wielu rządów w demokratycz- nych państwach. Niska świadomość obywateli w zakresie ilości i charakteru danych podlega- jących retencji od lat niepokoją organizacje pozarządowe, jednak nie udało się uczynić tego tematu zagadnieniem szerokiej debaty publicznej. Niemiecka Partia Piratów sformułowała koncepcję informacyjnego samostanowienia, która była odpowiedzią na przypadki ingerencji państwa i prywatnych podmiotów w prywatność obywateli. Przewiduje ona doprecyzowanie sytuacji, w których państwo będzie mogło inwigilować obywateli oraz określenie przez oby- wateli, jakie dane, w jakim zakresie i charakterze będą udostępniali. To nowość, bowiem depu- towani i działacze tej partii zwracają uwagę na niepokojącą tendencję do odwracania zasady domniemania niewinności w kierunku zasady domniemania winy i gromadzenia informacji na temat obywateli, którzy nie są o nic podejrzewani. Słowa kluczowe: informacyjne samostanowienie, Partia Piratów, Internet. W styczniu 2008 roku, kilka lat przed rewelacjami Edwarda Snowdena, niemiecka Partia Piratów opublikowała dokument, datowany na grudzień 2007 roku, z którego wy- nikało, że Ministerstwo Sprawiedliwości kraju związkowego Bawaria otrzymało propo- zycję -

Forum Mondial De La Démocratie Strasbourg 2013
CONNECTER CONNECTING LES INSTITUTIONS INSTITUTIONS AVEC LES CITOYENS AND CITIZENS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE IN THE DIGITAL AGE 2 3 F ORUM MONDIAL DE LA SR T ASBOURG WORLD FORUM DÉMOCRATIE STRASBOURG 2013 FOR DEMOCRACY 2013 ■ Réseaux sociaux, blogs, médias en ligne semblent offrir aux citoyens un ■ Social networks, blogs, and online media offer citizens an access to public accès à la vie publique qui n’aura jamais été aussi direct. Internet est-il en train life which has never before been so direct. Is the internet revolutionising our de révolutionner nos usages démocratiques ? C’est cette question d’actualité democratic practices? This is the topical issue which will be raised this year que pose, cette année, le Forum mondial de la démocratie, organisé par le by the World Forum for Democracy, organized by the Council of Europe, Conseil de l’Europe, avec le soutien du gouvernement français, de la Région with the support of the French government, the Région Alsace and the City Alsace et de la Ville de Strasbourg. Internet est devenu, ces dernières années, of Strasbourg. Over the past few years the internet has become an area of un espace d’innovation démocratique débordant de vitalité. Chaque jour, des democratic innovation which is overflowing with vitality. Every day, partici- sites participatifs sont créés à l’initiative des Parlements, des gouvernements pative websites are created by parliaments, governments or local authorities, ou des collectivités locales ; ils permettent aux citoyens de contribuer direc- allowing citizens to contribute directly to the decision-making process, to tement à la prise de décisions, de débattre en temps réel d’options politiques debate specific political options in real-time and to influence the decisions particulières et d’influer sur les décisions des élus. -

Pirate Party Makes a Raid on German Politics 29 April 2012, by JUERGEN BAETZ , Associated Press
Pirate party makes a raid on German politics 29 April 2012, By JUERGEN BAETZ , Associated Press About 1,500 members gathered in the northern Germany city of Neumuenster to discuss the group's growth. New polls predicted it would win seats in two more state legislatures in May, with forecasters expecting it to secure about 9 percent of the vote in both states. "Many vote for the Pirates as a sign of protest. It is not directed against democracy, but it's based on the unhappiness with the functioning of the established parties," said Alexander Hensel, a political scientist who studies the Pirates at the Members of the Pirates party sit next to a poster reading Goettingen Institute for Democracy Research. "Free Music for Free People" during their party convention in Neumuenster, northern Germany, Saturday, April 28, 2012. Pirates are capturing Analysts say that despite the nation's robust Germany's political system: The party started as a economy and low unemployment, many Germans marginal club of computer nerds and hackers, but its are disenchanted with the established parties, appeal as an anti-establishment movement has lured fueled by outrage over seeing the government many young voters to the ballot boxes, gaining it bailing out banks and businesses to save the parliamentary seats in two consecutive state elections. economy from collapsing in the wake of the (AP Photo/dapd, Clemens Bilan) financial crisis. Thousands in Germany took to the streets last year in rallies during the worldwide Occupy movement, (AP) -- Pirates are capturing Germany's political but it has now all but fizzled out - with the Pirates system. -

Parteienmonitor
Hauptabteilung Politik und Beratung Berlin, im Februar 2010 PARTEIENMONITOR Partei der „digital natives“? Eine Analyse der Genese und Etablierungschancen der Piratenpartei Fabian Blumberg ANSPRECHPARTNER: Dr. Michael Borchard Hauptabteilungsleiter Hauptabteilung Politik und Beratung Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Klingelhöferstr. 23 10785 Berlin 03026996 3503 [email protected] PARTEIENMONITOR 2 INHALTSVERZEICHNIS 1. EINLEITUNG UND ZUSAMMENFASSUNG ..................................... 3 2. HINTERGRUND: FILESHARING, „THE PIRATE BAY“ UND DIE SCHWEDISCHE „PIRATPARTIET“........................................................ 6 3. DAS „ERWECKUNGSERLEBNIS“ ZUGANGSERSCHWERUNGSGESETZ 9 4. MITGLIEDERENTWICKLUNG.....................................................13 5. ANHÄNGERSTRUKTUR, WAHLERGEBNISSE 2009 ........................13 5.1 EUROPAWAHL 2009 .............................................................14 5.2 BUNDESTAGSWAHL 2009 .....................................................15 5.3 WEITERE WAHLEN...............................................................17 6. INHALTLICHE SCHWERPUNKTE UND PROGRAMMATISCHE(S) PROFIL(LOSIGKEIT)........................................................................18 6.1 INFORMATIONELLE SELBSTBESTIMMUNG UND DATENSCHUTZ ..19 6.2 URHEBERRECHT..................................................................19 6.3 OPEN ACCESS.....................................................................22 6.4 PATENTRECHT ....................................................................22 6.6 BILDUNG............................................................................23